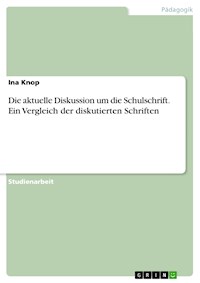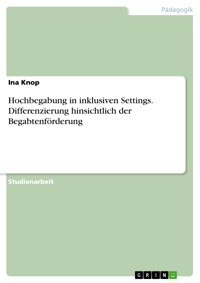29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Sprache: Deutsch
Die moderne Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ist von immer enger werdenden, internationalen Verflechtungen geprägt, sodass eine Begegnung mit dem Fremden zu den Grunderfahrungen eines jeden Menschen gezählt werden kann. Eine kulturelle Differenz ist nicht länger die Ausnahme, sonder der Normalfall, daher muss ein angemessener Umgang mit dem Fremden entwickelt werden. Die moderne Kinderliteratur zeigt sich als ein Spiegelbild dieser kulturell komplexer werdenden Gesellschaft, indem sie konkrete Beispiele für die Konstruktion des Fremden sowie die subjektiven Seiten von Fremdheitserfahrungen, in Form des literarischen Innenblickes, aufzeigt. Dieses Buch untersucht wie in der Kinderliteratur das Thema der interkulturellen Begegnung erfasst wird. Hierzu wird zuerst der Begriff „fremd“ erklärt und dargestellt und anschließend auf die Kinderliteratur übertragen. Ebenso werden die vielen Arten und Darstellungsweisen von „Fremdheit“ aufgezeigt. Es folgen Anmerkungen zum interkulturellen Austausch mit Hilfe dieser Literatur sowie einer anschließenden Darstellung prototypischer Figurentypen, die von einer literalen "Andersartigkeit" umhüllt sind. Zum Schluss wird die Darstellung der Fremdheit in der Kinderliteratur anhand von fünf Beispielen aufgezeigt. Aus dem Inhalt: - Das Fremde; - Multikulturalität; - interkultureller Austausch; - Kinderliteratur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Eine Definition des Begriffes „fremd“
2 Das Fremde als Thema in der Kinderliteratur
2.1 Fremdheit im literaturgeschichtlichen Kontext
2.2 Multikulturalität in der Kinderliteratur
2.2.1 Multikulturalität in Form der Gastarbeiterkinder
2.2.2 Multikulturalität in Form der „Kopftuchmädchen“
2.2.3 Multikulturalität in Form der Migrantenliteratur
3 Kinderliteratur für den interkulturellen Austausch
4 Figurentypen des Fremden
4.1 Der Fremde als Gast
4.2 Der kulturell Fremde
5 Ausländische Figuren in heuristischen Beispielen
5.1 Ben liebt Anna
5.2 Im Land der Schokolade und Bananen
5.3 Milchkaffee und Streuselkuchen
5.4 Der Junge, der Gedanken lesen konnte
5.5 Mein Freund Salim
6 Fazit
Bibliographie
Einleitung
Vermeintlich scheint im aktuellen politischen Diskurs kein Thema derartig präsent zu sein, wie das der Flüchtlinge, welche seit Monaten nach Deutschland emigrieren, was auch aus dem folgenden Zitat des Statistischen Bundesamtes hervorgeht: „Zahl der Zuwanderer in Deutschland so hoch wie noch nie“[1].
Unsere moderne Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ist dementsprechend von immer enger werdenden, internationalen Verflechtungen geprägt, sodass die Begegnung mit dem Fremden, wie sie auch in dieser Arbeit dargestellt werden soll, zu den Grunderfahrungen des Menschen gezählt werden kann. Damit scheint eine kulturelle Differenz nicht länger als eine Ausnahme, sondern als ein Normalfall aufzutreten, weshalb ein angemessener Umgang mit dem Fremden entwickelt werden muss.[2]
Aufgrund dieser Tatsache empfinde ich eine Förderung des interkulturellen Bewusstseins der Menschen als notwendig, um ein positives Miteinander vollziehen zu können.
„Er stellt sich vor, wie es wäre, wenn seine Eltern weiße Haut hätten. Dann würden sich die Leute auf der Straße nicht mehr nach ihm umgucken. Dann würden sie sich nicht mehr wundern, dass er ohne Fehler Deutsch spricht. Klar, was soll er sonst auch sprechen?“[3]
Aus diesem Zitat geht besonders deutlich hervor, dass Fremdheit und Andersheit leider noch immer „einen gesellschaftlichen Problembereich mit enormem Konfliktpotenzial“[4] darstellen, was hier in fiktiver Weise aufgegriffen wurde. Damit Rassismus allerdings in Zukunft unterbunden werden kann, beurteile ich den Erwerb der interkulturellen Kompetenz bei Kindern als besonders bedeutsam, welcher mit dem Beginn der Kompetenz des Hörens und Verstehens der Literatur vermittelt werden kann, indem die Literatur einen Beitrag zu dieser Entwicklung leistet.
Die moderne Kinderliteratur zeigt sich als ein Spiegelbild dieser kulturell komplexer werdenden Gesellschaft, indem sie konkrete Beispiele für die Konstruktion des Fremden sowie die subjektiven Seiten von Fremdheitserfahrungen, in Form des literarischen Innenblickes, aufzeigt.[5]
Aus diesem Grund gestaltet es sich als naheliegend, dass ich im Rahmen dieser Arbeit mit dem Titel „Die Darstellung ausländischer Figuren in der Kinderliteratur“ herausstellen möchte, wie in der Kinderliteratur das Thema der interkulturellen Begegnung verfasst wird, wobei ich den Schwerpunkt auf die Darstellung der jeweils nicht-deutschstämmigen Figuren legen möchte, die im Verlauf der Arbeit oftmals als „ausländisch“ betitelt werden, womit ich jegliche Implikationen bezüglich spezieller Wertungen ausschließen will.
Der benannte Schwerpunkt begründet sich durch die Annahme, dass eine Vielzahl der Leserinnen und Leser mit der deutschen Kultur vertraut sind, wodurch die ausländische Figur als fremd abgegrenzt wird. Um eine kulturelle Synthese herstellen zu können, muss die jeweils fremde Prägung, die durch die Darstellung der ausländischen Figur repräsentiert wird, dementsprechend reflektiert werden. Diese Form der Synthese entspricht zudem den Vorgaben für interkulturelle Kompetenz nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahre 1996, indem sie die Fähigkeit „sich selbstreflexiv mit den eigenen Bildern von Anderen auseinander und dazu in Bezug zu setzen“[6] in den Vordergrund stellt. Für diese Arbeit ist es somit in besonderem Maße bedeutsam, herauszuarbeiten, wie „das Andere“, stets hinsichtlich der Annahme einer deutschen Leserschaft, dargestellt wird.
Des Weiteren möchte ich herausstellen, ob, beziehungsweise inwiefern sich die Darstellungen des Ausländers im Wandel der Zeit in der Kinderliteratur verändert haben, weshalb ich mich für Werke entschied, die aufgrund ihres Ersterscheinungsdatums den zeitlichen Rahmen von 1979 bis 2015 umfassen. Darunter fällt zunächst das Buch mit dem Titel „Ben liebt Anna“ von Peter Härtling, welches das älteste meiner heuristischen Beispiele darstellt und mit dem Zürcher Kinderbuchpreis „La vache qui lit“ ausgezeichnet wurde.[7]
Das nächste von mir ausgewählte Werk wurde im Jahre 1987 von Karin Gündisch verfasst und trägt den Titel „Im Land der Schokolade und Bananen. Zwei Kinder kommen in ein fremdes Land“. Dies wurde 1992 mit dem Preis der Ausländerbeauftragten des Senats der Stadt Berlin ausgezeichnet und beschreibt, so Gündisch im Vorwort, „die Geschichte vieler Spätaussiedlerfamilien“[8], zu denen sie auch ihre eigene Familie zählt.[9]
Als drittes Beispiel suchte ich das Buch „Milchkaffee und Streuselkuchen“ von Carolin Philipps aus dem Jahr 1996 aus, für welches der Autorin der „Mentioning Award des UNESCO Prize for Peace and Tolerance 2000“ verliehen wurde.[10]
Das nächste Werk wurde erstmals 2012 mit dem Titel „Der Junge, der Gedanken lesen konnte. Ein Friedhofskrimi“ veröffentlicht. Verfasst wurde es von Kirsten Boje, einer vielfach ausgezeichneten Autorin, was beispielsweise an der Ehrung ihres Gesamtwerkes durch den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises deutlich wird. [11]
Das Ende dieses zeitlichen Rahmens setzt das Buch „Mein Freund Salim“ von Uticha Marmon, dessen Erstveröffentlichung im Jahre 2015 stattfand. Bislang hat dieses Werk allerdings noch keine Auszeichnung erlangt, was möglicherweise durch die Aktualitätt begründet werden kann.
Als Grundlage für die Analysen, der in diesen Büchern auftretenden ausländischen Figuren, beginnt diese Arbeit mit einem theoretischen Teil, in dem zunächst die Frage „Was ist ‚fremd‘?“ beantwortet werden soll, da im Volksmund der Begriff „Ausländer“ mit dem des Fremden oftmals gleichbedeutend verwendet zu werden scheint. Durch den Versuch einer Definition des Fremden wird dessen Dialektik in Bezug auf das Eigene herausgestellt, was wiederum die Notwendigkeit einer interkulturellen Auseinandersetzung mit diesem Thema unterstreichen soll.
Im darauffolgenden Kapitel 2 wird das Thema „Das Fremde in der Kinderliteratur“ behandelt, womit ich die Relevanz, die „das Andere“ in der Literatur bereits seit mehreren hundert Jahren besitzt, aufzeigen möchte, um anschließend die Multikulturalität als Teil des Fremden aufgreifen zu können, welche durch die ausländischen Figuren, die im praktischen Teil dieser Arbeit analysiert werden, einen besonderen Stellenwert inne hat.
Da, wie zu Beginn geschildert, aufgrund dieser Multikulturaltät der interkulturelle Austausch zwischen den Menschen verschiedener, aufeinandertreffender Kulturen gefördert werden soll, möchte ich im dritten Kapitel darstellen, weshalb sich in besonderem Maße die Kinderliteratur für eben diesen Austausch eignet.
Das Kapitel 4 soll, die Theorie abschließend, beispielhaft aufzeigen, wie fremde Figuren in der Literatur genutzt werden können, womit ich bereits auf den praktischen Teil dieser Arbeit verweisen möchte.
Somit werden im fünften Kapitel die ausländischen Figuren aus den bereits aufgeführten Literaturbeispielen in der Reihenfolge ihrer Ersterscheinung dargestellt, in dessen Rahmen ich sowohl auf die äußere Erscheinung als auch auf die Innenwelt der fiktionalen Charaktere eingehen werde.
Im abschließenden Fazit werde ich meine Ergebnisse zusammenführen und ein persönliches Resümee daraus ableiten.
1 Eine Definition des Begriffes „fremd“
Den Begriff des Fremden genauer zu erläutern scheint eine Notwendigkeit darzustellen, da in Deutschland aktuell, wie in der Einleitung geschildert, zahlreiche Überlegungen zum Umgang mit dem Fremden, vor allem in Bezug auf die Flüchtlingssituation, angestellt werden. Da eine Vielzahl der Debatten um die Änderung des Asylrechts, Diskussionen über Deutschland als Einwanderungsland und ähnliche Themen allerdings negativ behaftet zu sein scheinen, zeichnet sich der Umgang mit dem Fremden innerhalb dieses Rahmens als etwas zwangsläufig negativ konnotiertes ab, als ob das Fremde an sich schon ein Problem sei.[12]
Bei dem Versuch, diesem entgegenzuwirken, werden oftmals die positiven Seiten des Fremden dargestellt, sodass sich das furchterregende Fremde in sein Gegenteil, den sanftmütigen Fremden, der neue Aspekte in die Gesellschaft einbringt und freundlich behandelt werden soll, umkehrt. Zwar ist diese Fremdenfreundlichkeit im Vergleich zu einer Fremdenfeindlichkeit die positivere oder ethisch wertvollere Reaktion, jedoch sind beide Verhaltensmuster dahingehend identisch, dass sie den oder das Fremde bewerten.[13]
Aus diesem Prinzip wird deutlich, dass die Nutzung des Begriffes „fremd“ meistens weder objektiv noch neutral umgesetzt wird. Stattdessen fließen individuelle Emotionen oder Bewertungen in den Gebrauch mit ein, „die den Umgang mit dem Fremden zu einer »Gesinnungsfrage« machen“. [14]