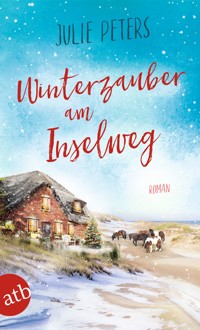9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eine Frau geht ihren Weg
- Sprache: Deutsch
Sie lässt sich durch nichts und niemanden von ihrem Weg abbringen! Westfalen, 1928: Nach dem Medizinstudium kehrt Leni in ihr Heimatdorf zurück und übernimmt die Praxis des Landarztes. Doch die Dorfbewohner trauen ihr nicht, und auch ihre Familie glaubt, sie sei mit der Aufgabe und der Erziehung ihres Kindes überfordert. Aber Leni kämpft gegen alle Vorurteile, wie sie es immer getan hat. Früher stand als Einziger ihr Jugendfreund Matthias an ihrer Seite, doch seit Jahren gilt er als verschollen. Als die Widerstände im Dorf immer größer werden, fasst Leni einen Plan: Sie wird Matthias wiederfinden – denn er ist der Vater ihres Kindes ... Die Geschichte einer starken Frau, die allen Widerständen zum Trotz Ärztin wird. Von der Autorin des Bestsellers „Mein wunderbarer Buchladen am Inselweg“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Sie lässt sich durch nichts und niemanden von ihrem Weg abbringen.
Westfalen, 1928: Nach dem Medizinstudium kehrt Leni in ihr Heimatdorf zurück und übernimmt die Praxis des Landarztes. Doch die Dorfbewohner trauen ihr nicht, und auch ihre Familie glaubt, sie sei mit der Aufgabe und der Erziehung ihres Kindes überfordert. Aber Leni kämpft gegen alle Vorurteile, wie sie es immer getan hat. Früher stand als Einziger ihr Jugendfreund Matthias an ihrer Seite, doch seit Jahren gilt er als verschollen. Als die Widerstände im Dorf immer größer werden, fasst Leni einen Plan: Sie wird Matthias wiederfinden – denn er ist der Vater ihres Kindes.
Die Geschichte einer starken Frau, die allen Widerständen zum Trotz Ärztin wird.
Von der Autorin des Bestsellers »Der wunderbare Buchladen am Inselweg«
Über Julie Peters
Julie Peters, geboren 1979, arbeitete einige Jahre als Buchhändlerin und studierte ein paar Semester Geschichte. Anschließend widmete sie sich ganz dem Schreiben. Sie lebt mit ihrer Familie im Westfälischen.
Im Aufbau Taschenbuch sind bereits die Romane »Mein wunderbarer Buchladen am Inselweg«, »Mein zauberhafter Sommer im Inselbuchladen«, »Der kleine Weihnachtsbuchladen am Meer«, sowie bei Rütten & Loening »Ein Sommer im Alten Land« und »Ein Winter im Alten Land« von ihr erschienen.
Julie Peters
Die Dorfärztin
Ein neuer Anfang
Roman
Für eine Mutter, wie ich sie Leni gewünscht hätte – meine.
Prolog
Oktober 1918
Der junge Soldat zog die Kapuze tief ins Gesicht, er drückte sich neben das Tor in den Schatten des alten Kuhstalls und verschmolz mit der Finsternis. Er beobachtete, was auf dem Vorplatz geschah. Am Morgen hatte man auf dem Hof eine provisorische Sammelstelle errichtet, im Stall ein Dutzend Feldbetten auf dem nackten Boden aufgeschlagen, viel zu schnell waren diese bereits vollständig von Verletzten belegt. Immer wieder erklangen die Stimmen der Krankenträger, Soldaten, die aus den Schützengräben die Verwundeten bargen und sie zu den Unterständen brachten, wo sie dann auf die Pferdewagen geladen und zu den Wartehallen gebracht wurden, von dort ging es weiter zu den Lazaretten.
Dieses Gebäude, früher Kuhstall und nun – ja, was? So genau wusste der junge Soldat das nicht, denn weder Ärzte noch Rotkreuzschwestern beugten sich über die Verletzten, die stöhnend oder völlig apathisch im Halbdunkeln lagen. Wenn er gekonnt hätte, wäre er weggelaufen, doch selbst dazu fehlte ihm der Mut.
Ich muss Matthias finden. Ich muss ihn finden, damit wir gemeinsam heimkehren können, solange seine Mutter noch lebt.
Dies war sein einziger Gedanke. Er galt nicht den Sterbenden zwischen all dem Gestank nach Krankheit und Tod. Dieser Wunsch trieb ihn voran, seit zwei Wochen schon. Seit er seine Sachen gepackt und das elterliche Haus verlassen hatte. Jeder Schritt hierher war eine Qual gewesen, und nun stand er hier, der Herbstregen prasselte nieder, er war durchgefroren und nass, sein Fuß schmerzte mehr als sonst. Aber irgendwo hier draußen musste Matthias sein, und irgendwie musste er es schaffen, ihn nach Hause zu holen, bevor es zu spät war.
»Aus dem Weg, Soldat!« Wieder kamen vier Krankenträger mit einer Trage durch den Regen, der Verletzte darauf regte sich kaum mehr. Sein linkes Bein hing in Fetzen herunter, sein Schuh stieß mit jedem Schritt der Träger auf dem Boden auf. Der Soldat stöhnte nur, eine Hand hob sich und sank dann wieder herunter, als hätte ihn alle Kraft verlassen. Sie brachten ihn in den Stall und blickten sich ratlos um, denn alle Feldbetten waren besetzt. Schließlich stellten sie die Trage ab, einer legte eine Decke auf den Boden, gemeinschaftlich halfen sie dem Verletzten auf dieses Lager, das angesichts seiner Verletzung kaum angemessen war.
Der junge Soldat vor dem Stalltor umklammerte den Stock, auf den er sich stützte, und drehte sich weg. So schwer zu ertragen war das Leid dieser Männer. Seine Hand fuhr unter die Uniformjacke, er ertastete dort den Brief, den er nun schon die ganze Zeit bei sich trug. Bisher hatte er sich nie versucht gefühlt, diese Zeilen zu lesen.
Die Krankenträger trotteten aus dem Stall, die Köpfe gesenkt, zwei schleppten die Trage. Die anderen beiden gingen noch etwas langsamer. Diese wenigen Meter zurück zu dem Lastwagen, das war alles, was ihnen an Erholung gewährt wurde. Denn sobald sie die Köpfe wieder hoben, mussten sie hinaus, weit hinaus in das Gewirr der Schützengräben, wo noch mehr Soldaten warteten, dem Tode geweiht, wenn sie keiner holte.
»He, du!«
Der junge Soldat fuhr zusammen.
Einer der Krankenträger hatte über die Schulter geblickt und ihn am Tor entdeckt. »Willst du hier nur rumstehen?«
»Ich kann nicht da raus.« Der junge Soldat hob den Stock in seiner Rechten, machte sogar zwei Schritte vor, damit der andere sein Hinken bemerkte.
»Tja, das passiert vielen hier. Mach dich nützlich, solange wir die anderen holen. Diese Männer haben Durst.«
Weg waren sie, verschwunden hinter dem Regenschleier. Der junge Soldat hörte ihre Stimmen, einer lachte rau. Das Letzte, was er wahrnahm, war der Geruch von brennendem Tabak. Wenigstens Zigaretten hatten sie. Der Motor des Lastwagens startete, das Brummen verschwand mit der einsetzenden Dämmerung.
Behutsam spähte der junge Soldat nun durch die Stalltür. Im Innern herrschte diese gespenstische Stille, die kannte er schon von seiner Fahrt auf einem der Lazarettzüge entlang der Front von Nord nach Süd. Manchmal schrie einer nach seiner Mutter, die meisten aber waren dafür schon zu schwach.
Neben der Tür stand ein Eimer mit Wasser. Drei Schritte weiter lag auf der ersten Pritsche einer, dessen Wangen vom Fieber rot gefleckt waren, die Augen flatterten im bleichen Gesicht. Um Nase und Mund bildete sich ein fahles Dreieck. Es war nicht mehr weit für ihn, die andere Seite war nicht fern.
Eine Kelle steckte in dem Eimer, also hatte vermutlich schon vorher jemand Wasser an die Verletzten verteilt. Aber warum war hier niemand? Der junge Soldat nahm den Eimer mit der Linken, die Kelle klapperte am Rand, als er den Eimer mühselig zur ersten Pritsche schleppte.
Der Verwundete öffnete bei dem Geräusch die Augen, einen Spaltbreit nur. »Anna«, flüsterte er.
Er hatte sie erkannt. Oder eher in ihr erkannt, was sie wirklich war.
Von diesen Männern hatte sie wohl kaum etwas zu befürchten. Der junge Soldat schlug die Kapuze zurück, das rötlich blonde Haar darunter kringelte sich an den Schläfen, wo sie es vor ihrer Abfahrt raspelkurz abgeschnitten hatte. Der Zopf lag daheim in einer Schachtel, sie hatte es nicht über sich gebracht, ihn wegzuwerfen. Oder ihn wie viele Frauen dieser Tage zu spenden; die Haare wurden beim Bau der U-Boote verwendet, als Ersatz für das isolierende Kamelhaar.
Das junge Gesicht, die kleine Stupsnase, die dunkelblauen Augen, das alles sah der Soldat nicht. Für ihn war sie in diesen Minuten seine Liebste, die er vor vier Jahren oder erst wenigen Stunden zurückgelassen hatte. Einen weiten Weg war er seither gegangen, nun lag er hier. Nicht zum ersten Mal, aber er spürte wohl, dass es das letzte Mal sein würde, denn sein Blick verlor sich in weiter Ferne.
Sie schöpfte Wasser aus dem Eimer, hielt ihm die Kelle an die Lippen. Er schluckte, schluckte, doch das Wasser verrann zwischen seinen Lippen, tropfte auf das Feldbett. »Danke«, flüsterte er dennoch, dann sank er in sich zusammen, seine Augen schlossen sich und er tat einen letzten, allerletzten Atemzug.
Stille. Obwohl hinter ihrem Rücken die anderen Männer atmeten, keuchten, husteten und stöhnten, sie hörte nur das Schweigen dieses einen, der gerade den Kampf um sein Leben für immer verloren hatte.
Sie blieb bei ihm sitzen, bis er fort war. Hatte sie ihn umgebracht? Nein. Viele Jahre später würde sie begreifen, dass jenes fahle Dreieck, das ihm um Mund und Nase gezeichnet war, einer der letzten und klarsten Vorboten des Todes war. Sie legte seine kühlen Hände über seiner Brust zusammen, stand auf und wandte sich den anderen zu. Sie schritt von einem Lager zum nächsten, gab jedem der Männer Wasser. Manche bedankten sich mit brüchiger Stimme, einige dachten, ihre Mutter, Schwester, Liebste sei bei ihnen aufgetaucht und gaben ihr deren Namen. Ida. Regine. Friederike. Maria. Jeden dieser Namen nahm sie an, ohne ihren eigenen zu vergessen.
Tiefste Nacht, stille Dunkelheit. Sie trat nach draußen, als der nächste Transport mit Verletzten in den Hof rollte. Es hatte aufgehört zu regnen. »He, Soldat!«, rief einer der Sanitäter, vermutlich ein Offizier. »Pack mit an, unser Kollege hat die Scheißerei bekommen, sind nur noch zu dritt.«
Sie trat näher, auf ihren Stock gestützt. »Viel kann ich nicht helfen«, sagte sie.
Er musterte sie, von den roten Löckchen bis zu dem Stock, der im Morast versank. »Na, halbe Kraft reicht uns auch.« Gemeinsam mit den anderen beiden Soldaten schob er die Trage bis an den Rand des Wagens, zwei packten vorne an, der dritte zeigte ihr, welchen Riemen sie greifen sollte, und dann schleppten sie einen weiteren Halbtoten in den Stall.
»Der hat’s nicht geschafft, legen wir ihn dorthin.«
Der Wortführer hatte einen Schnurrbart, die dunklen Haare hingen fettig oder nass unter dem Helm hervor. Sie stellten die Trage ab, wickelten den Toten in seine Decke, Leichensäcke gab es wohl keine auf ihrem Lastwagen. »Wohin mit ihm?«, fragte sie und erntete doch nur Schulterzucken.
Kein Platz für die Lebenden, Verletzten, Sterbenden. Nun nicht mal für die Toten.
Das war zu viel für sie.
Der Sanitätsoffizier fand sie vor dem Stalltor, sie hatte sich ein Stück weiter an die Wand gelehnt und kotzte bittere Galle in den Schlamm. Er brummelte etwas, das sie nicht verstand, dann, als sie nur noch Luft würgte, tippte er ihr auf die Schulter und hielt ihr eine Zigarette hin.
Sie nahm sie, trat zurück, schwer atmend stützte sie sich auf ihren Stock.
»Dein Erster?« Er nickte zum Stalltor.
»Er starb, nachdem ich ihm Wasser gab. Ich dachte …«
»Dass du schuld bist?« Er zündete sich die Zigarette an, hielt das Streichholz so, dass auch sie ihre an die Flamme halten konnte. Sie beugte sich vor, sog den Rauch ein und hätte sich fast ein zweites Mal übergeben, aber dann legte sich der Rauch auf ihre Mundschleimhaut. Er rieb in ihrem Hals alles glatt, und als sie es schaffte, ihn für ein paar Sekunden in den Lungen zu halten, spürte sie, wie ihr schwindlig wurde. Aber das war ein guter Schwindel. Einer, der den anderen vergessen machte.
»Hier ist keiner schuld, weil einer verreckt. Wenn’s jemanden gibt, dann suche den in Berlin oder Wien. In Sankt Petersburg oder Paris. Da sitzen die, die uns in diesen verdammten Krieg geschickt haben.«
Sie sah ihn schockiert an. Seine Worte waren der pure Verrat, wusste er das denn nicht? Aber ihn schien das nicht zu kümmern, er rauchte weiter und zeigte mit seiner Zigarette auf ihren Stock. »Wie ist das passiert?«
»Lange Geschichte.« So lang wie ihr Leben, aber sie wollte nicht darüber reden. Es ging hier keinen was an.
»Vermutlich genauso eine, die du nicht erzählen willst wie die, was du hier zu suchen hast. Als Frau. Fräulein gar.«
Sie starrte ihn an, er lachte rau. »Was denn? Die guten Umgangsformen wirst du nicht haben, weil du im Schweinekoben aufgewachsen bist.«
»Nicht ganz. Meine Eltern haben eine Wurstfabrik.«
Hatten, fügte sie in Gedanken hinzu.
»Ah, also ein gutbürgerlicher Stall, aus dem du da kommst. Dachte ich’s mir.« Gespielt ernst lüpfte er den Helm. »Joachim von Werder, stets zu Diensten.«
»Ein Adeliger, der nur Sanitätsdienst macht?«
Er grinste. »Lange Geschichte.«
Das entlockte ihr ein Lächeln.
»Kannst ja doch fröhlich. Also? Nach wem suchst du?«
Sie tastete in der Tasche ihres Mantels, fand den Brief, daneben das Foto, das sie vom Nachttisch seiner Mutter genommen hatte. »Matthias Krüger. Kennen Sie ihn?«
Er nahm sich Zeit, schaute sich die Fotografie lange an, drehte sie um. Sie brauchte keinen Blick darauf werfen, sie kannte dieses Bild nur zu gut, selbst in ihren Träumen tauchte es immer wieder auf. Trotzdem machte es sie nervös, wenn ein Fremder es hielt, und sie atmete auf, als er es zurückgab.
»Noch nie von ihm gehört. Könnte mich umhören oder die anderen fragen. Was ist mit ihm? Bist du seine Liebste?«
Sie spürte, wie sie rot wurde. »Eine Freundin.«
»Seine Freundin?«
Machte das denn einen Unterschied? Reichte nicht, dass sie hier war, um zu beweisen, wie unverbrüchlich sie Matthias verbunden war?
Sie schwieg verbissen.
»Wirst mir schon mehr geben müssen, wenn ich nach ihm suchen soll. Oder willst du selbst da raus?«
Entsetzt schüttelte sie den Kopf. Ihr reichte schon das, was sie hier erlebte, zehn oder zwölf Kilometer hinter der Frontlinie.
»Er soll irgendwo hier draußen sein?«
»Zumindest haben wir im Sommer das letzte Mal von ihm gehört, da war er hier.«
Joachim von Werder lachte rau. »Das muss nichts heißen. Weißt du, oder?«
Sie nickte, zog trotzig an der Zigarette. »Mehr hab ich nun mal nicht.«
Er überlegte, dann traf er eine Entscheidung und warf den aufgerauchten Stummel in eine Pfütze.
»Wie heißt du?«
Sie sog den Rauch ihrer Zigarette tief ein, genoss dieses Schwindelgefühl und nahm all ihren Mut zusammen. »Sag ihm, dass Leni Wittmann hier ist. Sag ihm, es geht um seine Mutter.«
Joachim nickte. Er wollte schon gehen, doch dann nahm er das Päckchen mit den Zigaretten aus der Brusttasche, überlegte kurz, teilte schließlich die darin enthaltene Menge in zwei und gab ihr die eine Hälfte, zusammen mit einem Streichholzbriefchen. »Wirst du brauchen, bis ich zurück bin«, sagte er nur.
»Danke«, erwiderte sie, mehr nicht. Dabei war sie froh, dass er ihr etwas ließ, das die Schmerzen dämpfte. Dass sie sich nicht gänzlich verloren fühlte.
Sie hoffte, es würde nicht zu lange dauern.
Nach dieser Nacht folgte ein Tag, eine weitere Nacht, noch ein Tag. Joachim hatte ihr gesagt, sie solle hier warten, er werde irgendwann zurückkommen. »Ich höre mich um«, das war das Letzte, was sie von ihm gehört hatte, bevor er auf den Lastwagen gesprungen und davongebraust war. Sie hatte dem Laster nachgesehen, in der Dunkelheit gelauscht, bis das Motorengeräusch verklungen war und nur noch die Verletzten ihr Gesellschaft leisteten, die keine Gesellschaft war. Denn vor allem brauchten sie Lenis Hilfe, weil sie starben oder nicht starben, beides war eine Qual.
Leni tat, was sie konnte, aber viel war das nicht. Sie gab den Wachen zu trinken, deckte die Schlafenden wieder zu, sie kühlte hier eine fiebernde Stirn und hielt dort die Hand von einem, den der Albtraum gerade näher zur anderen Seite zog. Sie hatte viel Zeit, so ganz allein mit diesen Männern, die für Kaiser, Gott, und Vaterland in einen Krieg gezogen waren, von dem sie nicht wusste, ob einer von den dreien das gewollt haben konnte. Gott ganz bestimmt nicht, jedenfalls nicht der Gott, wie sie ihn verstand.
In der dritten Nacht, die sie allein mit den Männern war, starben zwei von ihnen. Sie wusste zeitweise nicht, ob sie lachen oder weinen sollte, und weil ihr nichts Besseres einfiel, sang sie für die beiden. Sang auch für diejenigen, die wach lagen und hörten, wie einer der beiden Sterbenden sich quälte. Der andere schlief ein und wachte einfach nicht mehr auf.
Es gab so weniges, was sie verstand. Warum war sie hier allein? Hatte man dieses kleine Lazarett vergessen, war es in der deutschen Gründlichkeit verloren gegangen? Und wenn das so war, was sollte sie noch tun, was konnte sie überhaupt tun? Sie hatte Brot und ein bisschen Fleisch in Dosen, denn hinten im Stall war eine kleine Vorratskammer, wo jemand neben einer jämmerlichen Kiste mit Verbandszeug auch ein paar Vorräte abgestellt hatte. Sie verteilte das Essen, so gut es eben ging, das Wasser wurde knapp, sie wusste nicht, wie sie an neues kommen sollte. Das bereitete ihr die meiste Sorge, neben der Frage, was mit den Toten geschah, wenn nicht bald jemand kam.
Am Morgen saß sie vor dem Stall auf einem Findling, sie rauchte die letzte Zigarette, inzwischen kratzte da nichts mehr im Hals, und ihr wurde nur deshalb schwindelig, weil sie seit vorgestern nichts mehr gegessen hatte.
Und dann rumpelte der Lastwagen heran. Joachim stieg aus, ihr war vor drei Tagen gar nicht aufgefallen, wie groß er war. Bestimmt an die eins neunzig. Hinter ihm sprang einer von der Ladefläche, der kleiner war, dünner als in ihrer Erinnerung, aber das waren sie wohl alle nach vier Wintern mit Kriegsrationen, selbst sie, obwohl sie an den Fleischtöpfen lebte.
Stumm kam er auf sie zu, seine Arme hingen schlaff an seinen Seiten herunter. Er starrte sie aus Augen an, die tief umschattet waren. In seinem leeren Blick sah sie, was der Krieg mit den Soldaten hier draußen machte. Sie sah es in seinem Gesicht, das ihr so vertraut war. Das Blau seiner Augen, selbst das war verblasst.
»Leni«, sagte er.
Stumm reichte sie ihm die halb aufgerauchte Zigarette, und er zog daran wie ein Ertrinkender, der nach Luft schnappt. Joachim ging in den Stall, die anderen Männer vom Sanitätsdienst folgten ihm. Leni rückte ein Stück beiseite, sie klopfte auf den Stein, und Matthias setzte sich neben sie. Ihre Schultern berührten sich, und kurz durchzuckte sie der Gedanke, wie schön sich das anfühlte, wie lange sie sich danach gesehnt hatte, so neben ihm zu sitzen. Einfach nur beisammen sein, davon hatte sie geträumt.
»Von Werder sagt, es geht um meine Mutter.« Matthias räusperte sich.
»Sie stirbt, Matthias.«
Die Friedlichkeit des Moments verflog, zurück blieb nur dieses Gefühl der Leere, das sie selbst schon seit Wochen verspürte. Das er jetzt mit voller Wucht abbekam. Aber was hatte er denn gedacht? Bestimmt nicht, dass sie aus purer Abenteuerlust viele Hunderte Kilometer durch das Reich gereist war.
»Du hättest schreiben können.«
»Das habe ich. Seit August. Es kam keine Antwort. Ich musste es versuchen. Sie …«
Er stand auf, und ihr wurde kalt, weil dort, wo vorhin noch sein kratziger Armeemantel an ihren drückte, jetzt nichts mehr war als die Oktoberkälte.
»Ich kann hier nicht weg, Leni. Siehst du das nicht? Schon der Gedanke …« Er senkte die Stimme, Joachim von Werder kam gerade aus dem Stall, die Stirn umwölkt, der Blick so müde. »Selbst wenn ich wollte. Sie erschießen mich, wenn ich das versuche, Leni. Fahnenflucht. Landesverrat.«
Sie zog den Brief aus der Tasche, zerknittert von den vielen Nachtstunden, die sie auf ihm gelegen hatte. »Das hier hat sie für dich geschrieben. Sie wollte, dass du es liest.«
Neben ihnen wurden die Leichen aus dem Stall geschleppt. Sie luden die Toten auf den Lastwagen, Joachim von Werder schaute zu ihnen rüber. Matthias hielt den Brief in der Hand, als wüsste er nicht, ob er für ihn bestimmt war, blickte zum Laster und zurück.
»Wir müssen wieder los.«
»Und was wird aus mir?«, fragte sie.
Vor allem: Was wird aus den Soldaten, die hier zum Sterben abgeladen werden? Aber das sagte sie nicht.
Joachim von Werder kam rüber. Er steckte sich eine Zigarette an. »Können wir?«, fragte er.
»Wohin bringen Sie die Toten?«
Er zuckte mit den Schultern. »Weiter weg von der Front. Willst du mit?«
Sie drehte sich zum Kuhstall um. Zu den Verletzten, die niemanden hatten. Keiner von ihnen wäre in der Lage, sich zu versorgen – geschweige denn die anderthalb Dutzend anderen Verwundeten.
»Und was ist mit den Verletzten?«
»Wir holen sie, sobald wir können.«
»Wann wird das sein?«
Matthias mischte sich ein. »Du kannst nicht hierbleiben, Lene.«
Lene. Sie lächelte ihn müde an. Wenig fehlte und sie hätte ihm die Hand auf die Wange gelegt, aber sie spürte Joachims Blick, der ihr auch seltsam vertraut war. Und das nur, weil er der Erste gewesen war, der sie hier angesprochen hatte. Lag das an ihrer Einsamkeit? Den Wochen unterwegs, in denen sie vermieden hatte, mit irgendwem zu sprechen? Umtrieben von der Furcht, man könnte in ihr die junge Frau erkennen, die sich in einem gestohlenen Armeemantel zur Front durchschlug.
Sie blickte zum Stalltor, dahinter die Pritschen und Lager auf dem nackten Boden. Dann sah sie Matthias an. Er schien ihren Blick richtig zu deuten, denn er seufzte. »Lene«, sagte er. Resigniert.
»Wir können sie doch nicht alleinlassen«, sagte sie leise.
»In zwei Tagen holen wir sie«, versprach Joachim. Zwei Tage, das war für die Männer dort drinnen eine Ewigkeit. Diese Zeit war selbst ihr schon endlos vorgekommen, obwohl sie ständig was zu tun hatte.
Matthias wandte sich an Joachim, er salutierte. »Bitte um Erlaubnis, bis zum nächsten Krankentransport die Verletzten vor Ort zu versorgen.«
»Krüger, Sie wissen genauso gut wie ich, dass ich nicht befugt bin …«
»Bitte«, flüsterte Leni. »Ich schaffe das nicht allein.«
Die beiden Männer blickten einander lange an. Schließlich nickte Joachim von Werder.
»Erlaubnis erteilt.«
Matthias zögerte. Ihm lag noch etwas auf dem Herzen. »Wir brauchen Vorräte.«
»Wir haben nichts, das wissen Sie, Krüger.«
Beide Männer schwiegen einen Moment. Dann seufzte Joachim von Werder. »Ich habe keine Ahnung, welcher Idiot auf die Idee gekommen ist, hier ein provisorisches Lazarett aufzuschlagen, ohne es mit Personal zu versorgen«, sagte er und legte Matthias eine Hand auf die Schulter. »Darum werden wir schauen, was wir aus dem Lastwagen entbehren können. Danach sind Sie bis zum Eintreffen von Verstärkung auf sich angewiesen.«
Leni stand daneben und hörte zu. Bevor er aber ging, wandte sich Joachim von Werder noch einmal an sie. »Bist du Krankenschwester?«, fragte er.
Vor drei Tagen hatte ihn das nicht interessiert, dachte sie. »Etwas in der Art«, antwortete sie stattdessen.
Er nickte. »Das dachte ich mir schon. Frauen wie dich können wir in den großen Lazaretten brauchen. Kannst gut zupacken und schreckst scheinbar auch vor Blutungen nicht zurück.« Er blickte demonstrativ zum Stalltor, hinter dem ihr einige stark blutende Verletzungen begegnet waren in den vergangenen Tagen. »Wenn du also später nicht direkt heimwillst, wüsste ich eines hinter der Front, wo du sicher wärst. Wo man dich brauchen kann.«
»Ich habe daheim Verpflichtungen.«
»Ja, das verstehe ich gut.«
Damit war das Thema für ihn erledigt.
Matthias stand hinter ihr, als der Lastwagen davonrollte. Er legte eine Hand auf ihre Schulter. »Da sind wir also«, sagte er leise.
Sie schluckte. All ihre Hoffnungen, rasch mit ihm heimkehren zu können, waren zerschlagen. Sie hatte ihn gefunden, er lebte, er war gesund, soweit man das sein konnte in diesem lausigen Krieg. Aber von hier aus ging es nicht weiter.
Nun ja, was hatte sie sich denn auch gedacht? Seit über vier Jahren herrschte dieser brutale Krieg. Sie hatte mit eigenen Augen gesehen, wie sehr die wenigen Männer, die vorzeitig heimkehren durften, von den Schlachten versehrt waren. Wen es nicht so arg erwischte, den flickte man notdürftig zusammen und schickte ihn so schnell wie möglich zurück in die Schützengräben.
»Deine Mutter …«
»Nein«, sagte er fest. »Lass uns nicht mehr von meiner Mutter reden.«
Er drehte sich um und ging zum Lazarett. Leni folgte ihm, sie vergrub die Hände nur kurz in den Manteltaschen und ballte sie zu Fäusten.
Wenn der Krieg bald vorbei wäre … Aber nein, sie machte sich nichts vor. Der Krieg wäre irgendwann vorbei, ja.
Für Matthias und seine Mutter wäre es dann aber zu spät.
Erster Teil
Juli 1928
Die flirrende Hitze über dem Dorfplatz weckte in Leni Erinnerungen an ihre Kindheit. An jene glücklichen Tage, als sie mit ihren Geschwistern und Freunden barfuß die Allee vom Haus ihrer Eltern heruntergerannt waren, um am Brunnen zu plantschen, bis die alte Gret kam und sie verscheuchte.
Sie roch den Staub wie damals und wusste, dies war ihre Heimat. Eine Mischung aus diesem Kratzen im Hals, dem Kitzeln in der Nase, vom Kuhmist und in der Sonne glänzenden Spelzen vom Korn, das die Bauern gemeinschaftlich auf dem Dorfplatz droschen, bevor es in die Säcke gekehrt und zur Mühle gefahren wurde.
Leni bemerkte, wie sich klein und schwitzig die Hand ihrer Tochter in ihre schob. »Mami?«, hörte sie sie fragen. »Mami, wer sind die Leute da? Wieso starren die uns so an?«
Sie schluckte. In Maries Fragen lag etwas verborgen, das in ihr eine Saite zum Klingen brachte, von der sie gedacht hatte, sie wäre längst verstummt. Und sie hätte gern eine Antwort darauf gewusst, die ihrer Tochter die Befürchtung nahm, sie könnten hier nicht willkommen sein.
Etwas schwerfällig hockte Leni sich hin, sie legte den Arm um die Fünfjährige und drückte sie fest an sich.
»Das sind alles unsere Freunde. Sie wissen es nur noch nicht. Wir müssen uns erst ein bisschen besser kennenlernen.«
Maries dunkelblonde Zöpfe kitzelten ihre Wange, als die Kleine ihr Gesicht an das ihrer Mutter schmiegte. Marie schlang die Ärmchen um Lenis Hals. Sie gerieten ins Wanken, fast wäre Leni mit dem Hintern voran im Staub gelandet. Nur mit Mühe stützte sie sich mit einer Hand ab, ihr Fuß war einfach weggeknickt.
»Pass auf«, flüsterte sie nur, und Marie verstand. So wie sie immer verstand. Lauf nicht so schnell vor, Mami kann dir nicht folgen. Gib acht an der Straße, die Autos und Fuhrwerke sind zu schnell. Bleib an der Hand, wenn wir unterwegs sind. Dabei war Marie ein fröhliches Kind, ein Wildfang mit großem Bewegungsdrang. Leni lächelte. Den hatte sie von ihrem Vater, ganz eindeutig.
Ihre Erinnerung war ein trügerisches Bild, verschwommen und kaum mehr erkennbar. Was rückblickend so strahlend schön war, weshalb sie ihrer Rückkehr schon seit Wochen entgegengefiebert hatte, entsprang letztlich ihrem manchmal allzu illusorischen Optimismus. Wenn ich mich nur an die schönen Dinge erinnere, werden mir auch nur schöne Dinge widerfahren. Wenn ich vergesse, wie es auch sein konnte, dann glaube ich irgendwann diesem Zerrbild der Vergangenheit.
»Wohin gehen wir?«
Leni richtete sich wieder auf. Sie zog sich dabei mühsam an ihrem Gehstock hoch, weil sie sich nicht auf die schmalen Schultern ihrer Tochter stützen wollte.
»Zuerst gehen wir nach Hause zu unserer Familie.« Sie straffte die Schultern. Schaute an den Leuten vorbei, die sich hinten an der Dorfstraße zusammengefunden hatten und die Köpfe zusammensteckten. Zwei kleine Kinder drängten sich an eine alte Frau, die Leni nicht auf Anhieb erkannte. Aber das musste nichts heißen. Vielleicht waren sie zugezogen. Und sie selbst war lange nicht hier gewesen.
Zwei Männer standen bei der alten Frau. Die kannte sie: Hans und Peter, sie waren Brüder. Hans im Glück der eine, Pech-Peter der andere. Zwillinge, drei Jahre älter als Leni, wenn sie sich recht entsann. Der vom Glück geküsste hatte einen blonden Schopf, dessen Haaransatz allerdings schon zurückwich. Peters Haare hingegen waren so pechschwarz wie der Name, mit dem das Dorf ihn verspottete, weil er als Zweiter aus dem Bauch der Mutter gekommen war. »Wenn man in eine Meyer-Familie geboren werden will, dann doch nicht als Zweiter«, pflegte ihre Mutter zu sagen. »Und dann auch noch wenige Minuten nach dem Ersten!«
Die beiden ließen Leni und ihre Tochter nicht aus den Augen. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, nach Bockhorst zurückzukehren.
»Wer ist unsere Familie?«
Leni lächelte. Sie liebte Maries unerschöpfliche Neugier. Kein Tag verging, an dem sie ihr nicht Löcher in den Bauch fragte. Sie stupste gegen Maries Näschen. »Deine Omimi, dein Opi und deine Tanten. Deine Onkel Fritz und Carl und deine Cousins und Cousinen.«
Marie kaute am Ende ihres Zopfs herum. Sanft zog Leni ihr die Haare aus dem Mund. Sie rückte die Riemen des Rucksacks gerade, den sie sich auf den Rücken geschnallt hatte. Sie schwitzte unter der Kostümjacke, schwere Wolle, die sie über der Bluse trug. Der Rock war ebenso dick, beides hatte nicht mehr in den Rucksack gepasst. Den Rest ihres Gepäcks, zwei Schrankkoffer, hatte sie nachschicken lassen, aber für die kühlen, regnerischen Tage, die Ende Juli immer kamen, hatte sie das Kostüm unbedingt mitnehmen wollen. Zumal es das beste war, das sie besaß. Und nun war der Rocksaum staubig von ihrem Fußmarsch vom Bahnhof hierher. Über eine Stunde durch die pralle Sonne, die Luft war stickig. Am Horizont türmten sich die Gewitterwolken, doch sie blieben in der Ferne, eine baldige Abkühlung war nicht in Sicht.
Sie gingen die Dorfstraße entlang, vorbei an den Meyer-Brüdern und der Alten mit den Kindern. »Guten Tag«, sagte Leni höflich, ihr schlug das Herz bis zum Hals und Marie umklammerte ihre Hand fester als zuvor.
»Schau an, Wittmanns Leni.« Hans machte einen Schritt nach vorn, er streckte ihr die Hand hin. »Auch mal wieder zu Besuch?«
Leni blieb stehen. Sie wechselte den Gehstock von rechts nach links, damit sie ihm die Hand geben konnte. Dafür musste sie aber Maries Hand loslassen, die sich sogleich noch mehr an ihren Rock drängte. »Hans Meyer zu Bentdorf. Schön, dich zu sehen. Geht’s der Familie gut?«
Er zuckte mit den Schultern. »Gut, was heißt schon gut?«
Peter beäugte sie nur, die Alte sagte auch nichts. Offenbar hatten sie Hans zum Wortführer auserkoren.
»Was bringt dich her? Dachte, du wärst für alle Zeiten in Berlin.«
»Ich bin zurück«, sagte sie. Durchatmen, Schultern straffen, ruhiger Blick. Sie wusste, dass sie das konnte. Von klein auf hatte sie gelernt, mit Sticheleien zu leben, und sogar damit, von den anderen Kindern in ihrem Alter ausgeschlossen zu werden. Wenn es wieder passierte, wäre sie bereit dafür. »Ich werde die Arztpraxis im Dorf übernehmen.«
Hans lachte. »Du? Wieso das denn? Kannst dich doch ins gemachte Nest setzen drüben auf dem Gutshof deiner Mutter.«
»Weil ich mich nicht ins gemachte Nest setzen will.« Sie nahm den Stock wieder in die rechte Hand, die Linke ruhte auf Maries Schulter. »Muss aber jeder wissen, wie er das haben möchte.«
Seine Stirn umwölkte sich vor unterdrücktem Ärger. Seit Jahrhunderten gehörte ein Großteil der fruchtbaren Äcker ringsum Bockhorst den Meyers zu Bentdorf. Sie besaßen das stolze Bauernhaus am Rand des Dorfes mit eigenem Backhaus, großem Gemüsegarten und Obstplantage. Aber Leni ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie wusste, der glückliche Hans war nur ein bellender Köter, vor dem brauchte sie keine Angst haben. Zu sehr hatte ihm der Vater seit frühester Kindheit mit dem Rohrstock eingebläut, dass er seine von Gott gegebene Stellung im Dorf niemals als eine betrachten durfte, die ihn über andere erhob. Hart arbeiten hatten sie dafür müssen.
Vielleicht hatte es da sein pechschwarzer Bruder doch etwas besser getroffen – dem war der Vater mit etwas weniger Strenge begegnet. Leni hielt nicht viel von Prügelstrafen. Ein notwendiges Übel bei manchen Jungs, hatte ihre Mutter immer behauptet. Und dann Leni, die ihre Brüder und die Schwestern immer zu Unfug angestiftet hatte, weil sie selbst nicht so konnte, davor verschont. Bringt eh nix, hatte Regine Wittmann dann gemurmelt und den Teppichklopfer hinter der Stubentür gelassen, während der Vater mit ihrem Bruder Fritz nach draußen ging und ihm eine verpasste, weil er wieder die Kühe auf dem Schlachthof mit der Zwille scheu gemacht hatte.
»Davon wird das Fleisch nicht besser!«, hatte er dann gebrummt, aber Einsicht durfte man von einem Neunjährigen, der sich von seiner sechsjährigen Schwester aufstacheln ließ, wohl nicht erwarten.
Leni schob Marie ein Stückchen voran. »Komm«, sagte sie leise, und die Kleine ging weiter. Vorbei an der alten Frau, die das Kopftuch tief in die Stirn gebunden trug und Leni von unten herauf verstohlen musterte. Vorbei auch an den beiden Kleinkindern, denen der grünliche Rotz aus den Nasen lief. Die Alte fing Lenis Blick auf, sie zog ein Taschentuch unter der Schürze hervor. »Komm her«, bellte sie das größere Kind an, ein Knabe von vielleicht vier Jahren, der sich gehorsam den Schnodder aus dem Gesicht wischen ließ. Die kleine Schwester, wohl kaum älter als zwei und auf pummeligen Beinchen unterwegs, die Füße leicht nach innen gebogen, protestierte mit großem Geheul, als sie danach an der Reihe war.
Leni blieb stehen. Es ging sie nichts an, aber … »Hat sich schon mal ein Arzt die Kleine angeschaut?«
Drei Köpfe zuckten hoch. Die Alte stellte sich sofort schützend vor das Kind, die beiden Männer hielten die Arme verschränkt vor der Brust, unmerklich schoben sie sich nach vorne. Dass sie auch nie den Mund halten konnte! Aber nein, was sie sah, musste sie ansprechen, das war schon immer so gewesen. Statt dass sie erst mit ihrer Mutter redete, sich nach der Familie Meyer zu Bentdorf erkundigte, ob es da vielleicht drunter und drüber ging, ob die Mutter der beiden Kinder fort war oder ob es dieser nicht gut ging. Wenn bei den Kindern etwas nicht stimmte, dann lag oft auch bei der Mutter etwas im Argen, so ihre Beobachtung. »Vergesst es«, sagte sie.
»Was soll mit ihr nicht in Ordnung sein?«, fragte Hans herausfordernd.
»Nichts.« Rachitis, dachte sie. Gut möglich, obwohl sie doch hier draußen jeden Tag herumflitzen konnte. Aber vielleicht war sie nicht genug an der frischen Luft. »Solange sie ihren Lebertran nimmt, ist alles gut.«
Anspannung lag in der Luft. Ihr vorlautes Mundwerk hatte Leni wieder mal in Schwierigkeiten gebracht. In Berlin hatte sie gut hingepasst – die koddrige Berliner Schnauze war sogar noch extremer und hatte offenbar auf sie abgefärbt. Hier im Westfälischen, wo man eher maulfaul war und die Angelegenheiten des Nachbarn einen so ungefähr gar nichts angingen, musste Leni sie sich aber schleunigst abgewöhnen. Sonst würde sie bald in einer leeren Dorfpraxis sitzen, weil niemand zu der neuen Doktorin wollte, die bevormundete einen ja nur.
Als hätte sie nicht schon genug zu bedenken.
»Na, bestimmt ist alles bestens«, sagte sie und erzwang ein Lächeln, um das Gespräch zu beenden. Sie ging weiter und blickte sich nicht noch mal um.
»Mami, wer waren die?«
»Das waren unsere Nachbarn«, erklärte sie nach kurzem Nachdenken, weil ihr nichts Besseres einfiel. Zumal der Meyerhof tatsächlich der nächstgelegene war, wenn man vom Gutshaus Richtung Dorf ging.
»Darf ich mit den Kindern spielen?«
»Na, mal sehen.« Sie umfasste Maries Hand fester. Gehörten die Kinder zu Hans oder zu Peter? Sie würde ihre Mutter auch danach fragen.
Eine Viertelstunde später blieb Leni an der Kastanienallee stehen, die schnurgerade bis zum Gutshaus führte. Sie entdeckte hinter dem dunklen Grün der Bäume die hellgelbe Fassade des weitläufigen Gebäudes, und es fühlte sich an, als hätte jemand ein breites Band um ihr Herz geschnürt und festgezurrt. »Das ist das Haus deiner Omimi«, sagte sie leise.
»Werden wir dort auch wohnen, Mami?«, fragte Marie nach kurzem Schweigen.
Der Wind frischte auf und fuhr durch die Äste, die sich wild bogen und neigten. Die Hitze blies ihr in das verschwitzte Gesicht. In der Ferne war endlich das erlösende Grollen zu hören, das Gewitter nahte.
»Ich weiß es nicht, Marie. Ich weiß es wirklich nicht.«
»Warum habt ihr nicht telegraphiert?«, fragte ihre Mutter, als Leni und ihre Tochter vor ihr standen.
Leni war zu erschöpft, sich mit ihr zu streiten, sie sagte nur: »Hab ich doch. Es kam wohl nicht rechtzeitig an.« Dabei hatte sie das Telegramm schon vor drei Tagen auf dem Postamt aufgegeben.
»Na, kommt erst mal rein. Seid ihr den ganzen Weg vom Bahnhof gelaufen?«
»Nein. Ein Bauer nahm uns mit, er kam von Borgholzhausen und wollte Richtung Versmold. Das letzte Stück sind wir dann gelaufen.«
Ihre Mutter schnaubte. Sie führte sie durch die Eingangshalle linker Hand die Stufen zur Küche herunter, in der die Mamsell stand und Brotteig knetete.
»Hilda? Bring uns Eiswasser und Schnittchen in den Salon. Wollt ihr euch vorher frisch machen?«
Leni zögerte, dann aber nickte sie, denn es würde Marie guttun, wenn sie noch ein paar Minuten mit ihr allein hatte. Schon jetzt merkte sie, wie sich ihr Kind immer mehr an sie drängte, bis sie fast in ihrem Rock verschwand.
»Ihr könnt das Parkzimmer haben.«
Ihre Mutter gab sich einen Ruck, sie ging voran und bog dann ab Richtung Speisezimmer, dahinter erstreckten sich ihr Arbeitszimmer, der Wintergarten, der Salon. »Du kennst ja den Weg.«
Lenis Stock klopfte auf den Holzstufen der geschwungenen Freitreppe, die mehr noch als die hohen Räume im Erdgeschoss von der Größe vergangener Zeiten erzählte. Tock, tock, tock. Auf halber Höhe blieb Leni auf dem Treppenabsatz stehen. Marie kletterte voran, sie wartete oben im stickigen Dämmerlicht des Flurs. Ein Hausmädchen schob sich an Leni vorbei und murmelte etwas. Sie verschwand im Parkzimmer, das mit den grünen Tapeten mit Blümchenmuster und den schweren Walnussmöbeln meist als Gästezimmer genutzt wurde. Die Tür stand offen, das Hausmädchen schlug die Decken zurück. »Das Kind kann im alten Kinderzimmer schlafen«, sagte sie.
Leni spürte Maries Zittern. »Meine Tochter schläft vorerst bei mir«, sagte sie, legte beruhigend die Hand auf die kleine Schulter.
»Wie Sie meinen, Fräulein Wittmann.« Das Mädchen pusselte weiter im Zimmer, zog die Vorhänge auf, der Staub tanzte im gelben Licht vor den Fenstern. Sie riss auch die Fenster auf, die heiße Luft von draußen vermengte sich mit der abgestandenen im Zimmer.
Dann verschwand das Dienstmädchen wieder auf der Treppe, ihre Schritte waren kaum zu hören.
Frieda, fiel es Leni ein. So hieß das Mädchen. War schon seit den letzten Kriegstagen bei ihrer Familie, als …
Nein, nein. Den Gedanken an diese Zeit ertrug sie nur schwer und schob ihn weit von sich. Alles, was damals geschehen war, all die Ereignisse, die sich überschlugen, bevor sie dann im Oktober tagelang in jenem Kuhstall an der deutsch-französischen Grenze gestrandet war, wo Zeit überhaupt keine Bedeutung mehr zu haben schien …
Sie hatte verdrängt, was jene Tage mit ihr gemacht hatten. Wie viel von ihren Erlebnissen jener Zeit sich tief in ihr verwurzelt hatten, so tief, dass sie jetzt erst mal Luft holen musste, bevor sie Maries Hand nahm und das Zimmer betrat.
Leni war nun nicht mehr so froh und voller Zuversicht wie nur einige Stunden zuvor. Den ersten Dämpfer hatte sie ja bereits bei ihrer Begegnung mit den Meyer-Brüdern bekommen. Ach, könnte sie Marie doch nur versprechen, dass alles gut werden würde! Auf einmal schien es keine so gute Idee mehr zu sein wie noch vor wenigen Wochen in Berlin, als sie dachte, es wäre das Richtige – heimkehren, ihren Platz in der Dorfgemeinschaft einfordern, der ihr als Tochter der Fleischfabrikantin Wittmann definitiv zustand.
Hatte sie zu viel verlangt?
Und wie oft musste sie Marie versichern, dass sie keine Angst haben musste, bis sie es sich selbst glaubte?
»Da bist du also wieder.«
Sie fuhr herum. Aus dem Schatten des Flurs tauchte eine große, schlanke Gestalt auf. Leni schrie auf, sie humpelte auf ihre jüngere Schwester Hanni zu, die sie juchzend in die Arme schloss und sogar ein Stück vom Boden hob. Auf Armeslänge hielten sie einander fest, forschten im Gesicht der anderen.
»Wie ist es dir ergangen?«, fragte Leni schließlich.
Hanni lachte. »Das sollte ich dich fragen. Hast dich einfach seit so vielen Jahren hier nicht blicken lassen.«
»Ich hatte Gründe«, sagte sie ausweichend.
Hannis Blick blieb an Marie hängen, die inzwischen auf dem Bett saß und mit ihren Beinen baumelte. Die Strümpfe waren verrutscht und staubig vom langen Fußmarsch.
»Das sehe ich«, sagte Hanni leise.
»Das ist Marie.« Leni schluckte. Noch immer fiel es ihr schwer, für ihre Tochter einzustehen.
»Hat Mama davon gewusst?«
Wusste unsere Mutter, dass du ein uneheliches Kind hast?
»Anfangs nicht. Und später wollte sie nichts davon hören. Aber lass uns lieber von etwas anderem reden.« Bitte, flehte sie in Gedanken. Nicht vor Marie. Später wäre genug Zeit, sich zu erklären.
»Natürlich.«
»Nun sag schon. Wie geht’s dir?«, versuchte Leni das Gesprächsthema von sich abzuwenden.
Sie wuchtete endlich – endlich! – den schweren Rucksack von den Schultern, stellte ihn auf einem Stuhl ab und begann auszupacken.
»Hätte schlimmer sein können. Seit letztem Jahr bin ich Lehrerin in der hiesigen Dorfschule.« Hanni hatte sich zu Marie aufs Bett gesetzt. Lenis Tochter beäugte ihre Tante neugierig und lächelte schüchtern, als Hanni ihrer Nase einen kleinen Stupser verpasste.
»Glückwunsch«, sagte Leni leise. Lehrerin – das hatte ihre jüngste Schwester sich immer gewünscht. »Aber nicht für alle Zeit!«, hatte sie lachend betont, schließlich durften nur unverheiratete Frauen Lehrerin sein. In den Jahren zuvor hatte sie in einer Schule in Osnabrück unterrichtet, bis die Stelle hier frei wurde und man sie ihr anbot, erzählte Hanni. Schließlich gehörte sie zum Dorf.
Das alles wusste Leni bereits, weil ihre Mutter es in einem ihrer monatlichen Briefe geschrieben hatte, die eher an Bulletins erinnerten und alles Wissenswerte über die große Familie berichteten. Leni erinnerte sich noch an die genaue Formulierung ihrer Mutter, denn sie hatte lange auf diesen Worten herumgekaut.
Hanni ist wieder daheim. Die Stelle in der Dorfschule wurde diesen Sommer frei. Sie ist nicht glücklich damit, aber wer ist das schon, wenn nur eine der drei Töchter verheiratet ist.
Die Praxis vom Dorfarzt steht zum Verkauf. Es brächte sicher einige Schwierigkeiten für dich mit sich – vor allem müsstest du dich irgendwann erklären, falls du das Kind mitbringen willst, wovon ich ausgehe, stur wie du bist. Da ich bei dir nicht sehe, dass du in naher Zukunft – oder überhaupt irgendwann – in den Stand der Ehe einzutreten gedenkst, kann ich dich beim Kauf unterstützen, damit du später auch ein Auskommen ohne deine Familie hast. Betrachte es als Teil deines Erbes, das ich dir ohnehin irgendwann ausgezahlt hätte.
So war ihre Mutter. Sie verbarg ihr gutes Herz hinter wirtschaftlichen Interessen und Mutmaßungen darüber, was andere Menschen wollten oder brauchten.
Hanni fingerte ein Zigarettenetui aus der Rocktasche, sie klappte es auf und entnahm eine Zigarette. Leni stützte sich auf den Stock, als ihre Schwester ans Fenster trat. Sie war müde nach dem langen Fußmarsch und hätte Hanni gern weggeschickt, damit Marie und sie sich einrichten konnten, bevor ihre Mutter nach ihrer Anwesenheit verlangte.
Hanni verstand, was Leni von ihr wollte. Der Rauch flog hinauf ins Blätterdach vor dem Fenster. Erst dann fragte sie beiläufig: »Dein Freund wollte nicht hierher mitkommen?«
Welcher Freund?, hätte Leni am liebsten gefragt. Aber sie hielt den Mund. Eines hatte sie in den letzten zehn Jahren gelernt, manches Mal auf die schmerzhafte Art – es war ihrer Familie gegenüber immer besser, nicht zu viel preiszugeben.
Darum nahm sie Hanni nur die Zigarette aus der Hand und drückte sie auf dem Fensterbrett aus.
Ihre Schwester zog lediglich die Augenbrauen hoch, sagte aber nichts. Manchmal war ein Schweigen aber auch eine Form von Gespräch, und sie standen einfach für ein, zwei Minuten beisammen, sagten nichts und warteten.
Draußen in dem parkähnlichen Garten erklang ein Rufen, dann liefen drei Doggen vom Haus hinaus über die gepflegte Rasenfläche. Leni beugte sich vor.
»Manches ändert sich nie«, meinte sie.
»Vater und die Doggen? Stimmt, das wird sich nie ändern.« Hanni lächelte. »Weißt du noch, damals im Krieg? Als er immer Dosenfleisch für seine Hunde abgezwackt hat, und als die Kontrolleure vom Heer kamen, hat Mutter immer behauptet, wir hätten keine Hunde.«
Leni musste grinsen. »Der Major trat vor der Haustür in einen Haufen von Apollo.«
»Aber er konnte nichts sagen, schließlich hatte er selbst die Arme voll mit Fleisch in Dosen.«
Die Kriegsjahre … Natürlich erinnerte Leni sich daran. Doch bevor Hanni noch eine Erinnerung ausgraben konnte, erklärte sie: »Ich habe Matthias wiedergesehen.« Sie sagte nicht, wann und wo. Hanni spitzte die Lippen, ihr Blick zuckte zur Zigarette, die halb aufgeraucht auf dem Fensterbrett lag. Leni warf den Stummel aus dem Fenster. Sie hasste es, ihrer Schwester wehzutun, aber nur durch die Erwähnung von Matthias konnte sie Hanni zum Schweigen bringen.
Hanni blickte zum Bett, wo Marie still saß und ihre staubigen Strümpfe betrachtete. Sah sie, was Leni sah? Oder sah sie die Ähnlichkeit mit ihrer eigenen Familie, die kirschroten, vollen Lippen und das helle, verwaschene Blau der Augen, das bei Marie noch fast kornblumig war?
»Ach ja, Matthias.« Hannis Hand steckte in der Tasche ihres Rocks, vermutlich zur Faust geballt oder fest um das Etui mit den Zigaretten geschlossen. »Hat Mama dir versprochen, die Praxis zu kaufen, damit du zurückkommst?«
Leni nickte.
»Sie haben sonst keinen gefunden«, erzählte Hanni. »Seit zwei Jahren suchte Dr. Köster wohl schon einen Nachfolger. Als Mama kam und ein Angebot machte, war er froh, dass in Zukunft überhaupt noch ein Arzt hier sein wird. Da nimmt er auch eine Ärztin in Kauf, die mit einem unehelichen Kind auftaucht.«
Sie wusste, dass Hanni sie damit nur ebenso verletzen wollte wie sie ihre Schwester wenige Augenblicke zuvor. Aber sie lächelte alle bösen Worte weg.
»Ich bin jedenfalls froh, wieder hier zu sein.« Sie löste sich vom Fenster, vom Blick über den Park.
»Sei dir da mal nicht so sicher. Das Leben hier ist … anders. Jedenfalls anders als in der Stadt. Berlin ist ja eine völlig fremde Welt, wenn man vom Dorf kommt.«
»Das Dorf ist ebenso fremd, wenn man aus Berlin kommt«, sagte Leni. Wieder hob ihre Schwester die Augenbrauen, stumme Verblüffung über das, was Leni da nur durch die Blume sagte. Dass sie nämlich in Berlin mehr zu Hause war als in diesem westfälischen Kaff, in dem sie gemeinsam aufgewachsen waren.
»Komm, Marie.« Leni streckte die Hand aus, ihre Tochter sprang vom Bett und stellte sich neben sie. Ihre kleine schwitzige Hand in Lenis. Wie ein Anker, der sie am Boden hielt. »Ich zeige dir das Haus.«
»Wie lange werdet ihr hier wohnen?«, rief Hanni ihr nach. Leni blieb in der Zimmertür stehen, drehte sich aber nicht um. »Ich glaube nicht, dass Mutter es auf Dauer mit euch hier aushält.«
Die Worte im Rücken, wie kleine Dolche. Maries Händchen war kalt und klamm. Genau so, wie sie sich gerade fühlte.
Sie hatte das verdient. Hätte sie Matthias mal nicht erwähnt und ihre Schwester damit an die Zeit erinnert, als Hanni für ein paar Wochen bei Leni in Berlin gewohnt hatte. Damals, 1921. Als Hanni sich Hals über Kopf in Matthias verliebt hatte. So sehr, dass nach seinem Korb ihre Wut über seine Abweisung auf Leni abstrahlte und Hanni so feindselig wurde, dass Leni es kaum ausgehalten hatte. Sie war erleichtert gewesen, als Hanni nach Westfalen zurückkehrte und sich nicht mehr bei ihr meldete.
»Wir werden sicher eine Lösung finden. Komm, Marie. Deine Omimi wartet bestimmt schon unten im Salon auf uns.«
Sie fühlte sich schlecht, wie immer, wenn sie auf solche Wortgefechte einging, wenn sie sich wehrte, weil es anders nicht ging. Aber sie war hier genauso zu Hause wie Hanni, sie hatte jedes Recht, hier zu wohnen.
August 1910
In dem engen Flur saß sie auf einem Stuhl vor dem Sprechzimmer und versuchte, sich nicht die Angst anmerken zu lassen. Aber sie war erst neun, und sie wusste nicht, was genau hinter dieser Tür geschah. Oder doch, sie wusste es wohl, weil es meist mit Schmerzen verbunden war. Aber jedes Mal war es anders. Daher rührte die Angst. Sie konnte es nicht einschätzen.
Immer, wenn ihre Mutter morgens verkündete »Heute geht’s zum Arzt, Helene«, spürte sie diese Furcht, die sich kalt in ihrem Bauch ballte, und jedes Mal wollte sie danach wegrennen, so schnell es ihre Füße erlaubten. Aber da fing es ja an. Der eine Fuß, der trug sie kaum, und mit dem anderen konnte sie gar nichts anfangen, der war nur ein lebloser Klumpen Fleisch, der in Schienen gequetscht und in Schuhe gezwängt wurde. Das Einzige, was dieser krumme Fuß vermochte, war Schmerzen bereiten, mehr Schmerzen, als sie aushalten wollte.
»Keiner will Schmerzen aushalten, jetzt sei still«, mehr hatte ihre Mutter dazu inzwischen nicht mehr zu sagen. Deshalb war Leni froh, dass meist ihr lieber Papi mit ihr zum Arzt ging und nicht die gestrenge Mutter. »Ich habe zu tun, dein Vater kümmert sich.« Wie viel Verachtung in diesen Worten lag. Dein Vater, der Nichtsnutz, er wird sich um dich und deinen kaputten Fuß kümmern, da passt ihr ja prima zusammen.
Dr. Köster kam aus dem Behandlungszimmer, dicht hinter einem Bauern, der seine Mütze tief in die Stirn zog und ohne ein Wort nach draußen verschwand. Lenis Vater stand auf, sie erhob sich ebenfalls und suchte seine Hand. Er drückte sie ganz sanft und schob sie dann vor sich her in das kleine Behandlungszimmer.
»Morgen, Herr Wittmann. Na, Leni? Wie geht’s dir heute?« Dr. Köster kniff sie in die Wange, sie hätte sich am liebsten hinter ihrem Vater versteckt. Der Arzt war schon alt, mindestens fünfundvierzig, und sie mochte ihn nicht. Wie seine kalten Hände an ihr herumdrückten, und er immer nur murmelte und nie direkt mit ihr sprach.
Das Behandlungszimmer war klein, verraucht und selbst jetzt im Hochsommer von einer Deckenlampe beleuchtet, weil das Efeu draußen fast vollständig über die beiden kleinen Fenster gewuchert war. Dr. Köster schob Leni zu der Patientenliege. Ihr Vater half ihr hinauf, dann zog sie das Bein an und versuchte, den Schuh vom Fuß zu schieben. Dr. Köster saß untätig hinter dem wuchtigen Schreibtisch aus dunklem Holz, er rauchte und hustete, als ginge ihn all dies nichts an.
Dann war es geschafft, und ihr nackter, krummer Fuß hing neben dem gesunden herab. Dr. Köster trat an die Liege, ihr Vater machte einen Schritt zurück. Das war der unangenehmste Moment dieser Besuche beim Arzt. Wenn seine nikotingelben Finger den deformierten Knöchel umfassten, er den Fuß hin und her drehte und ihr die schwitzige Kälte seiner Hände bis ins Rückgrat kroch.
»Hm«, machte Dr. Köster. Er machte immer nur »hm«, wenn er ihren Fuß untersuchte, viel mehr hatte er meist nicht dazu zu sagen. »Das ist … interessant.«
Sie wusste, was er meinte, und darum kniff sie die Augen zusammen. In gewisser Weise fürchtete sie, was als Nächstes kam.
»Ist der Fuß wieder schlimmer geworden?«, fragte ihr Papi.
»Tja, wissen Sie …« Als Dr. Köster den Fuß hin und her drehte, schossen ihr Tränen in die Augen. »Schon schlimmer. Aber nicht so schlimm, dass man nichts dagegen tun könnte. Allerdings bin ich nicht der Experte dafür. Da müssen Sie nach Osnabrück ins Krankenhaus. Dort kann man Ihrer Tochter hoffentlich helfen.«
Sprich mit mir, dachte sie. Ein einziges Mal nur. Ich bin nicht mehr drei, man kann auch mit mir reden.
Sie wusste selbst, das würde nicht geschehen, denn Dr. Köster sprach immer nur mit ihren Eltern.
»Sehen Sie, die Krümmung ist besser geworden. Aber gut wird’s im Leben nicht. Ihre Tochter wird wachsen. Irgendwann werden allein orthopädische Schuhe nicht reichen, sie wird ihr Leben lang am Stock gehen.«
»Aber sie wird gehen«, bekräftigte ihr Papi.
»Das müssen die Experten entscheiden.« Der Arzt wiegte den Kopf hin und her. Stand auf, ließ endlich ihren Fuß los. Leni atmete auf. Das Schlimmste war vorerst überstanden.
»Schaffst du das?«, fragte Papi, als sie wieder auf der Straße standen. Leni nahm seine Hand, und so spazierten sie das kurze Stück zum Dorfladen. »Im Krankenhaus, meine ich.«
»Ist ja nicht das erste Mal«, murmelte sie.
Er drückte ihre Hand. »Nein, ich weiß. Aber du wirst viel allein sein dort. Darum frage ich.«
Komisch, dachte sie. Mutter fragte sie nie, ob es ihr etwas ausmachte. Das Alleinsein, wochenlang in einem Krankenzimmer mit fremden Kindern, fremden Ärzten und Schwestern. Zugleich wusste sie, dass die Wochen im Krankenhaus das Beste waren, was ihr hätte passieren können. Fort von zu Hause, wo sie sich immer beobachtet fühlte. Im Krankenhaus durfte sie in ihrem eigenen Tempo lernen, sie bekam die Aufgaben zugewiesen und konnte still nacharbeiten, statt sich mit den anderen Kindern ins Klassenzimmer der Dorfschule zu zwängen, wo der Lehrer sich vor allem um die älteren Mädchen kümmerte, weil die dem jungen Mann schöne Augen machten. Dafür hatte Leni kein Verständnis, aber sie war ja noch klein, hieß es immer. Im Herbst würde ihre ältere Schwester Lisabeth aufs Gymnasium in der Stadt gehen, das hatte der Dorflehrer ihrer Mutter empfohlen, weil sie so ein schlauer Kopf war.
»Ich bin ja nicht allein.«
»Nein, ich weiß. Ich werde dich besuchen, sooft es geht.«
Ihr Vater legte den Arm um ihre Schulter, drückte sie kurz an sich. Manche Dinge im Leben verstand Leni nicht. Warum ihr Vater mit ihr zum Arzt ging und nicht ihre Mutter, die sich lieber um die Fabrik kümmerte. War es doch bei anderen Familien nicht so. Auch warum ihr Vater sich um sie sorgte, wenn sie krank wurde, verstand sie nicht. Als sie davon erzählt hatte, dass ihr der Papi die Wadenwickel machte, hatte Hans Meyer zu Bentdorf sie ausgelacht, weil Väter so etwas nicht machen dürften. Das hatte sie gekränkt, denn natürlich durfte ihr Papi alles machen, wer sollte das denn sonst übernehmen? Die Mamsell etwa?
»Na, deine Mutti natürlich!«, hatte er gebrüllt. Er hatte sich gar nicht mehr eingekriegt vor Lachen.
Aber davon verstand er nichts. Ihre Mutter war dafür nicht geschaffen, das sagte sie selbst immer wieder. Sie schien ganz froh darüber, dass Lenis Papi sich ihrer annahm, während sie Abend für Abend im Arbeitszimmer über den Büchern hockte und rechnete.
»Wird Mama mich auch besuchen?«, fragte Leni leise.
Papi drückte ihre Hand. Er seufzte, wie so oft. »Ich weiß es nicht, Leni«, sagte er ruhig.
Also nicht.
Sie schluckte schwer und redete sich ein, es dürfte ihr doch nichts ausmachen, solange ihr Papi kam und sie nicht allein war.
Trotzdem. Ihre Mutter würde ihr fehlen.
Juli 1928
Düster war es in dem kleinen Zimmer. Durch das Fenster fiel kaum genug Licht, dass sie am Schreibtisch sitzend lesen konnte, was ihr Vorgänger auf die Patientenakten geschrieben hatte, die sich nun vor ihr stapelten. Sie stand auf, suchte nach einem Lichtschalter, fand ihn neben der Tür. Für einen Moment leuchtete die Glühbirne auf, doch nur Sekunden später brannte sie mit einem leisen Knall durch, die Dunkelheit kehrte zurück. Leni verbiss sich einen Fluch.
»Was ist denn, Mami?«
Auf der Patientenliege saß Marie. Sie wusste nicht, wohin sonst mit ihrem Kind, deshalb nahm sie es eben überall mit hin. Bei ihrer Mutter wollte sie es nicht lassen – zumal ihre Mutter es auch nicht bei sich haben wollte, vermutete sie – und bei der Mamsell in der Gutsküche wollte Marie nicht allein bleiben, dafür war ihr alles noch zu neu und fremd. Was Leni auch verstand; die Veränderungen der letzten Wochen waren für ihre Tochter einfach noch zu viel. Sie trat zu Marie, küsste sie auf den Scheitel und seufzte. »Ach«, sagte sie dann fröhlich. »Hier ist alles nur etwas staubig und abgenutzt. Ich denke, wir sollten erst mal den Staubwedel schwingen und gründlich lüften.«
Und eine Liste schreiben, was sie noch alles kaufen musste, dachte sie. Stifte, Glühbirne, Papier … Im Grunde fehlte es an allem. Eigentlich bräuchte sie auch einen neuen Schreibtisch, denn dieser war verschrammt und alt, außerdem hatte sie keine guten Erinnerungen daran, wie sie früher mit ihrem Vater hier gesessen hatte. Wie der Arzt sie dabei über den Rand seiner Brille angesehen hatte, während er immer wieder etwas in die Akte schrieb. Wie er nicht mit ihr sprach.
Sie verließ das kleine Behandlungszimmer. Diese Hilflosigkeit hatte sie vergessen. Tief in ihrem Innern vergraben. Sie hatte geahnt, dass ihre Rückkehr nicht leicht werden würde, doch seit sie gestern Nachmittag von ihrer Mutter umarmt worden war, fühlte sich einfach alles an, als wäre sie fehl am Platz.
Nein. Du musst dir nur erst deinen Platz erkämpfen. Und du weißt, wie das geht. Du machst das nicht zum ersten Mal.
Vor dem Behandlungsraum standen im Flur drei Stühle nebeneinander, einer wackelig, bei einem die Sitzfläche aus Flechtwerk durchbrochen, beim dritten fehlte die Lehne. Offenbar hatte der alte Dorfarzt Dr. Köster, bevor er die Praxis verließ, seinen Sperrmüll hier abgeladen und die guten Stühle mitgenommen. Oder es war wirklich all die Jahre so desolat gewesen und ihre Erinnerung spielte Leni einen Streich.
»Mama?« Marie zupfte an ihrem Ärmel.
»Was ist denn, mein Schatz?« Mühsam ging sie auf die Knie, denn sie wusste aus Erfahrung, was auch immer ihre kleine Tochter gerade auf dem Herzen hatte, fiel ihr leichter zu sagen, wenn sie sich dabei mit ihr auf Augenhöhe befand.
»Warum sind wir hier, Mama?«
»Ach, mein Herz.« Sie schloss Marie in die Arme. »Weil wir einen Platz brauchen, wo wir leben können.«
»Aber warum hier, Mama?«
»Schau, hier lebt unsere Familie. Meine Mama – deine Omimi – und mein Papi.«
»Es gefällt mir hier nicht.« Marie zog die Stirn kraus, sie machte sich los und verschränkte die Arme vor der Brust. »Warum können wir nicht weiter in Berlin bei Florian wohnen?«
Leni seufzte. Sie war nicht bereit für dieses Gespräch mit ihrer Tochter. Noch nicht. Wer wusste schon, ob sie es je sein würde?
Weil es zwischen uns Differenzen gibt, die niemand überwinden kann. Darum nicht.
Stattdessen antwortete sie: »Du weißt doch, dass Florian nicht dein Papa ist?«
»Na klar.« Eifrig nickte die Kleine. »Papa ist verschwunden, als ich noch ganz klein war. Aber Florian hat immer auf uns aufgepasst, nicht wahr?«
Das stimmt, dachte Leni.
»Ich glaube, wir können jetzt ganz gut allein auf uns aufpassen.« Sie nahm Maries Hand. »Also, wenn ich früher zum Arzt ging, hat mein Vater mir danach im Dorfladen Lakritze gekauft. Was meinst du – wollen wir schauen, ob es die dort noch gibt?«
Sofort hellte sich Maries Miene auf, denn Lakritze liebte sie ebenso sehr wie Leni. »Aber nur wenn du mir versprichst …«
Sie sprach nicht weiter.
»Was soll ich dir versprechen?«
»Dass du mir mehr erzählst. Warum wir hier sind und nicht woanders.«
»Versprochen«, sagte Leni und richtete sich auf. Sie wusste zwar noch nicht, wie genau sie es anstellen sollte – aber früher oder später musste Marie die Wahrheit erfahren.
»Guten Tag.« Ein paar Glöckchen über der Ladentür, die nicht fröhlich bimmelten, sondern nur müde klapperten. Ein langer Ladentisch aus Holz, dahinter die alte Frenzel, die stand schon solange Leni denken konnte da.
Als sie Leni nun erkannte, huschte ein Lächeln über ihr faltiges, gebräuntes Gesicht, sie fuhr sich über die weißen Haare, als müsste sie kontrollieren, ob die Nadeln den strengen Knoten im Nacken noch gebändigt hielten.
»Schau an, das Fräulein Wittmann«, murmelte sie. »Hab schon gehört, dass Sie wieder im Lande sind.«
»Aber für Sie bin ich doch immer noch die Leni«, sagte Leni leise. Sie trat an den Verkaufstisch. Auf dem Regal dahinter standen die Artikel nebeneinander aufgereiht, und Leni entdeckte sofort das Glas mit den Lakritzen. »Geben Sie uns von dem Lakritz? Wie früher für ’nen Groschen.«
Frau Frenzel lächelte, gerade so, als hätte Leni damit einen Bann gebrochen. Sie zog eine kleine, braune Dreieckstüte unter dem Tisch hervor, drehte sich um und begann, die Tüte zu füllen. »Magste Lakritze so gern wie deine Mama?«, fragte sie Marie.
Lenis Tochter nickte stumm, sie drängte sich etwas näher an Leni.
»Schüchtern ist sie.«
»Das hat sie auch von mir.« Leni lächelte, sie zog eine Münze aus ihrer Geldbörse, legte sie auf den Tisch. Die Papiertüte gab sie Marie, die sich sofort ein Lakritz in den Mund steckte. »Schmecken die so gut wie früher, mh?«
»Magst du eins probieren, Mami?«
Leni nahm ein Stück Lakritz, rund und hart. Der Geschmack erinnerte sie tatsächlich an ihre Kindheit, sofort stand sie wieder mit ihrem Papi in diesem Laden, direkt nach einem jener zahllosen Arztbesuche … Vermutlich bildete sie sich das nur ein, aber ihr linker Fuß schmerzte auch direkt wieder. Leni atmete tief durch.
»Ich war vorhin in der Praxis«, fing sie an.
»Die hat schon lange zu. Will keiner mehr machen.«
Oh. Offensichtlich hatte es sich noch nicht herumgesprochen, dass Leni die Praxis übernehmen würde. Das erstaunte Leni. Dass ihre Mutter ihre Pläne nicht an die große Glocke hängte, nun gut, das verstand sie vielleicht noch. Sie hätte aber darauf wetten können, dass diese Nachricht, nachdem sie gestern den beiden Meyer-Brüdern begegnet war, schnell die Runde machte.
Die Glöckchen über der Tür schepperten. »Tach auch«, hörte sie eine dunkle Stimme in ihrem Rücken. Leni drehte sich um. Peter Meyer zu Bentdorf stand hinter ihr, er hatte die Türklinke noch in der Hand und schien zu überlegen, ob er nicht lieber direkt wieder gehen sollte.
»Tach, Peter.« Die alte Frenzel schien aufzuleben, kaum dass sie ihn sah. »Hab deine Sachen hinten stehen, die hol ich mal.« Sie verschwand hinter dem Vorhang aus fadenscheinigem Leinenstoff, mit dem das Lager vom Verkaufsraum getrennt war.
Peter trat beiseite, als Leni und Marie den Laden verlassen wollten. Er hielt ihnen die Tür auf.