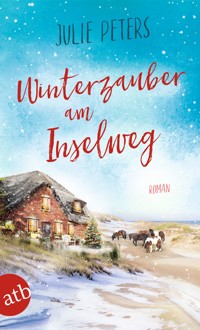9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eine Frau geht ihren Weg
- Sprache: Deutsch
Unermüdlich kämpft sie für ihre Liebe und ihren großen Traum.
Westfalen, 1928: Endlich scheint all das, was sich die junge Ärztin Leni erträumt hat, in Erfüllung zu gehen. Immer mehr Patienten aus dem Dorf strömen in ihre Praxis, und auch ihrem Familienglück steht nichts mehr im Wege, nun da sie ihrer großen Liebe das Jawort gegeben hat. Doch Matthias findet keine Arbeit. Seine einzige Chance scheint ausgerechnet die Kaffeemanufaktur von Lenis Mutter zu sein, mit der sie nach wie vor auf Kriegsfuß steht. Zweifel überkommen Leni, denn was ist, wenn Matthias erneut die Flucht ergreift? Wie damals in Berlin, als er sie mitten in der Nacht allein mit ihrer gemeinsamen Tochter zurückließ ...
Der zweite Band um die junge Ärztin Leni, die allen Widerständen zum Trotz Ärztin in der Provinz wird. Von der Autorin des Bestsellers „Mein wunderbarer Buchladen am Inselweg“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Westfalen, 1928: Endlich kann Leni ein Leben zusammen mit Matthias und ihrer Tochter Marie beginnen. Nach anfänglichem Misstrauen fragen auch immer mehr Dorfbewohner nach ihrem medizinischen Rat. Nur mit ihrer Familie liegt Leni nach wie vor im Streit. Als Matthias vergeblich nach einer Arbeit sucht, erkennt sie, dass auch hier ihre Mutter die Finger im Spiel hat. Leni sieht sich erneut mit der Vergangenheit konfrontiert, denn schon einmal schien ihr gemeinsames Glück nahezu perfekt, ehe es so jäh zerbrochen war. Berlin, 1921: Leni studiert Medizin und vermisst in der Hauptstadt nur eins: Matthias‘ Nähe. Als dieser endlich sein Versprechen erfüllt und zu ihr nach Berlin kommt, ist Leni überglücklich. Doch dann stellt sie fest, dass sie schwanger ist, und ihr Traum, Ärztin zu werden, droht zu zerplatzen.
Über Julie Peters
Julie Peters, geboren 1979, arbeitete einige Jahre als Buchhändlerin und studierte ein paar Semester Geschichte. Anschließend widmete sie sich ganz dem Schreiben. Sie lebt mit ihrer Familie im Westfälischen.
Im Aufbau Taschenbuch sind neben „Die Dorfärztin. Ein neuer Anfang“ bereits die Romane „Mein wunderbarer Buchladen am Inselweg“, „Mein zauberhafter Sommer im Inselbuchladen“ und „Der kleine Weihnachtsbuchladen am Meer“ sowie bei Rütten & Loening „Ein Sommer im Alten Land“ und „Ein Winter im Alten Land“ von ihr erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Julie Peters
Die Dorfärztin - Wege der Veränderung
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog — Januar 1924
Erster Teil
Dezember 1928
Dezember 1918
Dezember 1918
November 1928
Januar 1919
Januar 1919
Dezember 1928
Februar 1919
April 1919
Zwischenspiel: Januar 1924
Zweiter Teil
September 1921
Dezember 1928
September 1921
Oktober 1921
Dezember 1928
Oktober 1921
Oktober 1921
Heiligabend 1928
Januar 1922
Januar 1922
Januar 1929
Februar 1922
Februar 1922
Januar 1929
März 1922
März 1922
Januar 1929
Zwischenspiel: Januar 1924
Dritter Teil
September 1922
Januar 1929
September 1922
Januar 1929
Januar 1923
Februar 1923
Februar 1929
April 1923
Februar 1929
April 1923
Februar 1929
Mai 1923
Epilog
Oktober 1929
Historische Notiz & Danksagung
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Prolog
Januar 1924
Die Tür knallte zu. Zwei Stockwerke polterten die Schritte nach unten, ehe sie auf den Stufen verhallten. Das Letzte, was sie von ihm hörte, war die Haustür, die unten ins Schloss rumste.
»Matthias!«, rief Leni, obwohl sie wusste, dass er sie nicht mehr hören konnte.
Sie stand in der offenen Wohnungstür. Die Kälte zog in die Wohnung. Eine Etage tiefer hörte sie eine Tür aufgehen. »Was soll der Lärm? Hier wollen Leute schlafen, verdammt noch mal!«
»Entschuldigen Sie, Herr Heinemann«, rief Leni nach unten. Sie trat wieder in den kleinen Wohnungsflur und nahm ihren Wintermantel von der Garderobe. In der Wohnung war alles still. Rasch schlüpfte Leni in die gefütterten Stiefel, die ihr so gut passten.
»Verdammt, Matthias«, murmelte sie. Die Stiefel hatte er ihr zu Weihnachten geschenkt. Er hatte sie in seiner spärlich bemessenen Freizeit abends in seiner kleinen Werkstattecke gefertigt, weil sie in gekauften Stiefeln immer auf speziell gefertigte Einlagen angewiesen war. Diese hier saßen perfekt, auch wenn sie bisher selten Gelegenheit gehabt hatte, sie zu tragen. Dass sie ausgerechnet heute eine längere Strecke laufen würde, weil sie ihm nachlaufen musste, war fast schon ironisch.
Sie schlang den Schal um den Hals, griff nach ihrer Handtasche und hatte schon den Schlüssel in der Hand, als sie aus dem Schlafzimmer ein Geräusch hörte. Vielleicht bildete sie es sich auch nur ein. Sie lauschte.
»Schlaf weiter, Marie«, flüsterte sie. »Ich bin gleich wieder da. Muss doch nur deinen Papa zurückholen …«
So ein dummer Streit. Ein unnötiger, blöder Streit. Sie ärgerte sich. Über sich selbst, weil sie nicht früher aufgehört hatte. Weil sie immer weitermachte, als Matthias sie schon anschrie. »Hör auf!«, brüllte er, weil er ihre Vorwürfe nicht ertrug. Aber sie ertrug genauso wenig, wie er ihr Vorhaltungen machte, wie seine Eifersucht sich wie ein Keil zwischen sie trieb.
Sie waren der Situation nicht gewachsen. Beide waren übermüdet, von durchwachten Nächten und der Arbeit tagsüber. »Du sitzt ja nur im Hörsaal!«, hatte er gezischt.
»Das ist auch anstrengend!«, hatte sie widersprochen. Wie sollte sie ihm nur begreiflich machen, dass ihr Medizinstudium sie jede wache Minute begleitete, unabhängig davon, ob sie Wäsche machte, das Abendessen kochte oder das Baby herumtrug, das von den Zähnchen oder Bauchweh geplagt wurde?
»So habe ich mir das jedenfalls nicht vorgestellt«, hatte er gegrollt.
»Was meinst du?«
Sie waren im Wohnzimmer gewesen, und beide flüsterten, denn nebenan schlief das Baby in der Wiege. Leni saß an ihrem kleinen Tisch in der Ecke, an dem sie ihre Lehrbücher ausgebreitet hatte. Sie wusste, auch die waren Matthias inzwischen ein Dorn im Auge, weil sie nicht mehr alles wegräumte, wenn sie mit dem Lernen fertig war. Er verstand nicht, dass selbst das zu viel Energie kostete – abends alles wegräumen und morgens wieder hervorkramen.
»Wir hätten Marie dort lassen sollen, wo sie glücklich war.«
Leni erstarrte. »Aber sie ist unser Kind.«
»Und du hast für sie eine Entscheidung getroffen.«
»Weil ich mir damals nicht anders zu helfen wusste, verdammt noch mal!«
Jetzt schrie sie fast.
Matthias aber starrte sie nur müde an.
»Ich habe mich nicht immer wieder mitten in der Nacht aus dem Staub gemacht. Ich habe dich nie im Stich gelassen. Aber für dich war ja immer anderes wichtiger. Die Politik. Deine Leute. Deine Arbeit. An mich hast du nie gedacht.«
»Das ist nicht wahr«, sagte er dumpf.
Aber Leni konnte es nicht lassen. In ihr hatte sich in den vergangenen Monaten so viel Wut angestaut. So viel Verzweiflung und Erschöpfung, weil sie versuchte, allen gerecht zu werden und ihren Traum dabei nicht aus den Augen zu verlieren. Sie wusste, auch Matthias strengte sich sehr an.
Und wenn es nicht reichte? Wenn all ihre Anstrengungen nur dazu führten, dass sie sich immer nur stritten?
Sie sank auf den Stuhl. »Und nun?«, fragte sie leise.
»Ich weiß es nicht. Aber solange du lieber zu diesem anderen Mann gehst, statt bei uns zu sein …«
Leni schloss die Augen. »Da ist nichts, Matthias. Ich schwöre es dir beim …« Ihr fiel nichts ein, das stark genug war. Und beim Leben ihrer Tochter wollte sie nicht schwören.
»Aber warum gehst du zu ihm?«
Sie konnte es ihm nicht erklären. Nicht so, dass er es verstand, fürchtete sie.
Weil ich dort Ruhe habe. Florian macht nichts, außer dass er mir etwas zu essen und zu trinken bringen lässt. Ich sitze in dem Gästezimmer am Tisch und mache dort das, was ich hier auch mache – ich lerne. Aber ohne, dass du ständig hinter mir stehst. Oder das Baby zu mir will. Ich muss die nächsten Prüfungen bestehen, und das kann ich nicht, wenn ich nicht lernen kann, weil immer etwas zu tun ist.
Das hätte sie ihm sagen können. Aber in diesem Moment hätte es wie ein Vorwurf geklungen. Darum starrte sie nur auf ihre Hände und sagte nichts.
»Ist es so schlimm bei uns?«
»Nein«, flüsterte sie.
»Dann geh nicht mehr. Geh nicht zu ihm, Leni. Ich liebe dich doch. Ich brauche dich.«
Sie blickte auf. Wie er da vor ihr saß, in dem abgewetzten Chintz-Sessel, den sie vom Vormieter übernommen hatten. Seine dunklen Haare waren schon wieder fast zu lang, sie müsste sie ihm schneiden. Leni stand auf und holte aus dem kleinen Badezimmer ein Handtuch und die Schere.
»Jetzt lass doch mal meine Haare in Ruhe«, murrte er.
»Komm mit ins Bad. Bitte.«
Er stand auf und folgte ihr. Unter dem Waschtisch stand ein kleiner Hocker, den er nun vorzog und sich draufsetzte. Leni legte das Handtuch um seine Schultern. Ihre Hände strichen über sein Haar.
»Wir sind beide müde. Können wir morgen weiterreden?«
Er zuckte mit den Schultern. In seinen Augen blitzte etwas auf. »Ist es eine gute Idee, wenn du mir müde die Haare schneidest?«
Leni atmete auf. »Sie wachsen ja wieder nach.«
Aber die Schere ließ sie herabhängen, ihre Arme fühlten sich bleischwer an. Es stimmte, sie war müde.
Es war keine gute Idee, wenn sie müde stritten.
»Du hast recht.« Sie legte Schere und Kamm zurück auf den Waschtisch. »Morgen ist auch noch Zeit für einen Haarschnitt.«
»Versprichst du mir, nicht mehr zu Florian zu gehen?«, fragte Matthias. Er war aufgestanden. Sie standen so dicht voreinander, dass sie den Kopf in den Nacken legen musste, um in sein Gesicht zu sehen.
»Aber …«
Er wusste nicht, was er da von ihr verlangte. Wenn sie nicht mehr zu Florian ging, hieß das auch, dass sie die Prüfungen vielleicht nicht schaffte. Und dann wäre ihr Traum vorbei. Ihr Traum, Ärztin zu werden.
»Bitte, Leni. Ich verlange nicht viel von dir. Nur dieses eine.«
»Weil du denkst, dass ich bei ihm …«
Er seufzte. »Ich denke, du verlierst dich bei ihm. Wegen Joachim.«
»Er ist ein Freund«, sagte sie fest.
»Ja, dein bester Freund. Ich habe das schon verstanden. Ich weiß, während ich nicht hier war, hast du ein anderes Leben geführt. Eines, das ich vielleicht nicht so gut begreife, das mir fremd ist. Aber wir gehören doch zusammen, Leni.«
Sie hatten im Badezimmer voreinandergestanden, so dicht, dass Leni fast seine Brust spürte, die sich mit jedem Atemzug hob und senkte. Sie hatten geschwiegen. Leni hatte gewusst, dass Matthias von ihr eine Antwort erwartete. Und dass die einzige Antwort, die er bereit war zu akzeptieren, war, dass sie sich von Florian von Werder fernhalten würde. Von seinem Kreis reicher Freunde, die rauschende Partys feierten und Charleston tanzten, während daheim Lenis Baby und dessen Vater auf sie warteten.
»Es ist nicht so«, wiederholte sie.
Leni merkte, wie sich in Matthias etwas verschloss. Sah es in seinem Gesicht, das sich verfinsterte. Er zog die dunklen Brauen zusammen, blickte zu ihr herab. Sie wollte nach seiner Hand greifen, aber Matthias machte einen Schritt zurück und stieß dabei gegen den Waschtisch. Ihre Bürste rutschte herunter und knallte auf den Boden.
Bevor Leni noch etwas sagen konnte, fuhr Matthias zum Spiegel herum. Er starrte sie an – durch den Spiegel. Seine Augen blitzten wütend. Sie kannte diesen Blick, kannte auch diese Stimmung, in die er geraten war.
»Bitte, Matthias«, flüsterte sie. Aber es war zu spät. Mit keinem Wort hätte sie ihn jetzt noch erreicht.
Mit einer heftigen Armbewegung fegte er die Flakons, Döschen und Fläschchen vom Waschtisch. Ein ohrenbetäubendes Scheppern. Vor Schreck schrie Leni auf. Doch da hatte er sie schon beiseitegestoßen, riss die Badezimmertür auf und verschwand im Flur. Leni taumelte und fiel gegen die Ecke des Waschtischs. Ein beißender Schmerz durchfuhr ihre Hüfte. Als sie in den Flur humpelte, hatte Matthias bereits die Stiefel angezogen und warf sich den Wintermantel über.
»Geh nicht«, hatte sie ihn angefleht.
Doch er hatte ihr nicht zugehört. Er war einfach aus der Wohnung gestürmt.
Und nun stand sie an der Wiege ihres gemeinsamen Kinds. Sie wollte einfach nur hinter Matthias her, obwohl der Moloch Berlin ihn vermutlich längst verschluckt hatte.
Vielleicht war er noch unten auf der Straße. Wartete auf die Elektrische, um zu seinen Sozialistenfreunden zu fahren.
Ich geh nur kurz runter, dachte sie. Schlaf weiter, Marie. Bitte, schlaf weiter.
Das Baby schmatzte im Schlaf. Der Streit hatte ihre Tochter nicht im Geringsten beeindruckt.
Leni schlich so leise wie möglich raus. Sie musste hinter Matthias her. Er sollte nicht glauben, dass ihre kleine Familie Leni so egal war.
Sie hörte das Weinen, als sie gerade den ersten Treppenabsatz erreichte.
Leni wusste sofort, dass es Marie war.
»Schlaf weiter«, murmelte sie.
Leni stand in der Dunkelheit des Flurs, wartete und lauschte angestrengt. Das Weinen wurde lauter, es war ein verzweifeltes Schreien. Sie schloss die Augen.
Wie sollte ein neun Monate altes Baby aufhören zu weinen, wenn es allein war? Wenn niemand es aus der Wiege hob, es tröstete und umhertrug?
»Es sind doch nur die Zähnchen«, flüsterte sie. Seit Tagen plagte sich Marie mit neuen Zähnen.
Das Weinen verstummte. Leni holte tief Luft. Vielleicht ist sie wieder eingeschlafen, dachte sie. Vielleicht aber lauschte ihre kleine Tochter in der Dunkelheit. Vielleicht wartete sie auf Leni oder Matthias.
Leni stieg die Treppe wieder hoch und schloss die Wohnungstür auf. In dem Moment begann Marie erneut zu weinen. Rasch streifte Leni den Mantel ab, für die Stiefel war keine Zeit. Sie lief ins Schlafzimmer, hob Marie aus der Wiege und drückte ihr Kind an sich. Mit rotem Gesicht schrie das kleine Mädchen ihr all seine Empörung entgegen, weil Leni es so lange hatte warten lassen.
»Scht, ist ja schon gut, mein Schatz. Mama ist ja bei dir. Scht. Na, was bedrückt dich? Die Zähnchen wieder? Das ist aber auch gemein, dass die so wehtun beim Wachsen.«
Sie redete einfach weiter, während sie den Säugling durch die Wohnung trug. Leni wusste später nicht, wie lange es so ging. Jedes Mal, wenn Leni glaubte, Marie sei wieder eingeschlafen und sie versuchte, das Baby in der Wiege abzulegen, wurde es erneut wach und heulte auf. Irgendwann schmerzte Lenis Fuß so sehr, dass sie sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte.
Und dann schlief Marie doch noch ein. Leni saß im Schaukelstuhl im Wohnzimmer, Maries Köpfchen an ihrer Schulter. Sie zog die Häkeldecke von dem kleinen Sofa, die ihre Schwester Lisabeth ihnen geschenkt hatte, deckte Marie und sich damit zu und dämmerte weg, während das Baby an ihrer Schulter zufrieden schnaufte und endlich Schlaf fand.
Am nächsten Morgen weckte sie das Sonnenlicht, das zwischen den Vorhängen hervorblinzelte. In der Nacht hatte es geschneit, deshalb wirkte das Licht von draußen so grell. Leni stand auf und streckte sich. Marie ließ sie auf der Decke im Wohnzimmer, während sie in die Küche ging und ein Fläschchen zubereitete.
Das Bett im Schlafzimmer war unberührt. Auch sonst fehlte von Matthias jede Spur.
Erster Teil
Dezember 1928
Leni blickte aus dem Autofenster. Draußen flog das Braun der ruhenden Felder vorbei, überzogen von einem Hauch Reif. Der Himmel war von einem hellen Grau, die Kälte roch nach Schnee. Sie drückte die Hand ihres Mannes. Matthias lächelte. Er beugte sich zu ihr herüber. »Na, Frau Doktor Krüger?«, fragte er.
Darüber musste sie lachen. »Das klingt aber ungewohnt«, gab sie zu. Siebenundzwanzig Jahre lang hatte jeder sie Leni Wittmann genannt, Fräulein Wittmann, manchmal auch Fräulein Doktor, nachdem sie sich letzten Sommer als Ärztin in ihrem Heimatdorf Bockhorst niedergelassen hatte. Aber nun trug sie einen neuen Namen. Den Namen des Mannes, den sie liebte, seit er ihr vor achtzehn Jahren in einer Oktobernacht Aniskuchen ans Krankenhausbett gebracht hatte, um mit ihr seinen dreizehnten Geburtstag zu feiern.
»Denkst du auch manchmal darüber nach …« Sie sprach nicht weiter, denn in diesem Moment schmiegte sich ihre fünfjährige Tochter Marie an sie. »Mama, ich hab Hunger!«
»Bald gibt’s was!«, meldete sich von vorne ihr Bruder Fritz. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, das Brautpaar an diesem eiskalten Dezembertag im elterlichen Horch zum Standesamt nach Versmold und zurück zu chauffieren. Außerdem hatte er sich Matthias mit den Worten: »Ist lange her, dass wir zusammen getrunken haben, aber ich stelle mich gern zur Verfügung« als Trauzeuge angeboten. Matthias hatte das sehr gern angenommen. »Aber nur, wenn ich bei dir eines Tages auch diese ehrenvolle Aufgabe erfüllen darf.«
Diese Bedingung hatte Lenis Bruder mit einem Kopfschütteln und einem Lächeln weggewischt, als wollte er sagen: »Na, wer will schon einen wie mich?« Und Matthias war viel zu nervös, um zu bemerken, dass seine Worte bei Fritz für Unbehagen sorgten.
Leni schaute auf ihre Hand, die auf Matthias’ Linken ruhte. Der Ring war ein schlichter Goldreif, der ein bisschen zu locker saß; doch es war ihr Ring, und das war die Hauptsache.
»Woher hast du ihn?«, fragte sie leise und berührte das zarte Gold.
»Er gehörte meiner Großmutter. Annes Mutter.«
»Er ist wunderschön.«
Matthias trug keinen Ring. Er behauptete, das kümmere ihn nicht – für ihn sei es wichtiger, dass Leni einen bekam. Und sie verstand, was er damit sagen wollte: Du gehörst zu mir. Ich bin ein armer Schlucker, aber nicht so arm, dass es nicht für diesen Ring reicht, den ich all die Jahre aufgehoben habe, selbst in der schlimmsten Not habe ich ihn nicht versetzt, weil er eines Tages dir gehören sollte.
Der Wagen fuhr so sportlich in die Kastanienallee ein, dass Marie quiekte, weil sie zwischen ihren Eltern eingeklemmt wurde. Matthias legte den Arm um die Schultern seiner Tochter, er berührte kurz Lenis Oberarm. »Du bist wunderschön.«
Sie atmete tief durch. Dieses stille Glück – sie wünschte, es würde ewig dauern.
Doch schon beim Mittagessen im Speisezimmer des Gutshauses Wittmann kam es zu ersten Unstimmigkeiten. Gerade war die Hochzeitssuppe serviert worden – eine klare Rinderkraftbrühe mit Eierstich und Rosenkohl. Leni und Matthias saßen nebeneinander auf halber Höhe der Tafel, neben Leni Marie, neben Matthias Fritz. Am Kopfende hatte Lenis Vater Platz genommen, ihre Mutter an seiner Seite – so war es schon immer gewesen.
Regine Wittmann warf immer wieder einen Blick quer über den Tisch zu dem frisch vermählten Paar. Sie spitzte den Mund, als müsste sie sich mühsam eine Bemerkung verkneifen. Als die Suppenteller abgeräumt wurden und die Dienstmädchen Wein nachschenkten, konnte sie nicht länger an sich halten.
»Da wir nun eine Familie sind«, und sie sagte es so, als wäre dies gegen ihren Willen geschehen, »möchten Sie sich vielleicht auch eine Arbeit suchen, Matthias?«
»Mutter, bitte.« Fritz runzelte die Stirn. »Wollen wir dieses Thema nicht vertagen?«
Leni blickte überrascht auf. Sie hätte damit gerechnet, dass ihr Vater Matthias beisprang. Dass Fritz sich zu Wort meldete, erstaunte sie. Sie lächelte ihn dankbar an.
»Ich stelle doch nur eine Frage.«
»Hat das nicht Zeit bis morgen?«
Lenis Mutter starrte Fritz an. Leni hätte sich gern eingemischt. Aber sie wusste, dass ihre Meinung an diesem Tisch ohnehin nicht zählen würde.
Sie war immer schon die ungehorsamste der drei Wittmann-Schwestern gewesen. Lisabeth, die heute mit ihrem Mann gekommen war – um die Kinder kümmerte sich daheim das Kindermädchen –, hatte genau das getan, was von ihr erwartet worden war. Mit Felix hatte sie eine gute Partie gemacht und außerdem wurde schon bald die Ankunft ihres vierten Babys erwartet. Hanni – nun, Hanni war ein hoffnungsloser Fall. Mit ihren dreiundzwanzig Jahren konnte sie froh sein, als Dorflehrerin eine gute Anstellung gefunden zu haben, auch wenn sie diese der Intervention ihrer Mutter verdankte.
Leni aber hatte sich nicht nur das Studium der Humanmedizin erkämpft. Sie hatte auch auf ihr Herz gehört und es an einen Schustergesellen verschenkt, der sie geschwängert hatte. Dadurch war ihr Studium gefährdet gewesen, lange Zeit hatte es so ausgesehen, als hätte Leni ihren Weg für alle Zeit verloren. Jetzt war sie zurück und betrieb die kleine Praxis im Dorf. Doch der einstige Schustergeselle war ihr nicht aus dem Kopf gegangen, und nun hatte sie ihn nach Bockhorst geholt. Ein Zusammenleben mit ihm in wilder Ehe war ebenso keine Option wie ein Dasein als Alleinerziehende. Ihre Mutter musste also in den sauren Apfel beißen, nachdem Leni nach Berlin gefahren und Matthias überzeugt hatte, dass sie zusammengehörten.
Aber es wäre wohl zu viel von ihrer Mutter verlangt, wenn sie nicht weiter versuchte, die Fäden der Familie fest wie Zügel in der Hand zu behalten.
»Nun, ich werde mir selbstverständlich eine Arbeit suchen.« Matthias’ Stimme war leise und gefasst. Er schien auf diese Auseinandersetzung vorbereitet zu sein. »Ich habe mich erkundigt, und in Versmold gibt es ein paar Schuster. Dort werde ich mich kommende Woche vorstellen.«
Lenis Mutter schnaubte. »Selbstverständlich.«
»Mama.«
»Komm schon, Leni. Denkst du wirklich, er wird eine Arbeit finden?«
»Regine …«, murmelte ihr Vater mahnend. Ihre Mutter kniff die Lippen zusammen. Bevor die Stimmung gänzlich kippen konnte, gab ihr Vater dem Dienstmädchen ein Zeichen, damit es den Hauptgang auftrug.
Leni suchte unter dem Tisch nach Matthias’ Hand, doch er unterhielt sich gerade angeregt mit Lisabeth und ihrem Mann und bemerkte sie gar nicht.
Sie war müde. Wünschte sich, all das wäre endlich vorbei, damit ihre kleine Familie zur Ruhe kommen konnte. Aber sie spürte auch, dass das noch lange dauern würde. Sie hatten gerade erst angefangen, sich in dieses neue Leben einzufinden.
»Das lief ja nicht so gut.«
Matthias stand im gemeinsamen Schlafzimmer, riss die Manschettenknöpfe von den Hemdaufschlägen und warf sie auf die Frisierkommode, die zwischen den beiden Schlafzimmerfenstern stand. Leni kam gerade aus dem Kinderzimmer; Marie wollte heute die erste Nacht in ihrem eigenen Bett schlafen. Nach der Hochzeitsfeier war sie auch rasch eingeschlafen.
»Was genau meinst du?«, erkundigte Leni sich.
Matthias lachte auf. »Du hast recht, es ist alles völlig aus dem Ruder gelaufen.«
»Meine Mutter muss irgendwann verstehen, dass sie nicht unser aller Leben bestimmen kann.«
Natürlich war die Feier nicht ohne Eklat zu Ende gegangen. Nach dem köstlichen Mittagessen hatten sich die Männer in die Bibliothek zurückgezogen, und Lenis Mutter hatte ihre Töchter und die kleine Sophie in den Salon gebeten. Dort ließ sie es sich nicht nehmen, noch einmal auf Matthias’ Situation zurückzukommen.
Leni hatte ihre Mutter scharf in die Schranken gewiesen. »Heute ist meine Hochzeit, Mutter. Wenn du etwas an meinem Ehemann auszusetzen hast, hättest du das gestern sagen können.«
Ihre Mutter hatte daraufhin wieder die Lippen zusammengepresst. Offensichtlich versuchte sie angestrengt, nicht alles zu sagen, was ihr auf der Seele brannte.
»Wenn ihr kirchlich geheiratet hättet, hätte sie das bestimmt getan«, kam es in diesem Moment von Hanni. Ihre Schwester hockte mit überschlagenen Beinen auf der Sofakante und zündete sich genüsslich eine Zigarette an.
»Rennt ihr nur alle in euer Unglück. Irgendwann werdet ihr verstehen, worum es mir geht.« Regine Wittmann nahm das Likörglas, das Grit ihr auf einem Tablett anbot. »Wenigstens Lisabeth ist glücklich.«
Leni und Hanni drehten sich zur ältesten Schwester um, die mit über dem Bauch gefalteten Händen auf dem Sofa thronte, die kleine Sophie und Marie neben sich. »Das glaubt auch nur ihr«, hatte sie gesagt, wollte aber nicht weiter ausführen, was sie meinte.
»Als die Kinder wenig später zum Spielen gingen, hat sie erzählt, was bei ihnen zu Hause los ist.« Leni senkte betreten den Blick. Sie saß auf der Bettkante und legte die Ohrringe ab. »Felix hat eine Affäre.«
»Oh.« Matthias, der auf der anderen Seite des Betts saß, hielt mitten in der Bewegung inne. »Weiß sie, mit wem …?«
»Eine Schauspielerin am Stadttheater. Er bezahlt ihr eine Wohnung und verbringt gelegentlich die Nächte bei ihr. Lisabeth sagt, er gehe ganz offen damit um. Meint wohl, nachdem er ihr vier Kinder geschenkt hat – das waren seine eigenen Worte –, habe er sich ein bisschen Abwechslung verdient.«
»Herrgott.« Matthias stand auf. Er zog das Hemd aus und hängte es über den Paravent. »Und das ist für sie in Ordnung?«
»Nein. Aber was soll sie machen? Ihn vor die Tür setzen? Wohl kaum. Sie haben bald vier Kinder, sie bewohnen eine schicke Etagenwohnung am Sparrenberg, und er verdient wohl auch gutes Geld.«
Matthias brummelte etwas vor sich hin. Leni lächelte, denn sie konnte sich genau vorstellen, was ihm gerade durch den Kopf ging. Dass Geld kein Argument sein dürfe, weshalb zwei Menschen, die einander nicht mehr liebten, zusammenblieben.
»Dabei waren sie früher so ein schönes Paar.« Leni seufzte. Immer noch fiel es ihr schwer, sich an jene Wochen und Monate nach Kriegsende zu erinnern. Nicht, weil sie vieles vergessen hatte. Im Gegenteil – zu klar standen ihr die Erinnerungen noch vor Augen, wie erst alles schlimmer wurde. Nicht nur daheim als Folge der seelischen Zerrüttung all jener jungen Männer, die aus dem Krieg heimkehrten. Nein, das ganze Reich lag am Boden, und es wurde allzu schnell zur Republik ausgerufen. Was zwischen den verschiedenen Parteien dafür sorgte, dass sich tiefe Gräben auftaten. In Berlin herrschten teils bürgerkriegsähnliche Zustände, viele Menschen starben bei den Weihnachtsunruhen, bei denen sich Sozialisten und Nationalisten bis aufs Blut bekämpft hatten. Davon erfuhren sie allenfalls aus der Zeitung, doch auch im Dorf war eine Kluft entstanden, die sich kaum überbrücken ließ.
»Weißt du noch, wie die beiden sich kennengelernt haben?« Matthias setzte sich neben sie aufs Bett. Sie spürte seinen Oberschenkel, der gegen ihren drückte.
»Ach, das waren andere Zeiten«, murmelte sie.
»Ich erinnere mich noch gut.« Seine Finger spielten mit einer rotblonden Locke, die sich aus ihrer Steckfrisur gelöst hatte. Leni stand abrupt auf. Sie begann, die Haarnadeln herauszuziehen, und warf sie achtlos auf die Frisierkommode zu seinen Manschettenknöpfen. Mit der Bürste versuchte sie, die Locken zu bändigen.
»Lass mich das machen.«
Er stand hinter ihr, und ohne auf ihren Protest zu achten, nahm er ihr die Bürste aus der Hand. Leni schloss die Augen. Sie spürte seine Hände, die ihre Locken entwirrten. Einzelne Haarklammern fielen klackernd auf die Kommode vor ihr.
»Setz dich ruhig hin.« Er schob sie Richtung Hocker.
Im Spiegel über der Frisierkommode sah sie ihn an. Er trug das Hemd offen, den Blick konzentriert auf die Aufgabe vor sich gerichtet.
»Also? Weißt du noch?«, flüsterte er und beugte sich vor. Sein Kinn ruhte auf ihrer Schulter, sie sahen sich im Spiegel an. Leni spürte ihr Herz klopfen.
Natürlich wusste sie es noch.
»Du meinst, ich sollte ein schlechtes Gewissen haben?«
»Sei einfach froh, dass der Kelch an dir vorüberging. Du wärst mit ihm nicht glücklich geworden.«
»Die Frage ist, ob es überhaupt eine Frau gibt, die mit Felix Thiemann glücklich werden kann«, murmelte Leni bedrückt.
»Na, die Schauspielerin vielleicht? Wenn sie sich nicht der Hoffnung hingibt, dass er sie irgendwann heiratet. Es gibt ja Frauen, die wollen das gar nicht.«
Leni musste lächeln. Früher, da hatte sie sich auch nichts aus dem Heiraten gemacht. Aber an diesem Abend war sie einfach nur froh, weil es so gekommen war.
»Oder sie hofft darauf, dass er sich scheiden lässt?«
Die Vorstellung war so absurd, dass Leni fast gelacht hätte. »Er wird sich nie von Lisabeth scheiden. Dafür ist er zu sehr darauf bedacht, den schönen Schein zu wahren.«
Matthias nickte nachdenklich. »Das hat er wohl mit deiner Mutter gemein. Vielleicht war sie deshalb damals so begeistert von ihm.«
Leni antwortete nicht. Was genau ihre Mutter vor zehn Jahren in dem jungen Hauptmann Felix Thiemann gesehen hatte, würde ihr auf ewig ein Rätsel bleiben.
»Genug von den beiden«, sagte sie. »Lisabeth ist nicht unglücklich, glaube ich.«
»Glaubst du.«
»Sie hat ihre Kinder und ein sorgenfreies Leben.« War das nicht alles, was zählte?
Aber insgeheim kannte Leni die Antwort. Nein, das war es nicht. Sie war das beste Beispiel dafür, denn wenn es ihr darum gegangen wäre, nur ein sicheres Heim zu haben – ja, dann wäre damals im Winter 1918 alles ganz anders gekommen.
»Lass uns ins Bett gehen«, sagte sie müde.
»Wie du meinst.«
Matthias richtete sich auf. Leni seufzte. Die gute Stimmung nach der Hochzeitsfeier war verflogen. Sie schlüpften unter die Decke und löschten das Licht. Im Dunkeln tastete sie nach Matthias’ Hand. Er lag neben ihr auf dem Rücken, seine Hand drückte ihre. Mehr nicht.
Leni ärgerte sich. Heute sollte der erste Tag ihres gemeinsamen Lebens sein, und sie begannen es mit einer albernen Diskussion über Dinge, die ohnehin nicht in ihren Händen lagen.
Sie hätte nicht von Lisabeth und Felix’ Affäre anfangen sollen.
Aber nun war es passiert, und die Erinnerung an jene Zeit hielt sie in der Nacht lange wach.
Dezember 1918
Ohne Matthias und seine Mutter Anne spürte Leni die Einsamkeit. Sie saß in ihrem Zimmer am Schreibtisch und starrte auf die Bücher, die Hanni ihr ausgeliehen hatte, bevor es ihre jüngere Schwester bereits zurück nach Bielefeld zog. Die heftige zweite Welle des Blitzkatarrh, die mit dem letzten Kriegsherbst über das Land gefegt war und unter den jungen Leuten so viele Opfer gefordert hatte, war verebbt, und die Schulen öffneten wieder ihre Pforten. Leni sollte spätestens zum neuen Schuljahr nachkommen. Geplant war, dass sie in den Monaten bis Ostern zumindest einen Teil des Lernstoffes auffrischte. Immerhin hatte sie seit dreieinhalb Jahren keine Schule mehr besucht.
Ihr Blick ging zum Fenster; draußen fiel seit dem frühen Morgen beständig dichter Schnee. Da wurde nichts aus ihrer geplanten Fahrt nach Bielefeld. Heute früh hatte sie ihre Tasche wieder ausgepackt. Sobald das Wetter sich besserte, konnte sie wieder darüber nachdenken. Bis dahin lag vor ihr auf dem Schreibtisch die silbrig glänzende Taschenlampe, die Matthias ihr zum Abschied geschenkt hatte. Mit einem Lächeln strich sie über das Gehäuse. Sie erinnerte sich so gut an früher. An die vielen Nächte, in denen er ihr diese Taschenlampe geliehen hatte, damit sie lesen konnte, wenn im Krankensaal das Licht längst verloschen war.
Aber diese Träumereien brachten sie nicht weiter.
Sie schlug das oberste Lehrbuch auf. Algebra. Die Zahlenreihen stürzten sie zunächst in große Verwirrung. Ihr Verstand schien von den Kriegsjahren wie vernagelt, sie musste ihn vorsichtig an die Aufgaben heranführen, die für jüngere Mädchen gedacht waren.
Ob es ihr etwas ausmachen würde, wenn sie ab April mit ihrer Schwester dieselbe Klasse besuchte? Immerhin war Hanni knapp vier Jahre jünger als sie.
Nein. Für Leni ging es nur darum, so schnell wie möglich ihr Abitur nachzuholen, das ihr von den Eltern so lange verwehrt worden war. Und danach wollte sie Medizin studieren, in Tübingen, Hamburg oder Berlin. Die Wahl des Studienorts war ihr sogar ziemlich egal, solange sie nur ihrem Traum näher kam. Ärztin werden. Den Menschen helfen, die mit Krankheiten und Verletzungen zu ihr kamen.
Ein Klopfen an der Tür ließ sie aufblicken. »Ja, bitte?«
»Möchtest du dich den ganzen Tag hier einschlie… oh.«
»Ich wollte mir die Schulbücher ansehen, Mutter.«
Lenis Mutter betrat das Zimmer.
»Ich dachte nur …«
»Was? Dass ich mich weinend verkrieche, nachdem du meinen besten Freund und seine Mutter aus dem Haus gejagt hast?«
»Du weißt doch, sie hat Tuberkulose. Und sie wird in Kürze sterben. Denk doch auch an Carl. Wie wird es für ihn sein, wenn immer wieder jemand stirbt? Das jagt ihm doch Angst ein.«
»Als hätte er sich nicht inzwischen ans Sterben ringsherum gewöhnt«, murmelte Leni.
»Wie bitte? Sprich bitte lauter, Leni. Du benimmst dich gerade wie ein Lümmel. Also wirklich.«
»Ich meinte nur, dass wir in den vergangenen Jahren oft genug mit dem Tod gelebt haben.«
»Ja. Aber ich hab’s satt. Darf ich das? Sie gehören nicht zur Familie und haben ein Haus im Dorf. Das ich im Übrigen für sie gekauft habe und günstig vermiete.«
»Ja, natürlich. Hast du ihnen das auch noch unter die Nase gerieben, bevor du sie vor die Tür gesetzt hast? Nicht, dass sie zu wenig Dankbarkeit zeigen, Mutter.« Das letzte Wort betonte sie.
Regine Wittmann schien etwas erwidern zu wollen, doch dann verschränkte sie nur die Arme vor der Brust. »Ich verstehe ja deine Wut«, sagte sie versöhnlich.
»Tatsächlich? Tust du das?«
»Du benimmst dich wie ein ungezogener Backfisch, dem man sein Spielzeug wegnimmt.« Ihre Mutter wurde ärgerlich. »Was hast du denn gedacht? Dass die beiden sich hier für alle Zeiten einnisten dürfen? Dass du ihn heiratest?«
»Was wäre denn so schlimm daran, wenn ich einen jungen Soldaten heirate?«
Lenis Mutter schnaubte. »Der die Uniform schneller abgelegt hat als der Außenminister ›der Kaiser hat abgedankt‹ verkünden konnte. Wir alle wissen, dass das eine Lüge war. Man hat den Kaiser um sein rechtmäßiges Reich gebracht.«
»Glaubst du denn wirklich, der Kaiser hätte weiterregieren können?«, fragte Leni. Sie war ratlos. Nie wäre sie auf die Idee gekommen, dass ihre Mutter eine glühende Royalistin war. Vielleicht war sie das auch gar nicht, sondern sie klammerte sich nur an eine vertraute Ordnung, in der sie ihr Unternehmen aufgebaut hatte.
»Ach, vermutlich nicht.« Regine Wittmann seufzte. »Aber ihn so vom Hof zu jagen? Wäre das nötig gewesen? Und schau dir an, was aus dem Deutschen Reich geworden ist. Nun soll eine Republik daraus werden, in der Kommunisten und Sozialisten das Sagen haben und uns alles wegnehmen.«
»Deshalb also hast du Matthias fortgeschickt? Wegen des Kaisers?« Leni schüttelte den Kopf.
»Du kannst doch deinen Schustergesellen nicht mit dem Kaiser vergleichen.«
Leni zuckte mit den Schultern. Konnte sie eben doch.
»Wie dem auch sei, du hast dich doch mit deinem Medizinstudium gegen eine frühe Heirat entschieden, und du weißt, dein Vater und ich werden dich dabei unterstützen.«
»Dafür bin ich euch auch dankbar, Mutter.« Leni hätte gern mehr dazu gesagt. Zum Beispiel, dass sie beides konnte: Dankbarkeit empfinden, weil sie von der Familie endlich in ihrem Wunsch unterstützt wurde und zugleich voller Groll sein, weil ihre Mutter die kranke Anne Krüger und Matthias wegschickte und Leni auch den Kontakt mit ihm verbot, weil es »besser so « sei. Was sollte daran besser sein, wenn sie ihrem Herzen nicht folgen durfte?
»Ich störe dich lieber nicht länger beim Lernen.«
»Mutter?«
»Ja?« War da so etwas wie Hoffnung im Blick von Regine Wittmann, dass Leni sich bei ihr entschuldigte?
»Wenn ich die Schule und das Studium abgeschlossen habe – spricht dann noch etwas dagegen, dass Matthias und ich heiraten?«
»Aber Leni. Das wird noch Jahre dauern.«
»Bitte, Mutter. Es ist eine einfache Frage.« Aber niemand konnte Lenis Mutter zu einer Antwort zwingen, dessen war sie sich bewusst. »Ich könnte ihn heiraten, sobald ich alt genug bin.«
»Sicher könntest du das.« Ihre Mutter sah auf ihre Hände. »Nur werden wir dich dann nicht länger unterstützen. Du wirst dein Studium dann selbst finanzieren müssen.«
Leni hätte gern vor Wut aufgeheult. Aber sie tat es nicht, denn die Vergangenheit hatte sie gelehrt, dass ihre Mutter immer am längeren Hebel saß. Dass sie immer das letzte Wort haben würde.
Die Tür fiel ins Schloss, sie war wieder allein. Am liebsten hätte sie eines der Lehrbücher gegen die Tür gepfeffert, aber die Bücher konnten ja auch nichts dafür.
Leni schlug das nächste Buch auf und begann zu lesen.
Als sie zwei Stunden später aufstand, brummte ihr der Kopf von so viel Wissen. Sie streckte sich ein wenig, ging ein paarmal auf und ab und blieb am Fenster stehen. Ihr Zimmer, das direkt über dem Haupteingang lag, bot den perfekten Blick die Kastanienallee entlang bis zur Straße, die zum Dorf führte. Sie sah ihren Bruder Fritz, der langsam auf das Haus zuspazierte. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, leicht vorgebeugt und den Kopf gesenkt. So schritt er voran, bis er fast das Rondell erreicht hatte. Dann machte er kehrt, als hätte er etwas vergessen, und marschierte unter den kahlen Bäumen wieder Richtung Dorf.
Leni setzte sich auf die Fensterbank und beobachtete in den folgenden Minuten, wie ihr Bruder mehrmals die Allee auf und ab lief. Immer wieder machte er am Ende kehrt und ging zurück. Wie ein Uhrwerk.
Wie lange machte er das schon?
Leni ging nach unten. Sie schlüpfte in ihre Stiefel, zog den dicken Soldatenmantel an, der einst Rudolf gehört hatte und den sie an sich genommen hatte, als sie im Oktober an die Front reiste, um Matthias zu suchen. Auf dem Weg nach draußen lief ihr die Mamsell über den Weg.
»Wie lange läuft mein Bruder schon da draußen herum?«
»Ach, Fräulein Wittmann. Das macht er doch jeden Tag, sobald er wach wird. Kann nicht still sitzen, der junge Herr. Und im Haus hält ihn auch nichts.«
Leni nickte, als ergäbe das für sie einen Sinn. »Können Sie mir was zu essen mitgeben? Ein wenig Suppe oder ein Stück Brot?«
»Ich werde schauen, was ich finden kann.«
»Danke.« Leni ging nach draußen. Sie wusste, wenn die Speisekammer noch ein paar Leckerbissen hergab, würde die Mamsell sie finden. Nach Kriegsende hatte sich die Versorgungslage noch nicht wesentlich gebessert. Aber auf dem Gut mussten sie nicht hungern, anders als die Menschen in den Großstädten, die dieser Tage kaum was zu beißen hatten.
Sie humpelte die Allee herunter. Fritz kam gerade wieder auf das Gutshaus zu. Als er Leni bemerkte, verlangsamte er seine Schritte.
»Was willst du hier?«, fragte er argwöhnisch.
Sie blieb stehen und stützte sich auf ihren Stock. »Nun ja, dich ein Stück begleiten vielleicht?«
Fritz schnaubte. Er ging an ihr vorbei. Leni konnte nur mit Mühe Schritt halten.
»Hilft es?«, fragte sie.
Er antwortete nicht.
»Kannst du dann vergessen?«
Ihr Bruder blieb stehen. Er drehte sich langsam zu Leni um. »Was weißt du schon?«, fragte er gehässig. »Was weiß denn irgendwer von euch, wie es da draußen war?«
»Vater weiß es. Und Matthias.« Sie senkte den Blick. »Mutter hat ihn fortgeschickt, weißt du?«
»So, wie sie jeden wegschickt, der nicht in ihr Bild von der perfekten Familie passt, ja.« Er stand neben ihr, schaute sie nicht an.
Wollte sie dich auch wegschicken?, hätte sie ihn gerne gefragt. Denn ein Sohn, der körperlich unversehrt heimkam, aber bei dem dafür der Kopf irgendwie nicht wieder in Ordnung kam – der passte nicht ins Bild, schon klar.
»Und nun?«, fragte sie leise. »Wollen wir weitergehen?«
»Kannst du denn noch?«
»Wenn du nicht zu schnell gehst, ja.«
Sie setzten sich wieder in Bewegung. Rauf, runter, rauf, runter.
Die Mamsell kam aus dem Haus. Sie trug einen Korb, den sie mit einem Handtuch abgedeckt hatte. »Warte hier«, bat Leni ihren Bruder. Sie vermutete, dass er kein Interesse daran hatte, zur Mamsell zu gehen.
»Ich hab einen Henkelmann mit Suppe mit drin«, sagte die Mamsell. »Paar Bohnen und Möhrchen. Und ein bisschen Fleisch.« Sie hob das Tuch vom Korb. Darin waren drei kleine, helle Brötchen. »Die hätte es sonst heute Abend gegeben, ich habe einfach alle kleiner gemacht.«
»Danke, Hilda.« Leni drückte den Arm der Mamsell.
»Ach, wenn’s mehr nicht ist. Eh schon zu wenig, dass es dem jungen Herrn Wittmann besser geht.«
Leni ging mit dem Korb zu Fritz, doch der hatte schon wieder seine endlose Wanderung aufgenommen. Sie blieb unter der ersten Kastanie stehen, bis er wieder zurückkam.
»Schau mal, ich habe was zu essen für uns.« Sie hob den Korb etwas an.
»Ich habe keinen Hunger.«
»Das weiß ich, aber versuch’s doch wenigstens. Mir zuliebe.«
Fritz seufzte. Sie gingen ein Stück weiter Richtung Wirtschaftsgebäude; dort gab es einen kleinen Bach, eine Brücke mit Steinmauern spannte sich darüber. Leni stellte den Korb auf die Mauer. Sie packte aus.
Fritz’ Blick hing an den Brötchen. »Nimm schon«, forderte sie ihn leise auf.
»Nur, wenn du auch eins nimmst.«
»Aber das dritte ist für dich.«
Der Anflug eines Lächelns erhellte sein Gesicht. Sie setzten sich auf die kalten Mauersteine und teilten die Mahlzeit. Leni achtete darauf, dass Fritz mehr bekam, denn sie vermutete, dass er den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte.
Während sie aßen, fing es an zu schneien. Sanfte, dicke Flocken, die sich auf Schultern und Haare legten. Fritz schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken.
»Das tut gut«, murmelte er.
Leni sagte nichts. Sie wollte ihm etwas Zeit geben. Vielleicht wollte er mit ihr reden, vielleicht nicht.
»Wirst du ihn besuchen?«
»Wen?«, fragte sie gedankenverloren. Drüben im Gutshaus gingen die Lichter an. Der alte Paulsen schlich über den Hof Richtung Stallungen. Er ließ es sich nicht nehmen, morgens und abends nach den Pferden zu sehen.
»Matthias.«
»Weiß nicht«, gab sie zu. Natürlich wollte sie Matthias sehen. Auch seine Mutter Anne, die im Spätsommer und im Herbst so viel für die Familie getan hatte, bevor der letzte Schub ihrer Tuberkulose sie ans Bett fesselte. Seit Wochen dachte jeder, sie hätte nicht mehr lange zu leben.
»Ich könnte für dich zu ihnen gehen.«
»Aber du sprichst mit niemandem.«
Fritz zuckte mit den Schultern. »Er weiß, wie’s mir geht. Das macht’s einfacher.«
»Und ich? Ich weiß nichts davon, aber trotzdem sprichst du mit mir.«
»Du warst da. Du kannst es dir zumindest vorstellen, oder?«
Das stimmte. Sie hatte gesehen, wie die jungen Männer verheizt wurden. Und das geschah immer noch, obwohl damals, in den Wirren der letzten Kriegswochen, schon klar war, dass dieser Krieg verloren war und man sich eigentlich nur noch darum sorgen musste, mit heiler Haut dieser Hölle zu entkommen.
»Außerdem vermute ich mal, Mutter wird dich nicht weglassen, solange er noch da ist.«
Leni horchte auf. »Was weißt du darüber?«, fragte sie.
Fritz antwortete nicht. »Ist nur ein Angebot«, sagte er stattdessen.
»Friedrich Wittmann! Sag mir die Wahrheit, ich bitte dich!«
Er zuckte zusammen, als hätte sie ihn geohrfeigt, als sie die Stimme erhob.
»Was hat Mutter gesagt?«, fragte sie leise.
»Ach, nichts Besonderes.« Er kratzte den Rest Suppe aus der Düppe und aß den letzten Bissen seines Brötchens. »Abends reden unsere Eltern über alles Mögliche, wenn sie in der Bibliothek sitzen und denken, alles schläft.« Er lachte auf. »Ich schlafe nicht mehr. Das wissen sie aber nicht.«
»Von mir werden sie es schon nicht erfahren.« Leni seufzte. Ach, es war so kompliziert, dachte sie. Sie sollten doch voller Zuversicht in die Zukunft blicken können. Der Krieg war vorbei, und im Januar wurde die Nationalversammlung gewählt, erstmals waren auch Frauen wahlberechtigt. Leni war zwar noch nicht wahlberechtigt, doch sie las Zeitung und wusste ein bisschen davon, was in der Welt vor sich ging. Spürte die Veränderungen, die da draußen vonstattengingen.
Auf der anderen Seite dann das Leben im Dorf, ein Mikrokosmos, in dem die Zeit stehen geblieben war. Oder in dem versucht wurde, die Zeit zurückzudrehen. Alles sollte so sein wie vor dem Krieg.
»Unsere Mutter denkt, du wirst es nicht schaffen. Also die Schule und dann das Studium. Sie überlegt, mit wem sie dich verheiraten kann.«
»Oh«, machte Leni nur. Bisher hatte sie keinen Grund gehabt, an den Plänen ihrer Mutter zu zweifeln – erst die Cecilienschule in Bielefeld, danach stünde Leni endlich der Weg frei fürs Studium der Medizin. Dass Regine Wittmann mit diesem Vorschlag vielleicht ganz andere Absichten verfolgte, ließ ihr Herz schwer werden.
»Und bevor du fragst – nein, natürlich will sie dich nicht mit Matthias Krüger verloben. Sie denkt da wohl in größeren Dimensionen. Eher an einen Kaufmann oder einen Juristen. Ein Offizier wäre auch in ihrem Sinne. Tut mir leid, Schwesterchen.«
»Muss es nicht«, sagte sie automatisch. Dabei tat das ganz schön weh. Sie war rausgekommen, weil sie mit ihm reden wollte, ja. Aber darüber, was sie für ihn tun konnte. Und nun drehte sich alles um sie. Das wollte sie nicht.
»Und du? Haben sie für dich auch schon Pläne?«, wechselte sie daher das Thema.
Fritz schnaubte. »Als ob. Ich bin doch einfach nur ein Wrack. Die sind froh, wenn ich mich nicht umbringe.«
Sie saßen einen Moment lang schweigend nebeneinander. Fritz zog die Nase hoch, und Leni legte die Hand ganz behutsam auf seinen Oberschenkel. Er zuckte zusammen, schob sie aber nicht weg.
»Es tut mir so leid«, sagte sie leise.
Sie sagte nicht, was genau ihr leidtat. Der Krieg, an dem keiner die Schuld trug? Die Erlebnisse, die Fritz diese Schwermut und Alpträume bescherten? Dass sich alle nicht in das neue Leben eingefunden hatten, wie auch immer es aussah?
Sie brauchte auch gar nichts zu sagen, denn Fritz murmelte nach längerem Schweigen: »Muss es nicht.«
Der Schneefall wurde dichter und blieb auf dem gefrorenen Boden liegen. Leni wäre gerne wieder ins Haus gegangen, doch sie wollte Fritz auch nicht allein lassen. Sie fröstelte, umarmte den eigenen Oberkörper und stand auf, um ein wenig auf und ab zu hüpfen. Der linke Fuß, bei allem empfindlicher als der heile rechte, schmerzte schon wieder.
»Geh ruhig zurück ins Haus«, sagte er. »Die Kälte tut dir nicht gut.«
»Aber dir tut sie gut?«
Er zuckte mit den Schultern. »Die Bewegung tut gut. Macht ein bisschen müde.«
»Ist es für dich wirklich in Ordnung?«
Er stand auf und gab ihr die Düppe zurück. »Mach dir keine Sorgen, Leni.« Der Anflug eines Lächelns huschte über sein Gesicht. »Danke, dass du rausgekommen bist. Ist manchmal einsam, wenn ich so unterwegs bin.«
Sie verstand; selbst die Einsamkeit ertrug er besser als die Menschen im Gutshaus. Dabei wünschte er, es wäre umgekehrt.
Sie sah ihm nach, wie er im Schneegestöber verschwand. Seine Schritte wirkten ein bisschen leichter, der Kopf war nicht mehr ganz so tief gesenkt. Mehr hatte sie nicht für ihn tun können. Aber ja, für den Moment reichte es.
An diesem Abend lag Leni wach. Sie versuchte zu lesen, doch in ihrem Kopf war so ein Durcheinander, dass sie es aufgab. Sie stand auf und schlich nach unten.
Im Arbeitszimmer ihrer Mutter, das hinter dem Salon lag, brannte noch Licht.
Leni betrat den Salon. Dina, die alte und einzige Dogge, die ihr Vater derzeit noch besaß, kam aus dem Arbeitszimmer. Sie schnüffelte an Lenis Hand und sprang dann verbotenerweise im Dunkeln auf eines der Sofas und rollte sich ein. Verrätst du mich nicht, verrate ich dich nicht, schien ihr Blick zu sagen.
Leni vernahm die Stimmen ihrer Eltern.
Sie blieb vor der halb offenen Tür stehen.
»… müssen wir uns noch um Lisabeth kümmern«, hörte sie ihre Mutter sagen.
»Ach, Regine. Kannst du es nicht gut sein lassen?«
»Nein.«
Ihre Mutter klang entschlossen. Fast ein bisschen hart. Leni hörte Zeitungsrascheln. Sie konnte sich vorstellen, wie ihre Eltern zusammensaßen – ihre Mutter hinter dem Schreibtisch, die messinggerahmte Halbmondbrille auf der Nasenspitze oder an der ebenfalls messingfarbenen Kette um den Hals baumelnd, ihr Gesicht gerade so im Schatten der Schreibtischlampe, während ihre Hände Papiere ordneten oder sie Einträge im Kontobuch kontrollierte. Ihr Vater gemütlich in dem mit hellgrünem Samt bezogenen Ohrensessel in der gegenüberliegenden Zimmerecke, sich gelegentlich über den ergrauten Walrossbart streichend und seine Zeitung lesend. Beide hatten sich vielleicht aus der Küche noch einen Kaffee bringen lassen, bevor Hilda sich zur Ruhe begab, oder sie tranken einen Likör. Was in dieser mageren Zeit hieß, dass es Muckefuck oder Selbstgebrannten gab.
Machten sie das jeden Abend? Leni hatte bisher nie darüber nachgedacht, wie ihre Eltern die Abende verbrachten. Erst war sie ein Kind, das von einer Kinderfrau oder später von einem Dienstmädchen ins Bett gebracht wurde. Dann kam der Krieg, und nachdem ihr Vater eingezogen wurde, hatte ihre Mutter abends oft mit den Mädchen im Salon gesessen und strickte. Nach seiner Rückkehr hatten sie vielleicht eine alte Tradition wieder aufleben lassen, oder sie hatten eine neue gefunden.
Leni hörte ihren Vater seufzen. »Lisabeth ist zweiundzwanzig.«
»Alt genug zum Heiraten. Fast schon zu alt.«
»Na, erst mal freut sie sich darauf, bald wählen zu dürfen.«
Lenis Mutter schnaubte, als wäre das Wahlrecht für Frauen ein eher zweifelhaftes Unterfangen. »Was versteht sie schon von Politik.«
»Du willst also, dass sie heiratet?«
»Ja.«
»Will sie denn auch heiraten?«
»Rudolf, welches Mädchen möchte denn nicht heiraten nach all den Jahren, in denen es nicht mal einen Tanz gab, auf dem sich die Jugend hätte treffen können? Sie hat ihre besten Jahre im Krieg verschwendet.«
»Da kann sie nun wirklich nichts für«, bemerkte Lenis Vater. »Hast du schon jemanden im Sinn?«
»Leider nicht«, gab ihre Mutter zu. »Vielleicht ergibt sich ja etwas, solange sie in Bielefeld ist. Aber ewig kann sie dort nicht bleiben. Spätestens zu Ostern kommt sie zurück.«
»Wenn Leni zur Cecilienschule geht. Sie bekommt dann das Zimmer im Haus meines Bruders.« Ihr Vater klang bedrückt.
»Was denn? Hast du dir nicht immer gewünscht, dass dein Liebling das Abitur macht und studiert? Du weißt, was ich davon halte.«
Darauf sagte ihr Vater nichts mehr, und schon bald drehte sich das Gespräch ihrer Eltern um den Schweinepreis, um die Wurstfabrik und die Pläne für das kommende Jahr auf dem Gutshof.
Leni hatte genug gehört.
Ob ihre Mutter irgendwann aufhören würde, das Schicksal all ihrer Kinder bestimmen zu wollen?
Dezember 1918
»Du solltest ins Dorf mitkommen.«
Wie aus dem Nichts gewachsen stand Fritz auf einmal in Lenis Zimmer. Sie saß mit zwei Paar Socken über den Füßen und einem im Feuer gewärmten Ziegelstein unter den Fußsohlen dick eingemummelt am Schreibtisch und versuchte, sich auf den Stoff ihres Lateinbuchs zu konzentrieren.
»Wie schön, dass du anklopfst«, bemerkte sie verstimmt. Gerade hatte sie über einem lateinischen Satz gegrübelt. Verflixt, warum war diese Sprache nur so kompliziert?
»Du solltest wirklich mitkommen«, wiederholte er. »Schnell.«
»Fritz …«
»Anne Krüger. Jetzt stirbt sie.«
Leni verlor keine Zeit. Sie stand auf, griff nach ihrem Stock und folgte ihm nach unten.
»Ich hab Paulsen gesagt, er soll anspannen lassen. Bei dem Schneefall kommt ihr am ehesten mit dem Schlitten durch.«
Als sie aus der Tür traten, führte der Kutscher gerade die beiden Oldenburger Warmblüter über den Hof. Sie waren vor den alten Schlitten gespannt. Seit Leni ihren Bruder gestern Abend bei seiner Wanderung die Allee rauf- und runterbegleitet hatte, war der Schneefall immer heftiger geworden.
»Woher weißt du …?«
»Nur weil Mutter ihn fortschickt und du nicht mehr mit ihm redest, heißt das nicht, dass er allein ist.« Fritz sprach von Matthias. Sie fühlte sich schlecht. Merkte, dass sie zu wenig gegessen hatte, aber dafür blieb keine Zeit.
Zu ihrer Überraschung stieg Fritz nach ihr in den Schlitten. Der alte Paulsen kletterte auf den Kutschbock. »Hü!« Die beiden Oldenburger zogen an. In der einsetzenden Dunkelheit hörte man nur das Klirren des Geschirrs und das Schnauben der Pferde.
»Das musst du nicht allein machen.« Fritz drückte ihre Hand. Sie hatten sich die Pelzdecke bis zum Bauch hochgezogen, es war trotzdem eiskalt. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis sie das kleine Häuschen am anderen Ende des Dorfs erreichten.
Im Küchenfenster brannte Licht. Das von der winzigen Wohnstube war dunkel. Unterm Dach war ein Zimmer erleuchtet. Leni vermutete, dass es Annes Schlafzimmer war.
Der alte Paulsen ließ sie aussteigen und machte sich direkt auf den Heimweg, er tippte nur kurz an die Mütze, dann war er weg. Leni folgte ihrem Bruder zur Haustür. Als die Tür aufging, erschrak sie.
Es war drei Tage her, dass sie Matthias das letzte Mal gesehen hatte. Er stand da in der Tür und musterte die beiden Besucher fast feindselig. Sie glaubte zu spüren, dass seine Wut sich vor allem gegen sie richtete.
»Matthias …«
»Kommt rein«, knurrte er. »Sie will dich noch mal sehen, Leni. Warum auch immer.«
Sie folgte ihm die schmale Stiege hinauf zu den beiden Schlafkammern unterm Dach.
»Matti, bist du das?« Die Stimme einer alten Frau. Krächzend. Ein Husten folgte, der so gefährlich rasselte und japste, als bekäme Anne keine Luft mehr.
»Mama, Leni ist hier.«
Leni, nicht Lene. Aber das hatte sie vermutlich verdient, weil sie es stillschweigend hingenommen hatte, dass ihre Mutter die beiden fortgeschickt hatte. Oder, was noch schlimmer wog, sie sich seither nicht bei Matthias gemeldet hatte.
»Leni, mein Kind.« Anne Krüger richtete sich mühsam auf. Ihre Hände waren bleiche Klauen, die eine schloss sich um ein Taschentuch, auf dem Leni etwas Blut sah.
Sie trat vorsichtig näher. Die Decke in dieser Kammer war niedrig, selbst Leni musste den Kopf einziehen, als sie unter einem der dunklen Deckenbalken durchging. »Ich bin hier.« Sie setzte sich auf die Bettkante.
Annes Augen strahlten. Und dennoch wirkte sie müde, völlig verzehrt von der Tuberkulose, an der sie bereits kurz nach Kriegsausbruch erkrankt war. Zwischenzeitlich hatte sie sich erholt, aber als sie sich im Herbst um Lenis Schwester Sophie und deren neugeborenes Baby kümmerte, hatte dies sie das letzte bisschen Kraft gekostet, das ihr geblieben war.
Mit der freien Hand griff Anne nach Leni. Sie hielt die eisigen Finger fest umklammert. Für Leni war Anne immer mehr gewesen als Matthias’ Mutter. Sie war früher, als Leni im Osnabrücker Krankenhaus lag, wo sie wiederholt an ihrem verkrüppelten Fuß operiert worden war, wie eine zweite Mutter für sie gewesen. Anne hatte Leni stets getröstet, ihr abends eine warme Milch mit Honig gebracht und ihr erlaubt, das Licht länger brennen zu lassen, wenn sie noch lesen wollte oder vor Schmerzen nicht einschlafen konnte. Sie hatte so viel für Leni getan. Immer.
Und nun war Annes Leben fast vorbei. Leni sah es an ihrem Gesicht. Das bleiche Dreieck zwischen Mund und Nase, das sie letzten Herbst in dem behelfsmäßigen Lazarett an der Westfront so oft beobachtet hatte, wo sie die jungen, sterbenden Soldaten pflegte, zeichnete sich nun auch auf Annes Antlitz ab.
»Ach, Leni.« Anne atmete tief ein. Ihr Atem stockte, sie schloss die Augen. Leni fürchtete kurz, das Leben sei in diesem Augenblick aus ihr gewichen, doch sie fing sich, und als sie ausatmete, glaubte Leni den Anflug eines Lächelns auf ihrem Gesicht zu erkennen. »Du passt auf ihn auf, nicht wahr?«
»Mama.« Matthias stand am Fußende des Betts. Seine Hände umklammerten den Pfosten, dass die Knöchel weiß hervortraten.
»Geh raus, Matti«, murmelte Anne. »Das ist eine Sache zwischen Leni und mir.«
Matthias starrte Leni finster an, als könnte er sie mit Blicken aus dem Zimmer jagen. Doch sie blieb sitzen, wandte sich sogar von ihm ab und seiner Mutter zu.
Er schlug mit einer Faust auf das Fußteil des Betts, dass es erbebte. Anne zuckte zusammen. Doch dann hörten sie, wie er aus der Kammer ging und die Treppe hinunterpolterte.
»Du gibst auf ihn acht, nicht wahr?«, flüsterte Anne.
»Natürlich«, versicherte Leni ihr.
»Ihr sollt nicht streiten.«
»Das haben wir nicht.«
Anne lächelte. »Ich weiß. Er sieht nicht, was du brauchst. Das Studium. Unabhängigkeit.«
Wieder hustete sie. Leni blickte sich suchend um. Auf dem kleinen Nachttisch stand ein Krug Wasser neben einem Glas. Sie goss Anne etwas ein, half ihr, sich aufzusetzen und einen Schluck zu trinken.
»Besser?«, fragte sie mitfühlend.
»Besser«, log Anne. Die beiden Frauen lächelten sich an.
»Ich wollte dich trotzdem bitten …« Annes Stimme versagte. Leni beugte sich dicht zu ihr herunter, doch mit einer unwilligen Handbewegung, von der Leni nicht gedacht hätte, dass Anne dazu noch in der Lage wäre, scheuchte sie Lenis Kopf weg. »Nicht.«
Natürlich. Anne hatte immer noch Tuberkulose. Leni könnte sich bei ihr anstecken. Sie spürte, wie ihr ein kalter Schauer über den Rücken rann.
»Also passt du auf ihn auf?«
»Ich passe auf ihn auf«, versprach Leni. Sie drückte Annes Hand. Doch die zog die Hand weg.
»Nein«, sagte sie heftig. »Versprich es mir, Leni. Du weißt, wie er ist, seit er aus dem Krieg zurück ist.«
Fast hätte Leni ihr erklärt, dass jeder sich durch den Krieg verändert hatte. Ihr Bruder Fritz, der tagelang die Allee rauf und runterlief wie ein Tiger in seinem Gehege im Zoologischen Garten. Ihr Vater, der sich tagsüber in den Wintergarten zurückzog und Dinas Ohren kraulte. Der junge Paulsen, dem ein Arm fehlte und der den ganzen Tag bei seinem Vater hockte, weil er sich nutzlos fühlte. Sie alle hatte der Krieg gezeichnet. Sie alle suchten einen Platz in der Welt.
»Verliere ihn nicht aus den Augen, ja?«
»Ich versuch’s.« Mehr konnte Leni nicht versprechen. Denn wie sollte das gehen? Einerseits, wenn es nach ihrer Mutter ging, sollte sie sich von Matthias fernhalten. Andererseits bat Anne sie, auf ihn zu achten.
Aber viel wichtiger war doch – und danach fragte sie niemand: Was wollte Leni? Konnte es einen Weg geben, mit dem sie beiden Frauen gerecht wurde – und sich selbst?
Offensichtlich reichte Lenis Versprechen ihr nun, denn Anne schloss die Augen und atmete ganz flach. Leni blieb bei ihr sitzen. Irgendwann fragte sie: »Soll ich Matthias holen? Möchtest du mit ihm allein sein?«
Anne nickte, ganz leicht nur. Leni lief nach unten. Matthias und Fritz saßen in der Küche.
Matthias stand auf, als sie in der Tür auftauchte. »Ist sie …?«
Leni schüttelte knapp den Kopf. Er schob sich an ihr vorbei. Sie wollte ihn festhalten, mit ihm reden. Aber dafür war später Zeit. Jetzt sollte er bei seiner Mutter sitzen, solange es noch ging.
Fritz schob ihr sein Pintchen zu, goss aus einem Tonkrug nach. Sie setzte sich zu ihm und drehte das kleine Glas hin und her, starrte auf ihre Hände.
»Bleibst du hier?«, fragte sie.
»Solange du bleibst, ja.«
Sie warteten. Von oben war nichts zu hören. Fritz stand auf, er suchte etwas zu essen. Fand ein Brot, Butter, ein bisschen Käse. Er bereitete einen Teller mit Schnittchen zu und fand in der kleinen Vorratskammer auch ein Glas mit eingemachten Gurken.
»Darfst du das?«, fragte Leni ihn. »Einfach an seine Vorräte gehen?«
»Was meinst du, woher er die hat?«
Darüber hatte sich Leni bisher keine Gedanken gemacht.
»Ich habe ihnen was gebracht. Kommt alles aus unserer Speisekammer, was sie hier haben.«
»Du bequatschst die Mamsell?«
Er grinste schief. Es war das erste Mal, dass sie seit seiner Rückkehr wieder ein bisschen was vom »alten« Fritz in ihm sah.
»Verpetz mich nur nicht bei unserer Mutter.«
»Na, sicher nicht.«
Sie hatte keinen Hunger, aber Fritz überredete sie, zumindest ein halbes Brot zu essen. Leni hätte sich lieber an den Selbstgebrannten gehalten, und das Brot schmeckte muffig; sie hatte es so satt, dieses elende Kriegsbrot, das mit Rüben und Kartoffeln gestreckt wurde!
Es war schon fast Mitternacht, als sie Schritte auf der Treppe hörten. Leni stand auf. Matthias blieb im Dunkeln des Flurs stehen, und sie ging zu ihm. Er sah sie nur an, sagte keinen Ton.
Leni nahm ihn in den Arm. Sie wusste nicht, wie sie sonst seinen Schmerz hätte lindern können, und in diesem Moment, spürte sie, war es für ihn das Einzige, was zählte. Ihr Trost. Ihre Umarmung. Irgendeine Umarmung. Er sollte nicht das Gefühl haben, dass er jetzt ganz alleine war auf der Welt.
Fritz stand auf und zog Mantel und Stiefel an. »Dann geh ich mal den Pastor holen«, sagte er und blieb neben Matthias stehen. Er legte eine Hand auf Matthias’ Unterarm. »Es tut mir sehr leid.«
»Danke.« Matthias’ Stimme klang seltsam rau. Er räusperte sich und machte sich aus Lenis Umarmung los, als wäre sie ihm lästig. Sie stand mit hängenden Armen im Flur, während ihr Bruder das Haus verließ und Matthias in die Küche ging.
Sie wusste, was nun geschah.
»Wer ist euer erster Nachbar?«, fragte sie. Matthias blickte nicht auf. Er kippte einen Schnaps nach dem nächsten in das Pintchen vor sich und genauso schnell in sich hinein, zwei, drei Schnäpse. Leni trat hinzu und nahm ihm den Krug aus der Hand.
»Weiß nicht«, murmelte er.
Sie wusste, er stand unter Schock. So war es ihr damals auch ergangen, als ihre Schwester Sophie gestorben war.
»Ich kenne hier doch keinen.«
Sie hoffte, ihr Bruder würde sich darum kümmern oder zumindest die Aufgaben des ersten Nachbarn übernehmen. Die Ansager bestellen, die von Haus zu Haus gingen und den Tod verkündeten, außerdem die Sargträger. Den Tischler holen, damit sie gemeinsam Annes Leichnam einsargen konnten.
Matthias stand auf. Er schlich zurück zur Treppe. Bis zur Beerdigung blieben die Angehörigen im Sterbezimmer.
Leni räumte in der Küche auf und wartete auf Fritz’ Rückkehr. Sie wäre gern zu Matthias gegangen und hätte ihn getröstet. Aber der Tod machte sie immer noch so hilflos. Als wäre sie ihm noch nie begegnet.
Sie ging zur Treppe. Dann stieg sie hinauf, eine Stufe nach der nächsten.
Als sie in der Schlafkammer stand, wo Matthias neben dem Bett saß und die langsam kühler werdende Hand seiner Mutter hielt, knurrte er: »Hau ab.«
Doch Leni setzte sich auf den Stuhl neben der Tür. Und dort blieb sie sitzen, niemand konnte sie vertreiben. Nicht Matthias mit seinen wütenden, finsteren Blicken. Nicht Fritz, der sie überreden wollte, dass sie heimging, weil sie nicht hierbleiben musste. Auch nicht ihre Mutter, die am zweiten Abend auftauchte und ihr ins Gewissen redete, dass sie sich endlich wie eine Wittmann verhalten sollte und nicht wie ein dahergelaufenes Mädchen aus der Gosse. Ihre Mutter gab sich nicht mal Mühe, den Anschein zu erwecken, dass der Tod von Matthias’ Mutter sie in irgendeiner Weise rührte.