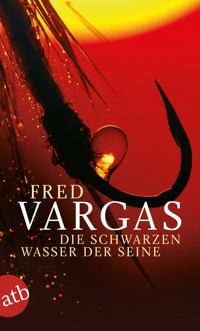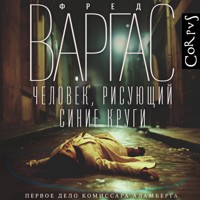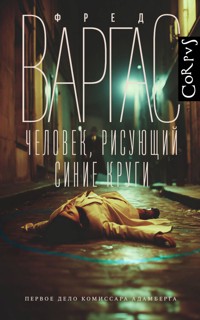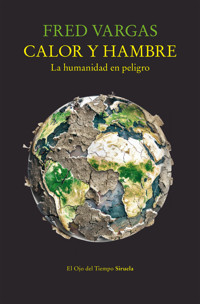10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Adamsberg ermittelt
- Sprache: Deutsch
Zwei Tote, die jeder für Drogenopfer hält. Nur Adamsberg ist sicher – hier treibt ein Serienmörder sein Unwesen ...
Doppelmord an der Porte de la Chapelle in Paris. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Kleinkriminelle, denen mit einem Skalpell die Kehle durchgeschnitten wurde. Weil die Gegend für ihre Drogenszene bekannt ist, hat das Rauschgiftdezernat den Fall an sich genommen. Doch die Kollegen haben ihre Rechnung ohne Adamsberg gemacht. Was keiner außer ihm gesehen hat: Die Toten haben Erde unter den Fingernägeln, die von dem Friedhof stammt, auf dem kürzlich ein Grab unerlaubt aufgebrochen wurde. Die nachfolgenden Ermittlungen konfrontieren Adamsberg mit seiner eigenen Vergangenheit. Doch ist er schnell genug, um den nächsten Morden zuvorzukommen?
Wenn Ihnen die Krimis um Kommissar Adamsberg gefallen, lesen Sie auch die Evangelisten-Reihe unserer internationalen Bestseller-Autorin Fred Vargas!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alle unabhängig voneinander lesbaren Bände der Kommissar-Adamsberg-Reihe
1. Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord
2. Bei Einbruch der Nacht
3. Fliehe weit und schnell
4. Der vierzehnte Stein
5. Die dritte Jungfrau
6. Der verbotene Ort
7. Die Nacht des Zorns
8. Das barmherzige Fallbeil
9. Der Zorn der Einsiedlerin
10. Jenseits des Grabes
Autorin
Fred Vargas, geboren 1957, ist ausgebildete Archäologin und hat Geschichte studiert. Sie ist heute die bedeutendste französische Kriminalautorin mit internationalem Renommee. 2004 erhielt sie für »Fliehe weit und schnell« den Deutschen Krimipreis, 2012 den Europäischen Krimipreis für ihr Gesamtwerk und 2016 den Deutschen Krimipreis in der Kategorie International für »Das barmherzige Fallbeil«.
Fred Vargas
Die dritte Jungfrau
Kommissar Adamsberg ermittelt
Aus dem Französischen von Julia Schoch
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Dans les bois éternels« bei Éditions Viviane Hamy, Paris.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich
geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
1. Auflage
© Copyright der Originalausgabe Fred Vargas und Éditions Viviane Hamy, Paris, 2006.
Taschenbuchausgabe 2024 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe
© Deutsche Erstveröffentlichung Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2007, 2008.
Übersetzung: Julia Schoch
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
KW · Herstellung: sam
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31676-1V002
www.blanvalet.de
1
Wenn er die Gardine seines Fensters mit einer Wäscheklammer feststeckte, konnte Lucio den neuen Nachbarn besser beobachten. Es war ein kleiner, dunkelhaariger Kerl, der eine Steinmauer ohne Lot hochzog, noch dazu mit freiem Oberkörper im kühlen Märzwind. Nachdem er eine Stunde auf der Lauer gelegen hatte, schüttelte Lucio kurz den Kopf, wie eine Eidechse ihrem regungslosen Mittagsschlaf ein Ende setzt, und löste seine erloschene Zigarette von den Lippen.
»Der da«, sagte er und gab damit schließlich seine Diagnose ab, »kein Lot im Kopf und keins in den Händen. Der folgt seinem eigenen Kompass. Gerad wie’s ihm passt.«
»Na, dann lass ihn doch«, sagte seine Tochter ohne große Überzeugung.
»Ich weiß, was ich zu tun habe, Maria.«
»Vor allem nervst du gern alle Welt mit deinen Geschichten.«
Der Vater schnalzte mit der Zunge.
»Du würdest anders reden, wenn du an Schlaflosigkeit leiden würdest. Neulich Nacht hab ich sie gesehen, so wie ich dich jetzt sehe.«
»Ja, das hast du mir erzählt.«
»Sie ging an den Fenstern im Obergeschoss vorbei, gespenstisch langsam.«
»Ja«, wiederholte Maria teilnahmslos.
Auf seinen Stock gestützt, war der alte Mann aufgestanden.
»Man hätte meinen können, sie warte auf die Ankunft des Neuen, sie hielte sich für ihre Beute bereit. Für ihn«, fügte er hinzu und deutete mit dem Kinn auf das Fenster.
»Wenn du dem davon erzählst«, sagte Maria, »wird es ihm zum einen Ohr rein- und zum andern wieder rausgehen.«
»Was er damit anfängt, ist seine Sache. Gib mir eine Zigarette, ich mach mich auf den Weg.«
Maria steckte ihrem Vater die Zigarette direkt zwischen die Lippen und zündete sie an.
»Herrgott, Maria, mach den Filter ab.«
Maria gehorchte und half ihrem Vater in den Mantel. Dann schob sie ein kleines Radio in seine Tasche, aus dem knisternd kaum hörbare Worte drangen. Der Alte trug es immer bei sich.
»Sei nicht zu grob zu dem Nachbarn«, sagte sie, während sie ihm den Schal richtete.
»Der Nachbar hat schon Schlimmeres erlebt, glaub mir.«
Adamsberg hatte unter dem wachsamen Auge des Alten von gegenüber unbekümmert gearbeitet und sich immer wieder gefragt, wann er ihn wohl leibhaftig prüfen käme. Er sah, wie er mit wiegendem Gang den kleinen Garten durchquerte, groß und würdevoll, ein schönes, von Falten gefurchtes Gesicht, weißes, volles Haar. Adamsberg wollte ihm schon die Hand geben, als er merkte, dass der Mann keinen rechten Unterarm mehr hatte. Er hob seine Maurerkelle als Willkommensgruß und blickte ihn ruhig und ausdruckslos an.
»Ich kann Ihnen mein Lot borgen«, sagte der Alte höflich.
»Ich komme schon zurecht«, antwortete Adamsberg und passte einen neuen Mauerstein ein. »Bei uns hat man die Mauern immer nach Augenmaß hochgezogen und sie stehen noch. Schief zwar, aber sie stehen.«
»Sind Sie Maurer?«
»Nein, ich bin Bulle. Polizeikommissar.«
Der alte Mann lehnte seinen Stock gegen die neue Mauer und knöpfte seine Strickjacke bis zum Kinn zu, das gab ihm Zeit, die Information zu verarbeiten.
»Fahnden Sie nach Rauschgift? Solche Sachen?«
»Leichen. Ich bin bei der Mordbrigade.«
»Gut«, sagte der Alte nach einem leichten Schock. »Ich war beim Parkett.«
Er zwinkerte Adamsberg zu.
»Nicht beim Börsenparkett natürlich, nein, ich hab Parkettfußböden verkauft.«
Wohl ein Spaßvogel gewesen, früher, dachte Adamsberg, während er seinem neuen Nachbarn verständnisvoll zulächelte, der sich offenbar ohne Zutun anderer über eine Kleinigkeit amüsieren konnte. Ein Spieler, eine Frohnatur, aber schwarze Augen, die einen unverhohlen musterten.
»Eiche, Buche, Tannenholz. Im Bedarfsfall wissen Sie, an wen Sie sich wenden können. In Ihrem Haus gibt’s nur Terrakottafliesen.«
»Ja.«
»Das ist nicht so warm wie Parkett. Ich heiße Velasco, Lucio Velasco Paz. Firma Velasco Paz & Tochter.«
Lucio Velasco lächelte breit, ließ dabei aber Adamsbergs Gesicht nicht aus den Augen, das er Millimeter für Millimeter genau inspizierte. Dieser Alte druckste doch herum, der hatte ihm doch irgendwas zu sagen.
»Maria hat die Firma übernommen. Sie ist nicht auf den Kopf gefallen, erzählen Sie ihr also bloß keine Albernheiten, das mag sie gar nicht.«
»Was denn für Albernheiten?«
»Albernheiten über Gespenster zum Beispiel«, sagte der Mann und kniff seine schwarzen Augen zusammen.
»Keine Sorge, ich kenne keine Albernheiten über Gespenster.«
»Das sagt sich so und dann kennt man eines Tages doch welche.«
»Mag sein. Ihr Radio ist nicht richtig eingestellt. Soll ich das für Sie machen?«
»Wozu?«
»Damit Sie die Sendungen hören können.«
»Nein, hombre. Deren Quatsch will ich nicht hören. In meinem Alter hat man das Recht erworben, sich nicht mehr alles gefallen zu lassen.«
»Natürlich«, sagte Adamsberg.
Wenn der Nachbar unbedingt ein Radio ohne Ton in seiner Tasche herumschleppen und ihn hombre nennen wollte, bitte schön, es stand ihm frei.
Der Alte ließ wieder ein Weilchen vergehen, sah prüfend zu, wie Adamsberg seine Mauersteine aneinandersetzte.
»Sind Sie zufrieden mit diesem Haus?«
»Sehr.«
Lucio machte einen kaum hörbaren Scherz und fing laut an zu lachen. Adamsberg lächelte freundlich. Es lag etwas Jungenhaftes in seinem Lachen, während seine gesamte übrige Körperhaltung darauf hinzudeuten schien, dass er für das Schicksal der Menschen auf dieser Erde mehr oder weniger verantwortlich war.
»Hundertfünfzig Quadratmeter«, fuhr er fort. »Ein Garten, ein Kamin, ein Keller, ein Holzschuppen. So was gibt’s in Paris nicht mehr. Haben Sie sich nicht gefragt, wieso Sie es für ein Butterbrot gekriegt haben?«
»Weil es zu alt ist, nehme ich an, zu heruntergekommen.«
»Und Sie haben sich nicht gefragt, wieso es nie abgerissen wurde?«
»Es steht am Ende einer Gasse, es stört niemanden.«
»Trotzdem, hombre. Seit sechs Jahren kein einziger Käufer. Hat Sie das nicht stutzig gemacht?«
»Also eigentlich, Monsieur Velasco, macht mich kaum etwas stutzig.«
Adamsberg strich den überstehenden Mörtel mit der Kelle ab.
»Aber nehmen Sie mal an, es machte Sie stutzig«, beharrte der Alte. »Nehmen Sie mal an, Sie würden sich fragen, wieso das Haus nie einen Abnehmer fand.«
»Weil die Toilette draußen ist. Das ertragen die Leute nicht mehr.«
»Sie hätten eine Wand hochziehen können für einen Anbau, genau wie Sie es tun.«
»Ich tue es nicht für mich. Es ist für meine Frau und meinen Sohn.«
»Mein Gott, Sie werden doch nicht etwa eine Frau hier drin wohnen lassen?«
»Ich glaube nicht. Sie werden nur ab und zu vorbeikommen.«
»Aber sie? Sie wird doch hier nicht etwa schlafen, Ihre Frau?«
Adamsberg krauste die Stirn, während die Hand des Alten sich auf seinen Arm legte und seine Aufmerksamkeit suchte.
»Glauben Sie nicht, Sie seien stärker als andere«, sagte der alte Mann mit gesenkter Stimme. »Verkaufen Sie. Das sind Dinge, die wir nicht begreifen. Das geht über unseren Horizont.«
»Was?«
Lucio bewegte die Lippen, kaute auf seiner erloschenen Zigarette herum.
»Sehen Sie das?«, sagte er und hob seinen rechten Arm.
»Ja«, sagte Adamsberg ehrfurchtsvoll.
»Hab ich verloren, als ich neun Jahre alt war, im Bürgerkrieg.«
»Ja.«
»Und manchmal juckt es mich da. Es juckt mich auf meinem fehlenden Arm, neunundsechzig Jahre später. An einer ganz bestimmten Stelle, immer an derselben«, sagte der Alte und zeigte auf einen Punkt in der Luft. »Meine Mutter wusste, warum: Das ist der Spinnenbiss. Als ich meinen Arm verlor, kratzte ich ihn gerade und war noch nicht fertig. Darum juckt er mich noch immer.«
»Ja natürlich«, sagte Adamsberg und rührte lautlos in seinem Mörtel.
»Weil der Biss noch nicht aufgehört hatte zu leben, verstehen Sie? Er fordert, was ihm zusteht, er rächt sich. Erinnert Sie das nicht an irgendwas?«
»An die Sterne«, überlegte Adamsberg. »Sie leuchten noch, während sie schon längst erloschen sind.«
»Wenn Sie so wollen«, gab der Alte überrascht zu. »Oder ans Gefühl: Nehmen Sie einen Mann, der noch immer ein Mädchen liebt, oder umgekehrt, während doch alles längst kaputt ist, wissen Sie, was ich meine?«
»Ja.«
»Und warum liebt der Mann noch immer das Mädchen, oder umgekehrt? Wie erklärt sich das?«
»Ich weiß nicht«, sagte Adamsberg geduldig.
Zwischen zwei Windstößen wärmte die blasse Märzsonne ihm sanft den Rücken, er fühlte sich wohl, wie er hier in diesem verwilderten Garten eine Mauer hochzog. Lucio Velasco Paz mochte auf ihn einreden, soviel er wollte, es störte ihn nicht.
»Ganz einfach, weil das Gefühl noch nicht aufgehört hat zu leben. So was existiert außerhalb von uns. Man muss warten, bis es zu Ende geht, man muss an der Sache herumkratzen bis zuletzt. Und wenn man stirbt, bevor man aufgehört hat zu leben, ist es genauso. Die Ermordeten geistern weiter im Nichts herum, eine Brut, die uns unablässig juckt.«
»Spinnenbisse«, sagte Adamsberg und schloss so den Kreis.
»Gespenster«, sagte der Alte ernst. »Verstehen Sie jetzt, warum niemand Ihr Haus wollte? Weil es in ihm spukt, hombre.«
Adamsberg machte den Zementkübel sauber und rieb sich die Hände.
»Warum nicht?«, sagte er. »Das stört mich nicht. Ich bin’s gewohnt, dass ich manches nicht begreife.«
Lucio hob das Kinn und betrachtete Adamsberg ein wenig traurig.
»Dich, hombre, wird sie sich greifen, wenn du hier große Töne spuckst. Was glaubst du denn? Dass du stärker bist als sie?«
»Wieso sie? Ist es eine Frau?«
»Eine Gespensterfrau aus dem vorvorvorigen Jahrhundert, aus der Zeit vor der Revolution. Eine alte Übeltäterin, ein Schatten.«
Der Kommissar strich langsam über die raue Oberfläche der Mauersteine.
»Ach ja?«, sagte er plötzlich nachdenklich. »Ein Schatten?«
2
Adamsberg, noch nicht recht vertraut mit dem Ort, bereitete in der geräumigen Wohnküche Kaffee. Das Licht, das durch die in kleine Vierecke aufgeteilten Fenster fiel, erhellte das matte Rot des alten Fliesenbodens, auch der war aus dem vorvorvorigen Jahrhundert. Ein Geruch nach Feuchtigkeit, verbranntem Holz und neuem Wachstuch, etwas, das er mit seinem Haus in den Bergen verband, wenn er genau überlegte. Er stellte zwei ungleiche Tassen auf den Tisch, da, wo die Sonne ein Rechteck hinwarf. Sein Nachbar hatte sich sehr aufrecht hingesetzt und stützte seine einzige Hand aufs Knie. Eine breite Hand, die zwischen Daumen und Zeigefinger einen Ochsen hätte erdrosseln können; sie schien doppelt so groß geworden zu sein, um die fehlende andere zu kompensieren.
»Hätten Sie nicht irgendein Tröpfchen, um den Kaffee runterzuspülen? Nur so eine Frage.«
Lucio warf einen misstrauischen Blick in Richtung Garten, während Adamsberg in seinen noch übereinandergestapelten Kartons nach etwas Alkoholischem suchte.
»Ist Ihre Tochter dagegen?«, fragte er.
»Sie bestärkt mich nicht gerade.«
»Das hier? Was ist das?«, fragte Adamsberg und zog eine Flasche aus einer Kiste.
»Ein Sauternes«, meinte der Alte mit zusammengekniffenen Augen, gleich einem Ornithologen, der aus der Ferne einen Vogel bestimmt. »Es ist etwas früh für einen weißen Bordeaux.«
»Was anderes hab ich nicht.«
»Es wird schon gehen«, entschied der Alte.
Adamsberg schenkte ihm ein und setzte sich neben ihn, mit dem Rücken zu dem Sonnenviereck.
»Was also wissen Sie?«, fragte Lucio.
»Dass die vormalige Besitzerin sich in dem Zimmer oben erhängt hat«, sagte Adamsberg und deutete mit dem Finger zur Decke. »Deshalb wollte niemand das Haus. Mir ist das egal.«
»Weil Sie schon eine Menge Erhängter gesehen haben?«
»Habe ich, allerdings. Aber die Toten haben mir nie Schwierigkeiten gemacht. Nur ihre Mörder.«
»Wir sprechen hier nicht von richtigen Toten, hombre, wir sprechen von anderen, von denen, die nicht gehen. Die hier ist nie fortgegangen.«
»Die Erhängte?«
»Die Erhängte ist fort«, erklärte Lucio und goss sich einen ordentlichen Schluck hinter, wie um das Ereignis zu begrüßen. »Haben Sie gewusst, warum sie sich umgebracht hat?«
»Nein.«
»Das Haus hat sie in den Wahnsinn getrieben. Alle Frauen, die hier wohnen, werden von dem Schatten zermürbt. Und dann sterben sie dran.«
»Von dem Schatten?«
»Dem Gespenst aus dem Kloster. Deshalb heißt diese Sackgasse auch Ruelle aux Mouettes.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Adamsberg und schenkte den Kaffee ein.
»Im vorvorvorigen Jahrhundert stand hier mal ein altes Frauenkloster. Das waren Ordensschwestern, die nicht sprechen durften.«
»Ein Schweigeorden.«
»Genau. Man sagte Rue aux Muettes, die Straße der Stummen. Und dann ist schließlich ›Mouettes‹, Möwen, daraus geworden.«
»Es hat also nichts mit den Vögeln zu tun?«, sagte Adamsberg enttäuscht.
»Nein, gemeint sind die Nonnen. Aber ›Muettes‹ lässt sich schwer aussprechen. Muettes«, fügte Lucio hinzu, indem er sich besondere Mühe gab.
»Muettes«, wiederholte Adamsberg langsam.
»Sehen Sie, wie schwer es ist. Zu jener Zeit hat eine dieser Stummen das Haus hier besudelt, müssen Sie wissen. War, scheint’s, mit dem Teufel im Bunde. Aber nun ja, dafür gibt’s keine Beweise.«
»Und wofür haben Sie Beweise, Monsieur Velasco?«, fragte Adamsberg lächelnd.
»Sie können mich Lucio nennen. Beweise hat man genug. Es hat damals einen Prozess gegeben, im Jahre 1771, das Kloster ist danach aufgegeben und das Haus gereinigt worden. Die Stumme ließ sich heilige Clarisse nennen. Für eine Zeremonie und Geld versprach sie alten Frauen, sie kämen ins Paradies. Nur wussten die Alten nicht, dass die Reise dahin sofort losging. Wenn sie mit ihren prall gefüllten Geldbeuteln ankamen, schnitt sie ihnen die Kehle durch. Sie hat sieben umgebracht. Sieben, hombre. Eines Nachts jedoch wurde ihr Elan gedrosselt.«
Lucio brach in sein jungenhaftes Lachen aus, dann fasste er sich wieder.
»Mit diesen bösen Geistern sollte man nicht spaßen«, sagte er. »Da, mein Biss juckt schon wieder, das ist die Strafe.«
Adamsberg sah zu, wie er seine Finger in der Luft bewegte, und wartete in aller Ruhe das Weitere ab.
»Verschafft es Ihnen Erleichterung, wenn Sie sich kratzen?«
»Einen Moment lang, dann fängt es wieder an. Am Abend des 3. Januar 1771 kam eine Alte zu Clarisse, um sich das Paradies zu kaufen. Aber ihr Sohn, misstrauisch und gewinnsüchtig, begleitete sie. Er war Gerber, er hat die Heilige umgebracht. Einfach so«, zeigte Lucio und drückte seine Faust auf den Tisch. »Er hat sie unter seinen Riesenhänden plattgemacht. Konnten Sie mir folgen?«
»Ja.«
»Sonst kann ich auch noch mal anfangen.«
»Nein, Lucio. Fahren Sie fort.«
»Doch diese verdammte Clarisse ist nie richtig fortgegangen. Weil sie erst sechsundzwanzig Jahre alt war, verstehen Sie. Und alle Frauen, die nach ihr hier gewohnt haben, sind mit den Füßen voran wieder rausgekommen, gewaltsamer Tod. Vor Madelaine – das ist die Erhängte – war da eine gewisse Madame Jeunet, in den sechziger Jahren. Sie ist grundlos aus dem obersten Fenster gestürzt. Und vor der Jeunet eine Marie-Louise, die man mit dem Kopf im Kohlenofen gefunden hat, im Krieg. Mein Vater kannte sie beide. Nichts als Ärger.«
Die beiden Männer nickten, Lucio Velasco voller Ernst, Adamsberg mit einem gewissen Vergnügen. Der Kommissar wollte den Alten nicht verdrießen. Im Grunde sagte die amüsante Spukgeschichte ihnen beiden sehr zu, und als Kenner zogen sie sie genauso in die Länge, wie man dem Zucker im Kaffee Zeit zum Auflösen gibt. Die Schandtaten der heiligen Clarisse bereicherten Lucios Leben und lenkten Adamsberg für eine Weile von den banalen Morden ab, die er am Hals hatte. Dieses weibliche Gespenst war doch weitaus poetischer als die beiden aufgeschlitzten Burschen vergangene Woche an der Porte de la Chapelle. Fast hätte er Lucio von seinem eigenen Fall erzählt, schien der alte Spanier doch eine sichere Meinung zu allem zu haben. Er mochte diesen einhändigen, weisen Spaßvogel, wäre nur nicht sein Radio gewesen, das unablässig in seiner Tasche vor sich hin summte. Auf ein Zeichen von Lucio schenkte er ihm nach.
»Wenn alle Ermordeten im Nichts herumgeistern müssen«, fuhr Adamsberg fort, »wie viele Gespenster gibt es dann in meinem Haus? Die heilige Clarisse plus ihre sieben Opfer? Plus die beiden Frauen, die Ihr Vater gekannt hat, plus Madelaine? Elf? Oder noch mehr?«
»Nur Clarisse«, versicherte Lucio. »Ihre Opfer waren zu alt, die sind nie zurückgekehrt. Es sei denn, sie halten sich in ihren eigenen Häusern auf, das ist durchaus möglich.«
»Ja.«
»Bei den drei anderen Frauen liegen die Dinge anders. Sie sind nicht ermordet worden, sie waren besessen. Während die heilige Clarisse ihr Leben noch nicht zu Ende gelebt hatte, als der Gerber sie unter seinen Fäusten zermalmte. Begreifen Sie jetzt, warum man das Haus nie abreißen wollte? Weil Clarisse sich einfach eine andere Bleibe gesucht hätte. Bei mir zum Beispiel. Und wir alle hier in der Gegend ziehen es vor zu wissen, wo sie sich verborgen hält.«
»Hier.«
Lucio bestätigte mit einem Zwinkern.
»Und solange man seinen Fuß nicht hierhersetzt, richtet sie keinen Schaden an.«
»Sie ist gewissermaßen eine Stubenhockerin.«
»Sie geht nicht mal in den Garten. Sie wartet da oben auf ihre Opfer, auf Ihrem Dachboden. Und jetzt hat sie wieder Gesellschaft.«
»Mich.«
»Sie«, bestätigte Lucio. »Aber Sie sind ein Mann, sie wird Sie nicht allzu sehr schikanieren. Sie treibt nur Frauen in den Wahnsinn. Bringen Sie Ihre Frau nicht hierher, folgen Sie meinem Rat. Oder aber verkaufen Sie.«
»Nein, Lucio. Ich mag dieses Haus.«
»Dickschädel, was? Woher stammen Sie?«
»Aus den Pyrenäen.«
»Dem großen Gebirge«, sagte Lucio voller Ehrerbietung. »Ich brauche also gar nicht erst zu versuchen, Sie zu überzeugen.«
»Kennen Sie es?«
»Ich bin auf der anderen Seite geboren, hombre. In Jaca.«
»Und die Leichen der sieben alten Frauen? Hat man zu der Zeit, als der Prozess stattfand, nach ihnen gesucht?«
»Nein. Damals, im vorvorvorigen Jahrhundert, stellte man noch keine Ermittlungen wie heutzutage an. Wahrscheinlich sind die Leichen immer noch da drunter«, meinte Lucio, wobei er mit seinem Stock in den Garten wies. »Deshalb hackt man auch nicht allzu tief. Man will den Teufel nicht reizen.«
»Nein, wozu auch?«
»Sie sind wie Maria«, sagte der Alte lächelnd, »es amüsiert Sie. Aber ich habe sie oft gespürt, hombre. Nebelschwaden, Dunst und dann ihr Atem, eisig wie der Winter oben auf den Bergspitzen. Und vorige Woche, ich pinkelte nachts unter den Haselnussstrauch, da habe ich sie tatsächlich gesehen.«
Lucio trank sein Glas Sauternes aus und kratzte seinen Biss.
»Sie ist mächtig alt geworden«, sagte er in beinahe angeekeltem Ton.
»Ist immerhin eine Ewigkeit her«, meinte Adamsberg.
»Natürlich. Clarisses Gesicht ist runzlig wie eine alte Nuss.«
»Wo war sie?«
»Im Obergeschoss. Sie ging in dem Zimmer oben hin und her.«
»Das wird mein Arbeitszimmer.«
»Und wo werden Sie Ihr Schlafzimmer einrichten?«
»Nebenan.«
»Sie haben wirklich Mut, Mann«, sagte Lucio und stand auf. »Ich bin doch nicht etwa zu grob gewesen? Maria will nicht, dass ich grob bin.«
»Ganz und gar nicht«, sagte Adamsberg, der sich plötzlich im Besitz von sieben Leichen unter den Füßen und einer Gespensterfrau mit einem Nussgesicht sah.
»Umso besser. Vielleicht gelingt es Ihnen ja, sie zu besänftigen. Obwohl es heißt, nur ein sehr alter Mann werde sie zur Strecke bringen. Aber das sind Legenden. Glauben Sie nur nicht jeden Blödsinn.«
Wieder allein, trank Adamsberg den Rest seines kalten Kaffees aus. Dann hob er den Kopf zur Decke und lauschte.
3
Nachdem er eine ruhige Nacht in der lautlosen Gesellschaft der heiligen Clarisse verbracht hatte, stieß Kommissar Adamsberg die Tür zum gerichtsmedizinischen Institut auf. Neun Tage zuvor war zwei Männern an der Porte de la Chapelle die Kehle durchgeschnitten worden, nur ein paar Hundert Meter voneinander entfernt. Zwei arme Würstchen, zwei Kleinganoven, die auf dem Flohmarkt mit Drogen dealten, so hatte der für diesen Bezirk zuständige Bulle als einzigen Kommentar bemerkt. Adamsberg legte großen Wert darauf, sie noch einmal zu sehen, seitdem Kommissar Mortier vom Drogendezernat sie ihm wegzunehmen gedachte.
»Zwei Penner mit durchschnittener Kehle an der Porte de la Chapelle, die sind für mich, Adamsberg«, hatte Mortier erklärt. »Zumal ein Schwarzer mit von der Partie ist. Du solltest sie mir übergeben, worauf wartest du noch? Soll’s Weihnachten darüber werden?«
»Ich warte, bis ich weiß, warum sie Erde unter den Fingernägeln hatten.«
»Weil sie vor Dreck nur so starrten.«
»Weil sie gegraben haben. Und Erde ist was für die Mordbrigade und was für mich.«
»Hast du noch nie gesehen, dass irgendwelche Idioten Stoff in Blumenkästen versteckt hatten? Du verschwendest deine Zeit, Adamsberg.«
»Das ist mir egal. Ich mag das.«
Die beiden nackten Leichen lagen nebeneinander, ein großer Weißer, ein großer Schwarzer, der eine stark behaart, der andere nicht, jeder unter einem Neonlicht des Leichenschauhauses. So wie sie jetzt dalagen, mit geschlossenen Füßen, die Hände am Körper, schienen sie im Tod zu braven Schülern geworden zu sein. Eigentlich, dachte Adamsberg beim Anblick ihrer folgsamen Körperhaltung, hatten die beiden Männer ein durchaus klassisches Dasein geführt; so geizte das Leben mit Originalität. Durchorganisierte Tagesabläufe: Der Morgen war stets dem Schlaf vorbehalten, der Nachmittag wurde dem Schwarzhandel gewidmet, der Abend war den Mädchen bestimmt und der Sonntag den Müttern. Wie überall, so herrschte die Routine auch in den Randbezirken des Seins. Ihre bestialische Ermordung brach auf ungewöhnliche Weise mit dem Hergang ihres sonst so faden Lebens.
Die Gerichtsmedizinerin sah zu, wie Adamsberg um die Leichen herumlief.
»Was soll ich mit ihnen machen?«, fragte sie, eine Hand auf dem Schenkel des großen Schwarzen, den sie lässig tätschelte wie für einen allerletzten Trost. »Zwei Burschen, die in den Elendsvierteln mit Drogen dealten, mit einer Klinge aufgeschlitzt, das sieht nach Arbeit für die Drogenfahnder aus.«
»In der Tat. Sie fordern sie ja auch lauthals für sich.«
»Und? Wo liegt das Problem?«
»Das Problem bin ich. Ich will sie ihnen nicht geben. Und ich erwarte, dass Sie mir helfen, sie zu behalten. Finden Sie irgendetwas.«
»Warum?«, fragte die Gerichtsmedizinerin, die Hand noch immer auf dem Schenkel des Schwarzen, wie um zu betonen, dass sich der Mann im Augenblick noch in ihrer Obhut befand, in einer freien Zone, und dass allein sie über sein Schicksal entschied, in Richtung Drogendezernat oder in Richtung Mordbrigade.
»Sie haben frische Erde unter den Fingernägeln.«
»Ich nehme allerdings an, die Drogenfahnder haben auch ihre Gründe. Sind die beiden Männer bei ihnen registriert?«
»Nicht mal das. Diese beiden Männer sind für mich bestimmt, Schluss, aus.«
»Man hatte mich vor Ihnen gewarnt«, sagte die Gerichtsmedizinerin ruhig.
»In welchem Sinne?«
»In dem Sinne, dass man nicht immer begreift, wonach Ihnen der Sinn steht. Die Folge: Konflikte.«
»Es wäre nicht das erste Mal, Ariane.«
Die Gerichtsmedizinerin zog mit der Fußspitze einen Rollhocker zu sich heran und setzte sich mit übereinandergeschlagenen Beinen darauf. Adamsberg hatte sie schön gefunden, damals, vor dreiundzwanzig Jahren, und sie war es noch immer, mit sechzig Jahren, wie sie da so elegant auf dem Schemel des Leichenschauhauses saß.
»Soso«, sagte sie. »Sie kennen mich.«
»Ja.«
»Aber ich Sie nicht.«
Die Medizinerin zündete sich eine Zigarette an und dachte eine Weile nach.
»Nein«, sagte sie schließlich, »sagt mir nichts. Ich bedaure.«
»Es war vor dreiundzwanzig Jahren und dauerte nur ein paar Monate. Ich erinnere mich an Sie, an Ihren Namen, Ihren Vornamen und daran, dass wir uns duzten.«
»So weit war es schon gekommen?«, sagte sie nicht gerade herzlich. »Und was haben wir ach so Vertrauten miteinander angestellt?«
»Wir hatten einen Riesenkrach.«
»Als Verliebte? Ich wäre untröstlich, wenn ich mich daran nicht erinnern würde.«
»Als Kollegen.«
»Soso«, wiederholte die Gerichtsmedizinerin, die Stirn gekraust.
Abgelenkt von den Erinnerungen, die diese hohe Stimme und der schroffe Ton ihm wieder ins Gedächtnis riefen, neigte Adamsberg den Kopf. Da war sie wieder, jene Zweideutigkeit, die ihn als jungen Mann so verlockt und verunsichert hatte, die strenge Kleidung, aber die saloppe Haartracht, der hochmütige Tonfall, aber die natürlichen Worte, die einstudierten Haltungen, aber die spontanen Gesten. Sodass man nicht wusste, ob man es mit einem überragenden und überheblichen Intellekt zu tun hatte oder aber mit einem rüden Arbeitstier, das auf Äußerlichkeiten nicht achtete. Bis hin zu jenem Soso, mit dem sie ihre Sätze oft begann, ohne dass man erkennen konnte, ob dies eine verächtliche oder eine rotzige Erwiderung war. Adamsberg war nicht der Einzige, der ihr gegenüber Vorsicht walten ließ. Dr. Ariane Lagarde war die angesehenste Gerichtsmedizinerin im Land und ohne Konkurrenz.
»Wir haben uns geduzt?«, fuhr sie fort, wobei sie ihre Asche auf den Boden fallen ließ. »Vor dreiundzwanzig Jahren hatte ich meinen Weg bereits gemacht, Sie müssen damals erst ein kleiner Lieutenant gewesen sein.«
»Genau genommen ein junger Brigadier.«
»Sie erstaunen mich. Ich duze meine Kollegen nicht so schnell.«
»Wir verstanden uns gut. Bis jener Riesenkrach losging, dass die Wände eines Cafés in Le Havre nur so wackelten. Die Tür schlug zu, wir haben uns nie wiedergesehen. Ich kam nicht mehr dazu, mein Bier auszutrinken.«
Ariane zertrat ihre Kippe, machte es sich erneut auf dem Metallhocker bequem, wobei sie wieder zögernd zu lächeln begann.
»Habe ich dieses Bierglas«, sagte sie, »zufällig auf den Boden geschmissen?«
»Ganz genau.«
»Jean-Baptiste«, sagte sie, indem sie jede Silbe einzeln aussprach. »Dieser junge Spund Jean-Baptiste Adamsberg, der glaubte, alles besser zu wissen als andere.«
»Genau das hast du zu mir gesagt, bevor du mein Glas zerschlagen hast.«
»Jean-Baptiste«, wiederholte Ariane langsamer.
Die Gerichtsmedizinerin stand von ihrem Hocker auf und legte Adamsberg eine Hand auf die Schulter. Sie schien kurz davor, ihn zu umarmen, schob die Hand aber wieder in die Tasche ihres Kittels zurück.
»Ich hatte dich gern. Du brachtest die Welt ins Wanken, ohne dass es dir überhaupt bewusst war. Und nach dem, was man sich über Kommissar Adamsberg erzählt, ist es mit der Zeit nicht besser geworden. Jetzt begreife ich: Er ist du und du bist er.«
»Gewissermaßen.«
Ariane stützte die Ellbogen auf den Seziertisch, auf dem die Leiche des großen Weißen lag, wobei sie den Oberkörper des Toten wegschob, um es bequemer zu haben. Wie alle Gerichtsmediziner ließ Ariane gegenüber den Verstorbenen keinerlei Respekt erkennen. Dafür wühlte sie mit unübertroffenem Talent im Rätsel ihrer Körper herum und erwies so auf ihre Weise der unendlichen und einzigartigen Komplexität eines jeden die Ehre. Die Abhandlungen von Dr. Lagarde hatten die Leichen gewöhnlicher Sterblicher berühmt gemacht. Wer in ihre Hände geriet, ging in die Geschichte ein. Bedauerlicherweise tot.
»Es war eine sehr ungewöhnliche Leiche«, erinnerte sie sich. »Man hatte sie in ihrem Schlafzimmer gefunden, mit einem fein ausgetüftelten Abschiedsbrief. Ein kompromittierter und ruinierter Abgeordneter der Stadt, der sich durch einen Stoß mit dem Säbel in den Bauch umgebracht hatte, auf japanische Art.«
»Mit Gin abgefüllt, um sich Mut anzutrinken.«
»Ich sehe ihn noch genau vor mir«, fuhr Ariane fort, im gedämpften Ton einer, die sich eine nette Geschichte ins Gedächtnis ruft. »Ein lupenreiner Selbstmord, dem noch dazu eine langjährige Neigung zu zwanghaften Depressionen vorausgegangen war. Der Stadtrat war erleichtert, dass der Fall keine höheren Wellen schlug, erinnerst du dich? Ich hatte meinen Bericht abgegeben, einen einwandfreien. Du hattest die Kopien gemacht, sie geheftet, Einkäufe erledigt, alles etwas widerwillig. Abends gingen wir am Seine-Quai einen Schluck trinken. Ich stand kurz vor der Beförderung, du träumtest ohne Ambitionen vor dich hin. Damals mischte ich Grenadine ins Bier, das schäumte sofort.«
»Hast du auch später noch solche Mischungen erfunden?«
»Ja«, sagte Ariane in etwas enttäuschtem Ton, »jede Menge, aber bis jetzt ohne wirklichen Erfolg. Erinnerst du dich an die Violine? Geschlagenes Ei, Minze und Malagawein.«
»Das habe ich nie kosten wollen.«
»Ich hab sie aufgegeben, die Violine. Sie war gut für die Nerven, aber zu kalorienreich. Wir haben viele Mischungen versucht in Le Havre.«
»Außer einer.«
»Soso.«
»Die Mischung der Körper. Die haben wir nicht versucht.«
»Nein. Ich war noch verheiratet und ergeben wie ein kranker Hund. Dafür bildeten wir ein perfektes Duo bei den Polizeiberichten.«
»Bis …«
»Bis ein kleiner Idiot namens Jean-Baptiste Adamsberg sich in den Kopf setzte, dass der Abgeordnete von Le Havre ermordet worden sei. Und warum? Wegen zehn toter Ratten, die du in einem Lagerhaus des Hafens aufgelesen hattest.«
»Zwölf, Ariane. Zwölf Ratten, die verblutet waren, nachdem man ihnen den Bauch aufgeschlitzt hatte.«
»Zwölf, wenn du willst. Daraus hattest du geschlossen, dass ein Mörder sich Mut antrainiert, bevor er losstürmt. Und da war noch etwas anderes. Du fandest, die Wunde läge allzu waagerecht. Du sagtest, der Abgeordnete hätte den Säbel eigentlich schräger halten müssen, von unten nach oben. Während er doch stockbetrunken war.«
»Und dann hast du mein Glas auf den Boden geschmissen.«
»Ich hatte ihm doch einen Namen gegeben, verdammt, diesem Grenadine-Bier.«
»Grenaille. Du hast dafür gesorgt, dass ich gefeuert wurde in Le Havre, und deinen Bericht ohne mich abgegeben: Selbstmord.«
»Was hast du schon davon verstanden? Nichts.«
»Nichts«, gab Adamsberg zu.
»Lass uns einen Kaffee trinken. Und du wirst mir erzählen, was dir an deinen Leichen so zu denken gibt.«
4
Lieutenant Veyrenc war seit drei Wochen mit diesem Auftrag betraut und saß eingeklemmt in einem ein Quadratmeter großen Wandschrank zum Schutz einer jungen Frau, die er zehnmal am Tag auf dem Treppenabsatz vorbeigehen sah. Diese junge Frau rührte ihn an und dieses Gefühl wiederum wurmte ihn. Er rutschte auf seinem Stuhl hin und her, suchte eine andere Sitzposition.
Doch kein Grund zur Aufregung, das war nur ein Körnchen Sand im Getriebe, ein Splitter im Fuß, ein Vogel im Motor. Der Mythos, demzufolge ein einziger kleiner Vogel, so entzückend er sein mochte, ganz allein die Turbine eines Flugzeugs zum Explodieren bringen konnte, war reiner Quatsch, wie so vieles andere, was die Menschen dauernd erfanden, um sich selbst Angst einzujagen. Als hätten sie nicht schon genug solcher Sorgen. Veyrenc verscheuchte den Vogel, indem er an etwas anderes dachte, schraubte seinen Füller auf und machte sich daran, sorgfältig die Feder zu reinigen. Es gab ohnehin nichts anderes zu tun. Im Haus war es vollkommen still.
Er schraubte seinen Füller wieder zu, klemmte ihn an seiner Innentasche fest und schloss die Augen. Fünfzehn Jahre lang war er Tag für Tag im verbotenen Schatten des Nussbaums eingeschlafen. Fünfzehn Jahre harter Arbeit, die ihm keiner nehmen würde. Beim Aufwachen hatte er seine Allergie mit dem Saft des Baumes behandelt, und im Laufe der Zeit hatte er die Schrecken gezähmt, war er bis zum Ursprung der quälenden Fragen hinabgestiegen, um seine Qual zu bändigen. Fünfzehn Jahre Anstrengung, um einen schmächtigen jungen Burschen, der sein Haar verbarg, in einen kräftigen Körper und eine robuste Seele zu verwandeln. Fünfzehn Jahre Kraftaufwand, um nicht mehr als verletzlicher Tollkopf durch die Welt der Frauen zu taumeln, eine Welt, die ihn gesättigt von Gefühlen und überdrüssig ihrer Verwicklungen zurückgelassen hatte. Als er wieder aufgestanden war unter jenem Nussbaum, war er in Streik getreten wie ein erschöpfter Arbeiter, der vorzeitig den Ruhestand wählt. Sich fernhalten von den steilen Höhenlagen, Wasser in den Wein der Gefühle mischen, verdünnen, dosieren, den Zwang der Begierden brechen. Für seine Begriffe kam er inzwischen gut damit zurecht, er mied verworrene und chaotische Situationen und war einer gewissen idealen Ausgeglichenheit schon ganz nah. Nur harmlose und flüchtige Beziehungen, rhythmische Schwimmbewegungen hin zu seinem Ziel, Arbeit, Lesen und Verseschmieden, ein beinahe vollkommener Zustand.
Sein Ziel, in die Pariser Brigade criminelle versetzt zu werden, die von Kommissar Adamsberg geführt wurde, hatte er erreicht. Er war zufrieden, wenn auch überrascht. Es herrschte ein ungewöhnliches Mikroklima in diesem Team. Unter der kaum spürbaren Leitung ihres Chefs ließen die Beamten ihre Fähigkeiten nach Belieben sprießen, gaben sich Stimmungen und Launen hin, die in keinerlei Zusammenhang mit den gesetzten Zielen standen. Die Brigade hatte eine Menge unbestreitbarer Resultate vorzuweisen, aber Veyrenc blieb äußerst skeptisch. Es fragte sich, ob diese Leistung das Ergebnis einer Strategie oder eine Frucht der Vorsehung war. Einer Vorsehung, die die Augen beispielsweise vor der Tatsache verschloss, dass Mercadet im oberen Stockwerk Kissenblöcke ausgelegt hatte, auf denen er mehrere Stunden am Tag schlief, oder dass eine exzentrische Katze ihre Kothäufchen auf die Papierstapel setzte, dass Commandant Danglard seinen Wein in einem Schrank im Keller versteckte, dass auf den Tischen Papiere herumlagen, die mit den Ermittlungen nicht das Geringste zu tun hatten, Immobilienanzeigen, Wettlisten, Artikel über Ichthyologie, private Vorwürfe, geopolitische Zeitschriften, ein Spektrum in allen Regenbogenfarben, soweit er das in einem Monat überblickt hatte. Dieser Zustand schien keinen zu stören, außer vielleicht Lieutenant Noël, einen brutalen Kerl, der niemanden nach seinem Geschmack fand. Und der schon am zweiten Tag eine beleidigende Bemerkung über seine Haare gemacht hatte. Vor zwanzig Jahren hätte er deswegen geheult, aber heute war es ihm vollkommen egal, oder doch beinahe. Lieutenant Veyrenc verschränkte die Arme und lehnte seinen Kopf an die Wand. Unverrückbare Kraft, in kompakte Materie eingerollt.
Was den Kommissar selbst betraf, so hatte er ihn nur mit Mühe erkannt. Von Weitem sah Adamsberg nach nichts aus. Er war diesem kleinen Mann schon mehrmals begegnet, sehniger Körper und langsame Bewegungen, ein seltsam zusammengestückeltes Gesicht, zerknitterte Sachen und ein ebensolcher Blick, unvorstellbar, dass es sich dabei um einen der berühmtesten Repräsentanten der Kripo handelte, im Guten wie im Schlechten. Selbst seine Augen schienen ihm zu nichts dienlich zu sein. Seit dem ersten Tag wartete Veyrenc auf sein offizielles Gespräch mit ihm. Aber Adamsberg, versunken in irgendwelchen Strömen tiefsinniger oder auch leerer Gedanken, hatte ihn nicht bemerkt. Es kam vor, dass ein volles Jahr verstrich, ohne dass der Kommissar gewahr wurde, dass sein Team ein neues Mitglied zählte.
Die anderen Beamten allerdings hatten den großen Vorteil, den die Ankunft eines Neuen darstellte, sofort genutzt. Deshalb auch saß er nun in diesem Kabuff, auf dem Treppenabsatz eines siebten Stockwerks, und führte einen Überwachungsjob aus, bei dem man vor Langeweile umkam. Der Dienstvorschrift nach hätte er regelmäßig abgelöst werden müssen und so war es anfangs auch gewesen. Dann hatte die Ablösung immer schlechter funktioniert, der eine bedauerte unter dem Vorwand, er werde schnell trübsinnig, der andere schlief angeblich ein, wieder ein anderer neigte zu Klaustrophobie, zu Ungeduld, hatte ein Rückenleiden, sodass er jetzt allein von morgens bis abends hier auf einem Holzstuhl Wache hielt.
Veyrenc streckte seine Beine aus, so gut er konnte. Das war das Los aller Neuen und es machte ihm nichts aus. Mit dem Bücherstapel zu seinen Füßen, dem Taschenaschenbecher in seiner Jacke, dem Ausblick auf den Himmel durch das Oberlicht und seinem funktionstüchtigen Füllfederhalter hätte er hier beinahe glücklich leben können. Geist in Ruhestellung, beherrschte Einsamkeit, Ziel erreicht.
5
Dr. Lagarde hatte die Dinge kompliziert, indem sie ein klein wenig Mandelsirup verlangt hatte, den sie ihrem doppelten Café crème beimischen wollte. Aber schließlich waren die Getränke auf ihren Tisch gelangt.
»Was ist mit Dr. Romain los?«, fragte sie, während sie die dickliche Flüssigkeit verrührte.
Adamsberg breitete die Hände in einer Geste der Unkenntnis aus.
»Er hat hysterische Launen, Zustände. Wie eine Frau im vorigen Jahrhundert.«
»Soso. Und wie kommst du zu dieser Diagnose?«
»Durch Romain selbst. Keine Depression, nichts Pathologisches. Aber er schleppt sich von einem Sofa zum andern, zwischen Nachmittagsschlaf und Kreuzworträtsel.«
»Soso«, wiederholte Ariane und runzelte die Stirn. »Romain ist doch einer von den ganz Aktiven und ein äußerst tüchtiger Gerichtsmediziner dazu. Er mag seine Arbeit.«
»Ja. Aber er hat diese Zustände. Wir haben mit der Entscheidung, ihn zu ersetzen, auch lange gezögert.«
»Und wieso hast du ausgerechnet mich geholt?«
»Ich habe dich nicht geholt.«
»Man hat mir gesagt, die Pariser Brigade würde unbedingt nach mir verlangen.«
»Ich war’s nicht, aber du kommst wie gerufen.«
»Um den Drogenfahndern deine beiden Kerle wegzunehmen.«
»Mortier zufolge handelt es sich nicht um zwei Kerle. Es handelt sich um zwei arme Würstchen, von denen einer ein Schwarzer ist. Mortier ist der Chef der Drogenfahnder, wir haben keine besonders gute Beziehung zueinander.«
»Weigerst du dich deshalb, ihm die Leichen zu überlassen?«
»Nein, ich jage keinen Leichnamen hinterher. Aber es fügt sich halt, dass diese beiden für mich bestimmt sind.«
»Das hast du mir schon gesagt. Erzähl.«
»Wir wissen nichts. Sie sind in der Nacht von Freitag zu Samstag an der Porte de la Chapelle ermordet worden. Für Mortier ist das zwangsläufig ein Hinweis auf Drogen. Für Mortier beschäftigen sich Schwarze übrigens nur mit Drogen, man fragt sich, ob sie überhaupt etwas anderes kennen vom Leben. Und dann ist da diese Spur eines Einstichs in der Armbeuge.«
»Habe ich gesehen. Die Routineuntersuchungen haben nichts ergeben. Was erwartest du von mir?«
»Dass du nachforschst und mir sagst, was in der Spritze war.«
»Warum lehnst du die Möglichkeit mit den Drogen ab? Davon gibt’s doch reichlich an der Porte de la Chapelle.«
»Die Mutter von dem großen Schwarzen schwört, ihr Sohn habe so etwas nicht angerührt. Er nahm nichts und dealte auch nicht. Die Mutter des großen Weißen weiß es nicht.«
»Du glaubst immer noch, was alte Mamas sagen?«
»Meine sagte immer, dass ich einen Kopf wie ein Sieb hätte und man den Wind hindurchpfeifen hören könnte. Sie hatte recht. Und ich sagte dir schon: Sie haben schmutzige Fingernägel, alle beide.«
»Wie alle Notleidenden vom Flohmarkt.«
Ariane sagte »Notleidende« in jenem mitleidigen Ton der großen Gleichgültigen, für die das Elend eine Tatsache ist und kein Problem.
»Das ist kein Dreck, Ariane, es ist Erde. Und diese Burschen hatten keinen Garten. Sie wohnten in heruntergekommenen Zimmern in Mietskasernen, ohne Licht und Heizung, wie sie die Stadt Notleidenden anbietet. Mit ihren alten Mamas.«
Dr. Lagarde hatte ihren Blick auf die Wand gerichtet. Wenn Ariane eine Leiche betrachtete, verkleinerten sich ihre Augen in einer starren Stellung und schienen sich in die hochpräzisen Linsen eines Mikroskops zu verwandeln. Adamsberg war sich sicher, dass er, hätte er ihre Pupillen in diesem Augenblick genau angeschaut, zwei vollständige Abbilder der beiden Leichname darin gesehen hätte, den Weißen im linken, den Schwarzen im rechten Auge.
»Eins wenigstens kann ich dir sagen, das dir weiterhelfen kann, Jean-Baptiste. Es war eine Frau, die sie umgebracht hat.«
Adamsberg stellte seine Tasse ab; er zögerte, der Gerichtsmedizinerin zum zweiten Mal in seinem Leben zu widersprechen.
»Ariane, hast du gesehen, wie groß die beiden Männer waren?«
»Was glaubst du denn, was ich mir im Leichenschauhaus anschaue? Meine Erinnerungen? Ich hab deine Jungs gesehen. Bullige Typen, die einen Schrank mit dem kleinen Finger anheben könnten. Trotzdem hat eine Frau sie umgebracht, alle beide.«
»Erklär’s mir.«
»Komm heute Abend wieder. Ich muss zwei oder drei Dinge nachprüfen.«
Ariane stand auf und zog ihren Kittel, den sie am Garderobenständer zurückgelassen hatte, über ihr Kostüm. In der Gegend des Leichenschauhauses mochten die Wirte es nicht, wenn man die Mediziner aufkreuzen sah. Die Kundschaft störte sich dran.
»Ich kann nicht. Heute Abend gehe ich ins Konzert.«
»Dann komm nach deinem Konzert vorbei. Ich arbeite spätnachts, falls du dich erinnerst.«
»Ich kann nicht, es ist in der Normandie.«
»Soso«, meinte Ariane und stockte in ihrer Bewegung. »Was wird denn gegeben?«
»Weiß ich nicht.«
»Und du fährst bis in die Normandie, um ein Konzert zu hören, über das du nichts weißt? Oder fährst du einer Frau hinterher?«
»Ich fahre ihr nicht hinterher, ich begleite sie höflichst.«
»Soso. Dann komm halt morgen im Leichenschauhaus vorbei. Aber nicht am frühen Morgen. Morgens schlafe ich.«
»Ich erinnere mich. Nicht vor elf Uhr.«
»Nicht vor Mittag. Mit der Zeit wird alles ausgeprägter.«
Ariane setzte sich noch einmal flüchtig auf die Stuhlkante zurück.
»Eins würde ich dir gern noch sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich Lust dazu habe.«
Momente des Schweigens hatten Adamsberg nie in Verlegenheit gebracht, mochten sie noch so lang sein. Er wartete, ließ seine Gedanken zu dem abendlichen Konzert schweifen. Es vergingen fünf Minuten oder zehn, er wusste es nicht.
»Sieben Monate später«, sagte Ariane plötzlich entschieden, »ist der Mörder bei uns aufgetaucht und hat ein vollständiges Geständnis abgelegt.«
»Du meinst den Kerl aus Le Havre«, sagte Adamsberg und blickte die Gerichtsmedizinerin an.
»Ja, den Mann mit den zwölf Ratten. Zehn Tage nach seinem Schuldbekenntnis hat er sich in seiner Zelle erhängt. Du hattest recht.«
»Und das hat dir nicht gefallen.«
»Nein, und meinen Vorgesetzten noch weniger. Meine Beförderung konnte ich vergessen, ich musste fünf Jahre länger darauf warten. Angeblich sollst du mir die Lösung auf einem Tablett serviert haben und ich hatte angeblich nichts davon hören wollen.«
»Und du hast es mich auch nicht wissen lassen.«
»Ich wusste deinen Namen nicht mehr, ich hatte dich ausradiert, weit von mir gestoßen. Wie dein Glas.«
»Und du nimmst es mir immer noch übel.«
»Nein. Denn erst dank des Geständnisses des Mannes mit den Ratten habe ich angefangen, über die Dissoziation zu forschen. Hast du mein Buch nicht gelesen?«
»Flüchtig«, wich Adamsberg aus.
»Ich war’s, die den Begriff eingeführt hat: die dissoziierten Mörder.«
»Ja«, korrigierte Adamsberg sich, »man hat mir davon erzählt. Personen, die halbiert sind.«
Die Gerichtsmedizinerin verzog das Gesicht.
»Sagen wir eher Individuen, die sich aus zwei unverbundenen Teilen zusammensetzen, einem, der tötet, und einem anderen, der ein normales Leben führt, wobei die beiden Hälften nichts voneinander wissen, mehr oder weniger. Sind sehr selten. Beispielsweise diese Krankenschwester, die vor zwei Jahren in Asnières verhaftet wurde. Solche Mörder, gefährliche Wiederholungstäter, lassen sich nur äußerst schwer ausfindig machen. Denn sie sind unverdächtig, inklusive sich selbst, und schrecklich vorsichtig in ihrem Tun, so sehr fürchten sie, ihre andere Hälfte könnte sie entdecken.«
»Ich erinnere mich an diese Krankenschwester. Deiner Auffassung nach war sie also eine Dissoziierte?«
»Eine fast einwandfreie. Wäre sie nicht an ein Genie von Bulle geraten, hätte sie bis zu ihrem Tod weitergemetzelt, noch dazu ohne die geringste Ahnung. Zweiunddreißig Opfer in vierzig Jahren, ohne mit der Wimper zu zucken.«
»Dreiunddreißig«, berichtigte Adamsberg.
»Zweiunddreißig. Ich muss es wissen, schließlich habe ich stundenlang mit ihr gesprochen.«
»Dreiunddreißig, Ariane. Denn ich habe sie verhaftet.«
Die Gerichtsmedizinerin zögerte, dann lächelte sie.
»Wahrhaftig«, sagte sie.
»Und als der Mörder aus Le Havre die Ratten aufschlitzte, war er da der andere? War er Teil Nummer zwei, der tötende Teil?«
»Interessiert dich die Dissoziation?«
»Diese Krankenschwester beschäftigt mich und der Mörder aus Le Havre ist ein bisschen meiner. Wie hieß er?«
»Hubert Sandrin.«
»Und als er sein Geständnis ablegte? War er da auch der andere?«
»Das ist unmöglich, Jean-Baptiste. Der andere zeigt sich niemals selbst an.«
»Aber Teil Nummer eins konnte doch auch nicht sprechen, wenn er von nichts wusste.«
»Genau das war die Frage. Die Dissoziation hat für einige Augenblicke aufgehört zu funktionieren, die Undurchlässigkeit zwischen den beiden Männern brach auf, wie ein Riss eine Wand spaltet. Durch diesen Spalt hat Hubert Nummer eins den anderen, Hubert Nummer zwei, gesehen, und das Grauen hat ihn gepackt.«
»So was kommt vor?«
»Fast nie. Aber die Dissoziation ist nur selten vollkommen. Es gibt immer undichte Stellen. Wirre Worte springen von einer Seite der Wand auf die andere. Der Mörder nimmt sie nicht wahr, aber der Analytiker kann sie bemerken. Und wenn dieser Sprung zu gewaltsam ist, kann es zu einem Zusammenbruch des Systems kommen, zu einem Persönlichkeitscrash. Genau das ist bei Hubert Sandrin passiert.«
»Und die Krankenschwester?«
»Ihre Wand hält. Sie weiß nicht, was sie getan hat.«
Adamsberg schien nachzudenken, strich sich mit dem Finger über die Wange.
»Das wundert mich«, sagte er leise. »Es schien mir, als wüsste sie, weshalb ich sie verhafte. Sie nahm alles ohne ein Wort hin.«
»Ein Teil von ihr, ja, was dir ihr Einverständnis erklärt. Aber sie erinnert sich in keiner Weise an ihre Taten.«
»Hast du erfahren, wie der Mörder aus Le Havre Hubert Nummer zwei entdeckt hat?«
Ariane lächelte offen, wobei sie ihre Asche auf den Boden fallen ließ.
»Deinetwegen und wegen deiner zwölf Ratten. Die Lokalpresse hatte deine Spinnereien seinerzeit veröffentlicht.«
»Ich entsinne mich.«
»Und Hubert Nummer zwei, der Mörder – nennen wir ihn Omega –, hatte die Zeitungsausschnitte aufgehoben, und zwar geschützt vor den Blicken von Hubert Nummer eins, dem gewöhnlichen Mann, nennen wir ihn Alpha.«
»Bis Alpha die Zeitungsausschnitte, die Omega versteckt hatte, entdeckte.«
»Genau.«
»Würdest du sagen, Omega wollte das?«
»Nein. Alpha ist einfach nur umgezogen. Die Artikel sind aus seinem Schrank gefallen. Und alles flog auf.«
»Ohne meine Ratten«, fasste Adamsberg leise zusammen, »hätte Sandrin sich nicht gestellt. Ohne ihn hättest du nicht über Dissoziation gearbeitet. Alle Psychiater und alle Bullen in Frankreich haben von deinen Studien gehört.«
»Ja«, gab Ariane zu.
»Du schuldest mir ein Bier.«
»Gewiss.«
»Auf den Seine-Quais.«
»Wenn du willst.«
»Und du übergibst die beiden Burschen natürlich nicht den Drogenfahndern.«
»Die Leichen entscheiden, Jean-Baptiste, nicht du, nicht ich.«
»Die Spritze, Ariane. Und die Erde. Achte auf diese Erde. Und sag mir, ob’s überhaupt welche ist.«
Gemeinsam standen sie auf, als hätte Adamsbergs Satz das Signal zum Aufbruch gegeben. Auf der Straße dann verfiel der Kommissar in seinen gewohnten Promenadenschritt, und die Gerichtsmedizinerin versuchte, diesem allzu langsamen Rhythmus zu folgen, in Gedanken bereits bei den Autopsien, die auf sie warteten. Adamsbergs Sorge konnte sie nicht verstehen.
»Irgendwas stört dich an diesen Leichen, nicht wahr?«
»Ja.«
»Nicht nur wegen der Drogenfahnder?«
»Nein. Es ist bloß …«
Adamsberg stockte.
»Ich geh dort lang, Ariane, ich sehe dich morgen.«
»Bloß was?«, hakte die Gerichtsmedizinerin nach.
»Es wird dir bei deiner Analyse nicht helfen.«
»Trotzdem?«
»Es ist ein Schatten, Ariane, ein Schatten, der sich über sie beugt, oder über mich.«
Ariane sah, wie Adamsberg mit wiegendem Schritt die Avenue hinunterging, eine Gestalt, die auf die Passanten nicht achtete. Sie erkannte diesen Gang wieder, noch dreiundzwanzig Jahre später. Diese sanfte Stimme, diese gemächlichen Gesten. Sie hatte ihm keine Beachtung geschenkt, als er jung war, sie hatte nichts geahnt, nichts verstanden. Wenn man noch einmal von vorn anfangen könnte, würde sie seiner Rattengeschichte besser zuhören. Sie steckte die Hände in die Taschen ihres Kittels und ging davon zu den zwei Leichen, die auf sie warteten, um in die Geschichte einzugehen. Es ist ein Schatten, der sich über sie beugt. Sie konnte diese Ungereimtheit heute gut verstehen.
6
Lieutenant Veyrenc nutzte jene endlosen Stunden im Verschlag, um in großer Schrift ein Stück von Racine abzuschreiben, für seine Großmutter, die nicht mehr gut sah.
Niemand hatte je die ausschließliche Leidenschaft verstanden, die seine Großmutter für diesen Autor und keinen anderen erklärt hatte, nachdem sie Kriegswaise geworden war. Man wusste, dass sie in ihrem von Nonnen geleiteten Mädchenpensionat sämtliche Werke Racines vor einem Brand gerettet hatte, mit Ausnahme des Bandes, der Phädra, Esther und Athalie enthielt. Und als seien ihr diese Werke durch göttlichen Beschluss zugesprochen worden, hatte die kleine Bäuerin sich abgemüht und sie elf Jahre lang Zeile für Zeile gelesen. Als sie das Kloster verließ, schenkte die Oberin sie ihr wie eine heilige Wegzehrung, und die Großmutter setzte ihre Lektüreschleife unermüdlich fort, ohne je zu variieren oder gar die Neugierde zu haben, auch mal in Phädra, Esther oder Athalie hineinzuschauen. Sie murmelte die langen Monologe ihres Weggefährten in einem nahezu durchgehenden Fluss vor sich hin, und der kleine Veyrenc war aufgewachsen in diesem Singsang, der für seine Kinderohren genauso natürlich klang, wie wenn jemand im Haus vor sich hin summte.
Zu seinem Unglück übernahm er diesen Tick und antwortete seiner Großmutter instinktiv auf die gleiche Weise, das heißt in Sätzen mit zwölf Versfüßen. Da er sich aber nicht wie sie nächtelang jene Tausende Verse einverleibt hatte, musste er sie erfinden. Solange er im Elternhaus gelebt hatte, war alles gut gegangen. Aber sobald er in die Außenwelt entlassen worden war, war ihn dieser racinesche Reflex teuer zu stehen gekommen. Er hatte ohne Erfolg verschiedene Methoden ausprobiert, ihn zu unterdrücken, dann hatte er ihm schließlich nachgegeben, hatte weiter drauflosgedichtet und die Verse wie seine Großmutter vor sich hin gemurmelt, und diese Marotte hatte seine Vorgesetzten in Rage versetzt. Sie hatte ihn auch auf vielerlei Art gerettet, denn das Leben in zwölffüßigen Versen zu skandieren, schuf einen unvergleichlichen Abstand – der seinesgleichen sucht – zwischen ihm und dem Lärm der Welt. Dieser Distanzeffekt hatte ihm stets Frieden verschafft und ihn zum Nachdenken gebracht, vor allem aber hatte er ihn davor bewahrt, im Eifer des Gefechts nicht wiedergutzumachende Fehler zu begehen. Trotz seiner Dramatik und seiner flammenden Sprache war Racine das beste Mittel gegen Erregung, kühlte er doch auf der Stelle jegliche Lust auf maßlose Reaktionen ab. Veyrenc machte bewusst davon Gebrauch, nachdem er begriffen hatte, dass seine Großmutter auf diese Weise ihr Leben in Ordnung gehalten und geregelt hatte. Ganz persönliche Medizin, niemandem sonst bekannt.
Momentan musste die Großmutter ihre Arznei entbehren und Veyrenc schrieb Britannicus in großen Buchstaben für sie ab. In dem schlichten Kleid der Schönheit, die man aus dem Schlummer riss. Veyrenc setzte seinen Füller ab. Er hörte das Sandkörnchen die Treppe heraufkommen, er erkannte seinen Schritt, das rasche Geräusch seiner Stiefel, denn das Sandkörnchen zog seine Riemenlederstiefel nie aus. Es würde zunächst auf dem Treppenabsatz in der Fünften stehen bleiben, bei der gebrechlichen Dame klingeln, um ihr ihre Post und das Mittagessen zu übergeben, dann wäre sie in einer Viertelstunde oben. Das Sandkörnchen – mit anderen Worten die Bewohnerin dieser Etage, mit anderen Worten Camille Forestier, die er nun schon seit neunzehn Tagen bewachte. Nach dem, was man ihm erzählt hatte, stand sie für ein halbes Jahr unter Polizeischutz, aus Angst vor der möglichen Rache eines Mördergreises*. Ihr Name war alles, was er von ihr wusste. Und dass sie den Kleinen allein aufzog, ohne dass ein Mann am Horizont sichtbar gewesen wäre. Ihren Beruf konnte er einfach nicht erraten, er schwankte zwischen Klempnerin und Musikerin. Vor zwölf Tagen hatte sie ihn freundlich gebeten, aus dem Verschlag herauszukommen, weil sie eine Schweißarbeit am Deckenrohr vornehmen wollte. Er hatte seinen Stuhl auf den Treppenabsatz geschafft und zugeschaut, wie sie unter dem Geklirr der Werkzeuge und der Flamme des Schweißbrenners konzentriert und gewissenhaft arbeitete. Während dieser Begebenheit hatte er gespürt, wie er in das verbotene und gefürchtete Chaos zurückkippte. Seitdem brachte sie ihm zweimal am Tag einen heißen Kaffee, um elf und um sechzehn Uhr.
Er hörte, wie sie ihre Tasche im fünften Stock absetzte. Der Gedanke, den Verschlag auf der Stelle zu verlassen, um diesem Mädchen niemals wieder zu begegnen, ließ ihn von seinem Stuhl aufstehen. Er presste seine Arme an sich, hob den Kopf zum Oberlicht und musterte sein Gesicht im Staub der Scheibe. Absonderliches Haar, uninteressante Züge, ich bin hässlich, ich bin unsichtbar. Veyrenc holte tief Luft, schloss die Augen, murmelte:
»Ich seh’s ja, deine Seele bebt, du zitterst, ach.
Bezwinger Trojas, an nur einem Tag nahmst du
die Kapitale ein, des Volkes Gunst dazu!
Und nun wird wegen einem Weib dein Herze schwach?«
Nein, mitnichten. Veyrenc setzte sich ruhig wieder hin, seine vier Verse hatten ihn abgekühlt. Manchmal hatte er sechs oder acht nötig, manchmal genügten zwei. Gelassen fuhr er mit seiner Abschrift fort, zufrieden mit sich selbst. Die Sandkörner treiben vorüber, die Vögel fliegen davon, die Selbstbeherrschung bleibt. Kein Grund zur Aufregung.
Camille legte eine Pause im fünften Stock ein, nahm das Kind auf den anderen Arm. Wahrscheinlich wäre es das Einfachste, diese Treppe wieder hinunterzugehen und erst um zwanzig Uhr zurückzukommen, wenn sie den wachhabenden Bullen ausgewechselt hätten. Die neun Grundsätze des Tapferen sind die Flucht, behauptete ihre türkische Freundin, Cellistin in Saint-Eustache, die über einen Schatz an ebenso wunderlichen wie unverständlichen und wohltuenden Sprichwörtern verfügte. Offenbar gab es einen zehnten Grundsatz, doch Camille kannte ihn nicht und dachte ihn sich lieber selbst aus. Sie nahm Post und Besorgungen aus ihrer Tasche und klingelte an der Tür links. Die Treppen waren für Yolande zu anstrengend geworden, ihre Beine zu schwach, ihr Gewicht zu schwer.
»Ein Jammer, das«, sagte Yolande, als sie die Tür öffnete. »Seinen Jungen ganz allein großzuziehen.«
Jeden Tag brachte die alte Yolande diese Klage vor. Camille trat ein, legte ihre Einkäufe und die Briefe auf den Tisch. Dann machte die alte Dame ihr, wer weiß, warum, eine warme Milch wie für einen Säugling.
»Es ist gut so, es ist ruhig«, antwortete Camille gewohnheitsmäßig und setzte sich.
»Dummes Zeug. Eine Frau ist nicht fürs Alleinsein geschaffen. Selbst wenn die Männer einem nur Scherereien einbringen.«
»Sehen Sie, Yolande. Auch die Frauen bringen einem nur Scherereien ein.«
Sie hatte diese Diskussion hundertmal gehabt, fast Wort für Wort, ohne dass sich Yolande jemals daran zu erinnern schien. An dieser Stelle versetzte ihre Bemerkung die dicke Frau stets in ein nachdenkliches Schweigen.
»Wenn’s so ist«, meinte Yolande, »bleibt dann wohl jeder besser für sich, wenn die Liebe den einen wie den anderen nur Ärger macht.«
»Schon möglich.«
»Aber man sollte auch nicht allzu sehr die Stolze spielen, mein Kleines. Denn in der Liebe macht man nicht, was man will.«
»Aber wer, Yolande, macht dann an unserer Stelle, was man nicht will?«
Camille lächelte, und Yolande schniefte als Antwort, während ihre schwere Hand wieder und wieder über das Tischtuch strich, auf der Suche nach einem nicht vorhandenen Krümel. Wer? Die Mächtigen, vervollständigte Camille schweigend. Sie wusste, dass Yolande überall das Zeichen der Mächtigen-die-uns-regieren sah und ihrer ganz persönlichen, heidnischen kleinen Religion frönte, über die sie kaum sprach, aus Furcht, man könne sie ihr rauben.
Acht Stufen vor ihrer Wohnungstür wurde Camille langsamer. Die Mächtigen, dachte sie. Die ihr einen schief lächelnden Typen im Wandschrank auf ihrem Treppenabsatz beschert hatten. Nicht schöner als andere, wenn man nicht darauf achtete. Viel schöner, wenn man auf die schlechte Idee kam, daran zu denken. Camille hatte sich immer schon in den verschwommenen Blicken und den weichen Stimmen verfangen, und so war sie auch mehr als fünfzehn Jahre in Adamsbergs Armen geblieben, wobei sie sich fest vorgenommen hatte, nicht dorthin zurückzukehren. Weder zu ihm noch zu irgendjemand anderem mit jener einschmeichelnden Sanftmut und trügerischen Zärtlichkeit. Es gab auf der Welt doch genügend einfach gestrickte Kerle, um sich notfalls ohne großes Raffinement mal auszulüften, Kerle, von denen man befreit und ruhig wieder nach Hause gehen konnte, ohne weiter darüber nachzudenken. Camille verspürte keinerlei Bedürfnis nach Gesellschaft. Durch welchen verfluchten Zufall musste dieser Typ, dem Die Mächtigen geholfen hatten, ihr mit seiner belegten Stimme und seiner schrägen Lippe die Sinne verwirren? Sie legte ihre Hand auf den Kopf des kleinen Thomas, der sabbernd an ihrer Schulter schlief. Veyrenc. Mit den roten und den braunen Haaren. Sandkorn im Getriebe, Störung, die ungelegen kam. Misstrauen, Wachsamkeit – und Flucht.
*Fred Vargas, Der vierzehnte Stein.
7
Kurz nachdem Adamsberg sich von Ariane verabschiedet hatte, ging ein Hagelschauer auf den Boulevard Saint-Marcel nieder, zerhackte seine Umrisse und verwandelte die Pariser Avenue in eine x-beliebige von der Sintflut überschwemmte Landstraße. Er schritt zufrieden aus, glücklich wie immer unter dem Tosen des Wassers und auch darüber, dass er nach dreiundzwanzig Jahren die Akte des Mörders von Le Havre schließen konnte. Er sah, wie die Statue von Jeanne d’Arc den Schauer standhaft über sich ergehen ließ. Jeanne tat ihm leid, er hätte es gehasst, Stimmen zu hören, die ihm befahlen, dies zu tun und dahin zu gehen. Er, der schon Mühe hatte, seinen eigenen Anweisungen zu folgen, ja sie überhaupt zu erkennen, hätte sich den Befehlen himmlischer Stimmen entschieden widersetzt. Stimmen, die ihn nach einem lichtvollen heroischen Abenteuer von kurzer Dauer in eine Löwengrube geworfen hätten, denn solche Geschichten enden immer böse. Dagegen hatte Adamsberg nichts gegen das Aufsammeln von Kieselsteinen, die der Himmel ihm aus Gefälligkeit auf den Weg legte. Es fehlte ihm einer für die Brigade und er suchte danach.
Als er nach den fünf Wochen Zwangsurlaub, die der Divisionnaire angeordnet hatte, von seinen Pyrenäengipfeln heruntergestiegen und wieder in die Pariser Brigade zurückgekehrt war, hatte er ungefähr dreißig graue, vom Fluss glatt geschliffene Steine mitgebracht, die er auf die Tische seiner Mitarbeiter gelegt hatte, als Briefbeschwerer oder nach Belieben auch zu anderer Verwendung. Schlichte Gabe, die keiner abzulehnen wagte, nicht einmal diejenigen, die keine Lust hatten, einen Stein auf ihrem Tisch liegen zu haben. Eine Gabe, die allerdings nicht erklärte, warum der Kommissar zugleich einen goldenen Ehering mitgebracht hatte, der an seinem Finger glänzte und von Tür zu Tür die Funken der Neugier sprühen ließ. Wenn Adamsberg geheiratet hatte, weshalb hatte er dann seiner Mannschaft nichts davon gesagt? Und vor allem: wen geheiratet und warum? Entschlossenen Schritts die Mutter seines Sohnes? Unnatürlicherweise seinen Bruder? In mythischem Sinne einen Schwan? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um Adamsberg handelte, wurden sämtliche Möglichkeiten in Betracht gezogen und raunend von Schreibtisch zu Schreibtisch, von Stein zu Briefbeschwerer weitergesagt.
Was die Klärung dieses Punkts anging, verließ man sich ganz auf Commandant Danglard, einerseits weil er am längsten Adamsbergs Kollege war und zu ihm in einer Beziehung stand, die frei von Scham und Vorsicht war, andererseits weil Danglard sogenannte »Fragen ohne Antwort« nicht ertrug. Fragen ohne Antwort, die sich einfallen ließen, wie Löwenzahn aus dem Humus des Lebens zu sprießen, sich in eine Myriade von Ungewissheiten verwandelten, eine Myriade, die seine Angst nährte, Angst, die sein Leben zerrüttete. Danglard arbeitete unablässig an der Vernichtung solcher Fragen ohne Antwort, genau wie ein Besessener seine Jacke nach Staubkörnchen absucht und sie entfernt. Eine Titanenarbeit, die meistens in eine Sackgasse führte und die Sackgasse in die Ohnmacht. Ohnmacht, die ihn in den Keller der Brigade trieb, in dem wiederum seine Flasche Weißwein stand, welche ihrerseits als Einzige imstande war, eine allzu hartnäckige Frage ohne Antwort aufzulösen. Dass Danglard seine Flasche so weit weg versteckt hatte, geschah nicht aus Furcht, Adamsberg könnte sie entdecken, der Kommissar wusste sehr wohl von dieser geheimen Tatsache, fast hätte man meinen können, er höre Stimmen. Doch die Wendeltreppe des Kellers hinunter- und wieder hinaufzusteigen, war ihm ganz einfach beschwerlich genug, um den Genuss seines Lösungsmittels auf später zu verschieben. So knabberte er denn geduldig an seinen Zweifeln herum wie auch auf den Enden seiner Bleistifte, an denen er einen Verschleiß wie ein Nagetier hatte.
Adamsberg entwickelte eine dem Knabbern entgegengesetzte Theorie, indem er davon ausging, dass die Summe der Ungewissheiten, die ein einzelner Mensch auf einmal zu ertragen imstande sei, nicht unendlich groß werden könne und die Obergrenze bei drei bis vier gleichzeitigen Ungewissheiten liege. Was nicht hieß, dass es keine weiteren gab, sondern dass nur drei bis vier in einem menschlichen Gehirn in Umlauf sein konnten. Dass also Danglards Manie, sie ausrotten zu wollen, ihm rein gar nichts nützte, denn sobald er zwei abgetötet hatte, wurde der Platz sofort für zwei gänzlich neue Fragen frei, auf die er nie gekommen wäre, wenn er die Weisheit besessen hätte, die alten einfach zu ertragen.
Danglard lehnte diese Hypothese ab. Er hatte Adamsberg in Verdacht, die Ungewissheit bis zur Erstarrung zu lieben. Sie so sehr zu lieben, dass er sie von sich aus schuf, dass er die klarsten Aussichten vernebelte, rein aus dem Vergnügen, sich verantwortungslos darin zu verlieren, wie wenn er im Regen spazieren ging. Wenn man etwas nicht wusste, wenn man überhaupt nichts wusste, wozu sich dann aufregen?
Das ständige Ringen zwischen Danglards klarem »Warum?« und dem unbekümmerten »Ich weiß nicht« des Kommissars bestimmte den Rhythmus bei den Ermittlungen der Brigade. Keiner versuchte das Wesen dieses erbitterten Kampfes zwischen Schärfe und Ungenauigkeit zu verstehen, aber jeder schloss sich der Geisteshaltung des einen oder des anderen an. Die einen, die Positivisten, meinten, Adamsberg zöge die Ermittlungen in die Länge, treidelte sie sehnsuchtsvoll durch Nebelschwaden, wobei er seine verirrten Mitarbeiter ohne Marschbefehl und Anweisungen hinter sich ließ. Die anderen, die Wolkenschaufler – so genannt in Erinnerung an eine traumatische Reise der Brigade nach Québec** –, waren der Ansicht, dass die Ergebnisse des Kommissars genügten, um vor sich hin tuckernde Ermittlungen zu rechtfertigen, auch wenn sie selbst das Wesentliche der Methode nicht begriffen. Je nach Laune, je nachdem, ob die Zufälligkeiten des Augenblicks mehr die Nervosität oder mehr die Langmut förderten, konnte man an einem Morgen Positivist sein und am nächsten Wolkenschaufler und umgekehrt. Nur Danglard und Adamsberg, die beiden gegensätzlichen Titelverteidiger, veränderten niemals ihre Position.
Unter den harmlosen Fragen ohne Antwort glänzte noch immer der Ehering am Finger des Kommissars. Danglard wählte diesen Regentag, um Adamsberg schlicht mit einem Blick auf den Ring zu befragen. Der Kommissar zog seine durchnässte Jacke aus, setzte sich schräg hin und streckte seine Hand aus. Diese Hand, zu groß für seinen Körper, an deren Gelenk schwer zwei Uhren hingen und die nun außerdem mit diesem goldenen Ring geziert war, passte nicht zu seiner übrigen Kleidung, die er bis auf das Notdürftigste vernachlässigte. Man hätte sie für die geschmückte Hand eines einstigen Adligen halten können, die am Körper eines Bauern befestigt war, verschwenderische Eleganz, die an der dunklen Haut des Bergmenschen hing.