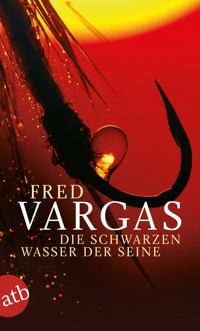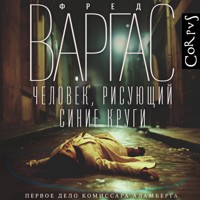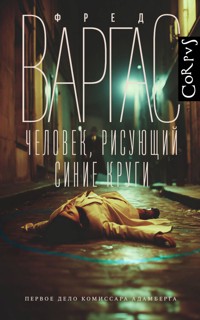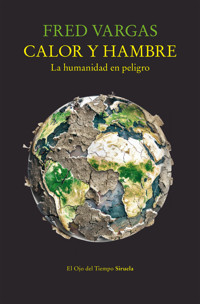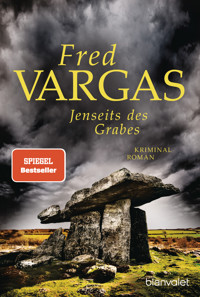
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Adamsberg ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein Dorf voller verschrobener Gestalten, ein Mörder, der perfide Fährten legt und ein Geheimnis so abgründig, dass nur Kommissar Adamsberg es lüften kann ...
In einem kleinen Ort in der Bretagne, gehen merkwürdige Dinge vor sich: Ein Wildhüter wird mit einem kostbaren Messer in der Brust tot aufgefunden. In der Nacht zuvor wollen die Alten des Dorfes den hinkenden Schritt eines Geistes gehört haben, der immer dann erklingt, wenn Unheil bevorsteht. Als Adamsberg, der legendäre Kommissar, von dem Fall Wind bekommt, ist er nicht mehr zu halten: Er steigt in die Ermittlungen ein, und sofort fallen ihm drei Flohbisse an der Leiche auf, ein Detail, das sonst niemand gesehen hat. Noch ahnt er nicht, dass dies nur der Auftakt ist zu einer Mordserie, die das Dorf erschüttern wird…
»Ein Meisterstück.« Aachener Zeitung
Lesen Sie auch die anderen Bände der Reihe um Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
AUTORIN
Fred Vargas, geboren 1957, ist ausgebildete Archäologin und hat Geschichte studiert. Sie ist heute die bedeutendste französische Kriminalautorin mit internationalem Renommee. 2004 erhielt sie für »Fliehe weit und schnell« den Deutschen Krimipreis, 2012 den Europäischen Krimipreis für ihr Gesamtwerk und 2016 den Deutschen Krimipreis in der Kategorie International für »Das barmherzige Fallbeil«.
Alle unabhängig voneinander lesbaren Bände der Kommissar-Adamsberg-Reihe:
Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord
Bei Einbruch der Nacht
Fliehe weit und schnell
Der vierzehnte Stein
Die dritte Jungfrau
Der verbotene Ort
Die Nacht des Zorns
Das barmherzige Fallbeil
Der Zorn der Einsiedlerin
Jenseits des Grabes
Fred Vargas
Jenseits des Grabes
Kriminalroman
Aus dem Französischen von Claudia Marquardt
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Sur la dalle« bei Flammarion, Paris.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Penguin Random House Verlagsgruppe FSC® N001967
Copyright der Originalausgabe © 2023 by Fred Vargas & Éditions Flammarion, Paris
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 bei Limes, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Übersetzung: Claudia Marquardt
Redaktion: Michaela Kolodziejcok
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
KW · Herstellung: DiMo
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31634-1V004
www.limes-verlag.de
I
Gardon, der Rezeptionist des Kommissariats im 13. Pariser Arrondissement, gewissenhaft bis hin zur Pedanterie, bezog Punkt 7.30 Uhr seinen Posten. Er beugte den Kopf zu dem Ventilator auf seinem Schreibtisch vor, um sich wie gewohnt die Haare zu trocknen, was ihm erlaubte, Kommissar Adamsberg schon von Weitem mit sehr langsamen Schritten herannahen zu sehen. Auf den ausgestreckten Unterarmen, die Handflächen zum Himmel gerichtet, transportierte der Kommissar ein nicht zu identifizierendes Objekt, so behutsam, als handelte es sich um eine Kristallvase. Gardon – dieser wie auf sein Amt zugeschnittene Name hatte ihm schon eine Menge Witze eingebracht – war nicht unbedingt für seine schnelle Auffassungsgabe bekannt, kam seiner Mission jedoch mit geradezu übertriebenem Eifer nach. Diese bestand darin, jeden Anflug einer Seltsamkeit sofort zu erkennen und das Kommissariat davor zu schützen. Eine Aufgabe, die er dank seines durch lange Dienstjahre geschulten Blicks und der überraschenden Geschwindigkeit seiner Reflexe meisterhaft erfüllte. Nicht jeder, der wollte, durfte in das Allerheiligste, die Brigade criminelle, vordringen, man musste schon eine schneeweiße Pfote vorweisen, um den Zerberus dieses Ortes – nicht eben eine imposante Erscheinung – dazu zu bringen, das Schutzgitter vorm Eingang zu heben. Trotzdem wäre niemand auf die Idee gekommen, Gardons obsessiven Argwohn zu kritisieren, denn mehr als einmal hatte er die kaum sichtbaren Ausbuchtungen unter der Kleidung eines Besuchers als eine versteckte Waffe erkannt oder einem allzu geschmeidigen Auftreten misstraut und damit finsteren Absichten Einhalt geboten. Meistens wollten die Eindringlinge jemanden aus der Untersuchungshaft befreien, manchmal aber ging es auch um nicht weniger, als Adamsberg zur Strecke zu bringen. Zwei Versuche in fünfundzwanzig Monaten. Mit den Jahren und Ermittlungserfolgen des Kommissars in den abstrusesten Fällen hatte sich sein Ruf gefestigt und zugleich hatten die Morddrohungen gegen ihn zugenommen.
Adamsberg scherte sich nicht um die Gefahr, er ging weiterhin zu Fuß zur Brigade, beseelt von einer natürlichen Gemütsruhe, die oft mit Nachlässigkeit, wenn nicht sogar Gleichgültigkeit verwechselt wurde. Dieser Wesenszug an ihm verunsicherte die Mitglieder seines Teams, er trieb sie mitunter auch zur Verzweiflung, obwohl sie nicht zimperlich waren. Auch erschienen viele der Erfolge des Kommissars dadurch rätselhaft, Erfolge, die er mit undurchsichtigen Methoden erzielt hatte – sofern man bei Adamsberg überhaupt von »Methode« sprechen konnte – und auf Umwegen, die sich nur wenigen Menschen erschlossen. Doch ganz gleich, ob er das Ziel aus den Augen zu verlieren schien, man folgte ihm wohl oder übel in die unbegreiflichen Verästelungen seiner Ermittlungen. Wenn seine Leute – allen voran Commandant Danglard – ihm vorwarfen, sie im Nebel stochern zu lassen, breitete er die Arme in einer Geste der Hilflosigkeit aus, denn meistens konnte er sich sein Vorgehen selbst nicht erklären. Adamsberg gehorchte einem völlig eigenen Kompass.
Als sein Chef nur noch wenige Meter von der Treppe des alten Gebäudes entfernt war, öffnete Gardon sein Fenster und beobachtete, wie Adamsberg einen kurzen Gruß an die beiden Damen richtete, die zwanzig Schritte hinter ihm gingen, zwei eilige Geschäftsfrauen, konnte man meinen, tatsächlich waren es zwei Scharfschützinnen, die den Kommissar auf Schritt und Tritt begleiteten. Adamsberg lächelte. Er wusste, dass er diese jüngste Maßnahme der aufmerksamen Fürsorge des Commandant verdankte, ebenso wie das Auto, das nachts vor dem kleinen Garten, der sein Haus umgab, Wache hielt.
»Gardon«, sagte er, ohne Anstalten zu machen, das Gebäude zu betreten, und mit immer noch ausgestreckten Armen, »ich komme heute ein wenig später, ich habe noch etwas zu erledigen. Geben Sie das bitte weiter, falls jemand nach mir fragt. Was mich allerdings wundern würde, momentan ist niemand in krimineller Laune, wir schlagen uns mit lauter amateurhaften Einbrüchen herum.«
»Das liegt am Klima, Kommissar, an dieser anormalen Hitze mitten im April. Sie zerstört nicht nur den Planeten, sie trocknet auch den Mördern das Hirn aus.«
»Wenn Sie es sagen, Gardon.«
»Was tragen Sie da mit sich herum?«, fragte der Rezeptionist und starrte auf die rote Kugel auf Adamsbergs Armen.
»Ein Opfer, Gardon, und es ist mein Job, mich darum zu kümmern.«
»Wie weit haben Sie es denn noch? Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie mit nacktem Oberkörper herumlaufen, Kommissar.«
»Das ist mir bewusst, Brigadier. Ich habe höchstens zehn Minuten Fußweg vor mir. Keine Sorge.«
Wie immer, dachte Gardon mit großer Nachsicht gegenüber seinem Vorgesetzten, als er das Fenster wieder schloss. Die Leute werden sich das Maul über ihn zerreißen und ihm ist das total egal. Er, Gardon, hätte sich so etwas nie getraut, aber er war schließlich auch bleich und trug einen dicken Bauch vor sich her, während der Kommissar bei all seiner Schlankheit einen kräftigen Oberkörper und starke Muskeln hatte, vor denen man sich besser in Acht nahm.
Tatsächlich lag die eigentliche Hitzeperiode noch in weiter Ferne, doch seit einer Woche brach das Thermometer Rekorde, die nichts Gutes für die Zukunft verhießen. Nach und nach tröpfelten die Beamten mit hochgekrempelten Hemdsärmeln in der Brigade ein, zeigten sich zwar besorgt wegen des Klimas, genossen aber dennoch die ungewöhnlich milde Luft.
Zurück von seinem morgendlichen Einsatz, hatte der Kommissar mit nacktem Oberkörper das Großraumbüro durchquert, seinen Mitarbeitern, die ihm verblüfft nachsahen, einen Gruß zugeworfen und sich aus dem Schrank in seinem Büro eines seiner ewigen schwarzen T-Shirts genommen. Seine Kleidung variierte nie, er fand es einfacher, immer das Gleiche zu tragen, ganz im Gegensatz zu Commandant Danglard, der auf die Eleganz der englischen Mode setzte, wahrscheinlich um von seiner ansonsten recht reizlosen Erscheinung abzulenken.
Adamsberg saß auf seinem Schreibtisch vor einer aufgeschlagenen Zeitung und wandte nicht einmal den Kopf, als sein Stellvertreter das Büro betrat, er war vollauf damit beschäftigt, sich die Hände und Arme mit einer beißend riechenden Flüssigkeit einzureiben.
»Neues Eau de Toilette?«, fragte der Commandant.
»Nein, ein vorbeugendes Mittel gegen Krätze und Ringelflechte. Er war davon befallen, ist ein ziemlich weitverbreitetes Phänomen. Und da ich das wusste, habe ich ihn vorsichtshalber mit meinem T-Shirt aufgehoben, aber die Tierärztin hat mir trotzdem eine Desinfektion verordnet.«
»Wer denn ›er‹?«, hakte Danglard nach, obwohl man annehmen sollte, dass der Gewöhnungseffekt ihn allmählich gegen die Sonderbarkeiten des Kommissars abstumpfen ließ.
»Na, der Igel. Irgendein Schweinehund hat ihn überfahren, ich habe es aus der Ferne beobachtet, und glauben Sie, der Typ hätte angehalten? Natürlich nicht. Aber wenn es nicht so viele Schurken auf der Welt gäbe, säßen wir nicht hier. Ich bin sofort zum Tatort …«
»Tatort?«
»Ganz genau. Der Igel ist eine geschützte Tierart, das muss ich Ihnen ja wohl nicht erklären. Lässt Sie das etwa kalt?«
»Keineswegs«, erwiderte der Commandant. Aufmerksam wie kein anderer verfolgte er jede die Umwelt betreffende Nachricht, was seine angeborene Angst nur noch verstärkte. »Und dann?«
»Dann habe ich den Kleinen vom Asphalt aufgelesen, er war in einer miserablen Verfassung, die Stacheln hingen herunter, er konnte sich nicht mehr verteidigen.«
»Vielleicht war ihm klar, dass er einen neuen Freund gefunden hatte«, bemerkte der Commandant mit einem leichten Lächeln.
»Warum nicht, Danglard. Jetzt, wo Sie es sagen, bin ich mir sogar sicher, dass er es spürte. Sein Herz hat noch geschlagen, aber an einer Seite war er wirklich übel zugerichtet und blutete. Deshalb habe ich ihn zu der Tierärztin an der Hauptstraße getragen. Ein absolut liebenswertes Geschöpf.«
»Der Igel?«
»Nein, die Tierärztin. Sie hat den Igel eingehend untersucht und sagte, sie hoffe, ihn wieder auf die Beine bringen zu können. Glücklicherweise ist es ein Männchen, es warten also keine Jungen auf ihn, die gesäugt werden wollen. Wenn er erst mal wieder fit ist, bringe ich ihn in das Wäldchen zurück, das so tapfer unseren Sünden standhält. Falls ich übrigens nachher nicht da sein sollte, Danglard, könnten Sie dann für mich einspringen?«
»Wieso sollten Sie nicht da sein?«
Adamsberg tippte auf die vor ihm ausgebreitete Zeitung.
»Deswegen«, sagte er.
»Mir ist nichts Besonderes in der Presse aufgefallen.«
»Doch«, sagte Adamsberg und deutete mit dem Finger auf eine Kurzmeldung. »Schauen Sie, hier.« Er schob die Zeitung zu seinem Stellvertreter hinüber.
Während Danglard ratlos die Meldung studierte, rief der Kommissar Lieutenant Froissy an.
»Gerade frei, Froissy?«
»Nie, worum geht’s?«
»Könnten Sie mir ein Exemplar von Frankreich im Westen besorgen? Ich glaube, die gibt es unten am Kiosk.«
»Schon unterwegs. Ich bringe Ihnen ein Croissant mit, Sie haben bestimmt noch nichts gegessen.«
Sie würde mindestens vier mitbringen, dachte Adamsberg, als er auflegte. Andere zu verpflegen, zählte zu Froissys zwanghaften Befriedigungen, sie lebte in der ständigen Furcht, es könnte ihr oder anderen »an etwas fehlen«. Tatsächlich stand sie eine Viertelstunde später mit einem prall gefüllten Beutel in der Tür, setzte Kaffee auf und servierte ihren beiden Kollegen ein komplettes Frühstück.
»Aber inwiefern betrifft uns die Angelegenheit?«, fragte Danglard, nachdem er die Zeitung zusammengefaltet hatte, und brach sich fein säuberlich ein Stück Croissant ab.
»Eben weil sie uns so gar nicht betrifft, Commandant. Ah, Frankreich im Westen berichtet etwas ausführlicher über den Vorfall. Danke, Froissy.«
Adamsberg las den Artikel langsam und mit leiser Stimme vor, Danglard musste dicht an ihn herantreten, um überhaupt etwas zu verstehen.
»Sehen Sie«, schloss Adamsberg und trank in hastigen Zügen seinen Kaffee aus.
»Sie werden sie ins Elend stürzen, wenn Sie nicht wenigstens ein Croissant essen.«
»Sie haben völlig recht. Froissy ist ohnehin schon so ein Nervenbündel, da will ich ihr nicht noch zusätzlichen Stress bereiten.«
»Ich sehe lediglich, dass in einem bretonischen Dorf ein Mord geschehen ist.«
»In Louviec, Danglard, in Louviec, vorgestern Abend, am 18. April. Das ist neun Kilometer von Combourg entfernt, ich habe dort in einem alten Gasthof zu Abend gegessen. Im selben wie das Opfer, Gaël Leven. Er war der Wildhüter, ein Kerl, so robust wie ein bretonischer Felsen und breit wie ein Schrank.«
»Und Sie haben ihn bei der Gelegenheit kennengelernt?«
»Nein, gar nicht. Er saß in einer Gruppe an einem anderen Tisch, ich habe mit halbem Ohr gelauscht, worüber sie sich unterhielten, das Gespräch drehte sich um das Gespenst im Schloss Combourg. Ich nehme an, Sie wissen, wovon ich rede?«
»Von Malo-Auguste de Coëtquen, Graf von Combourg, genannt ›der Hinkende‹, da er 1709, in der Schlacht von Malplaquet, ein Bein einbüßte, das anschließend durch eine Holzprothese ersetzt wurde«, betete Danglard herunter, als handelte es sich um das kleine Einmaleins. »Das Schicksal will es, dass dieses Holzbein bis heute in Begleitung einer schwarzen Katze im Schloss Combourg herumspukt.«
»Wusste ich’s doch«, sagte Adamsberg und fragte sich, ob sein Stellvertreter nicht mit drei geschickt verborgenen Zusatzgehirnen ausgestattet war.
Danglards Gelehrsamkeit war in der Tat kolossal, sie reichte von den Geisteswissenschaften bis zu den Künsten, von den Künsten bis zur Geschichte, von der Geschichte bis zur Architektur und so weiter, einzig die Mathematik und die Physik setzten ihr Grenzen. Dass der Commandant über einen unermesslichen Wissensschatz und ein phänomenales Gedächtnis verfügte, auf das auch er schon etliche Male zurückgegriffen hatte, war für den Kommissar nichts Neues. Dennoch gelang es Danglard immer wieder, ihn zu überraschen. Denn wer außerhalb von Combourg hatte jemals den Namen Malo-Auguste de Coëtquen gehört? Einen Namen, den Adamsberg, kaum gehört, gleich wieder vergessen hatte. Er war als eines von vielen Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen in einem abgelegenen pyrenäischen Dorf aufgewachsen und hatte von zu Hause nur eine eingeschränkte Bildung mit auf den Weg bekommen. Dass er außerdem im Unterricht mehr gezeichnet als zugehört hatte, machte die Sache nicht besser. Als er die Schule mit sechzehn verließ und seine Ausbildung zum Polizisten begann, verfügte er über höchstens rudimentäre Kenntnisse. Aber es störte ihn nicht, dass Danglards Wissen tausendmal umfassender war als sein eigenes. Im Gegenteil, er gab seine Unwissenheit ohne Scham zu, staunte und bewunderte.
»Ja, Danglard, über genau diesen Hinkenden unterhielten sie sich. Der nachts im Schloss Combourg die Treppen rauf- und runterläuft und sich gelegentlich zur Sommerfrische nach Louviec begibt. Und nun stellen Sie sich vor, seit einigen Wochen hält er sich wieder dort auf, nach vierzehnjähriger Abwesenheit hört man in der Nacht wieder sein Holzbein auf die Pflastersteine schlagen.«
»Und was hat er vor vierzehn Jahren angerichtet, außer allen einen Schrecken einzujagen?«
»Ein Verbrechen, Danglard, angeblich die Tat eines Herumtreibers. Aber viele waren damals überzeugt, dass der Hinkende dahintersteckte, dass er nach Louviec gekommen war, um zu morden. Weshalb man in den letzten Wochen fürchtete, seine Rückkehr könne einen neuen Mord ankündigen. Und nun ist es passiert.« Adamsbergs Finger trommelten auf der Zeitung. »Der Artikel greift die Legende auf, um darüber zu spotten, aber ich gehe jede Wette ein, dass in Louviec die Nerven blank liegen. Es ist so leicht, nicht wahr, aus der Ferne zu lachen. Aber diesmal ist es kein Verbrechen eines Herumtreibers. Gaël Leven, der stärkste Mann im Dorf, kam gerade aus dem Gasthof, als jemand ihn mit zwei Messerstichen in die Brust niederstreckte. Das war kein Raubüberfall, Commandant, sein Geld hatte der Tote noch bei sich.«
Danglard nickte, er dachte kurz nach.
»Ich gehe davon aus, dass jemand die Gelegenheit der Rückkehr des Hinkenden nutzte, um eine persönliche Rechnung mit diesem Gaël zu begleichen. Ich begreife trotzdem nicht, wieso diese Geschichte Sie dermaßen fasziniert.«
»Ich weiß es nicht, Danglard«, brachte Adamsberg es auf seine ewige Formel.
»Dann werde ich es Ihnen verraten: weil Sie vor einem Monat in Combourg und Louviec waren, und das reicht, damit Sie sich ohne jeden Grund angesprochen fühlen.«
Wie so oft schwang in Danglards Stimme Missbilligung mit.
»Ohne jeden Grund, Danglard, ganz genau.«
II
In der Tat hatte Kommissar Adamsberg einen Monat zuvor seine Befugnisse auf Danglard übertragen und morgens um acht in aller Eile seine Tasche gepackt, um nach Combourg in die Bretagne zu fahren, eine Gegend, die er kaum kannte. Ein paar Kollegen beneideten ihn um das unvergleichliche, sich in jedem Sandkorn brechende Licht, das ihn an der Küste erwartete. Der eine empfahl ihm einen Abstecher nach Saint-Malo, der nächste Spaziergänge an den noch wilden Stränden. Danglard hingegen wusste, dass dieser kurze Aufenthalt für den Kommissar alles andere als ein Fest war. Die Besprechung, zu der er fuhr, markierte das Ende einer monatelangen kräftezehrenden Jagd auf einen wahnsinnigen Mörder, der fünf sechzehnjährige Mädchen vergewaltigt und grausam ermordet hatte. Der Fall zog jede Menge Papierkram nach sich, und den verabscheute Adamsberg. Teilnehmen würden auch die vier anderen Kommissare, die unter seiner Leitung die Verfolgungsjagd organisiert und ihn hinter vorgehaltener Hand als zu langsam oder sogar träge bezeichnet hatten. Doch am Ende mussten sie zugeben: Er war es gewesen, der in den ungleichen Schnittwunden der Leichname ein Muster erkannt und darüber die Verbindung zwischen den fünf Opfern hergestellt hatte, die sich über den gesamten Nordwesten des Landes verteilten, was die Suche auf einen einzigen Mörder eingrenzte. Er hatte die einsamen Waldgebiete um Angers, Le Mans, Tours, Evreux und Combourg durchkämmt und rund um die Fundorte jeden Stein umgedreht. Er hatte aus einer sehr feinen Blutspur, die nicht zu den Schnittwunden passte, geschlossen, dass der Handschuh des Mörders an einer Stelle eingerissen sein musste, und um einen genetischen Abgleich gebeten. Das Ergebnis: keine Übereinstimmung in der Datenbank. Anschließend hatte er eine vollständige Liste aller Unternehmen der Region Nord-West verlangt, die Handelsvertreter und Fernfahrer beschäftigten, egal ob sie Bücher oder Teller verkauften. Und er hatte dafür gesorgt, dass das Personal in den Gendarmerien und Kommissariaten vor Ort aufgestockt wurde, damit allen männlichen Angestellten im Außendienst eine DNA-Probe entnommen werden konnte. Siebenhundertdreiundvierzig Proben waren bereits analysiert worden, als Adamsbergs Partner ihn drängten, die mühselige und aussichtslose Suche abzubrechen. Zwei Tage später lag das erhoffte Resultat auf dem Tisch und versetzte in seiner Unwahrscheinlichkeit das gesamte Ermittlerteam in Erstaunen. Man hatte den Kerl in seiner Wohnung in Fougères verhaftet – deshalb sollte die abschließende Konferenz im nahe gelegenen Combourg stattfinden. Der Mann entpuppte sich als durch und durch gewöhnlich, man musste schon zehnmal hingucken, um ihn auf der Straße wiederzuerkennen: ein dicklicher Familienvater von dreiundfünfzig Jahren mit Glatze, roten Wangen und einem völlig nichtssagenden Gesicht, das Vertrauen einflößte. Bestimmt hatten diese fünf Mädchen, so unvorsichtig es war, dass sie per Anhalter reisten, einen Blick auf den Fahrer geworfen, ehe sie eingestiegen waren. Und was wirkt harmloser als ein dicker, allem Anschein nach gutmütiger und väterlicher Glatzkopf?
Und die Erinnerung an den Anblick der jungen, verzerrten Gesichter der Mädchen und ihrer aufgeschlitzten Körper ließ Adamsberg bei seinem Aufbruch nach Combourg nicht los. Sie würden den gemeinsamen Abschlussbericht in Anwesenheit des Präfekten des Departements Ille-et-Vilaine erarbeiten, der ihm dann auch noch feierlich irgendeinen Verdienstorden verleihen wollte. Im Unterschied zu seinen Kollegen ahnte Danglard, dass es passendere Momente als diesen gab, um dem sonst für Schönheit so empfänglichen Kommissar den im Sonnenlicht glitzernden bretonischen Quarzsand anzupreisen – nichts interessierte Adamsberg in dem Augenblick weniger als dieser Sand. Deshalb zügelte der Commandant, was ihn einige Mühe kostete, seine sagenhafte Gelehrsamkeit und ersparte dem Kommissar Ausführungen zur Geschichte von Combourg, zu der beeindruckenden mittelalterlichen Festung und dem Mann, der dort seine Jugend verbracht hatte: dem Schriftsteller François-René de Chateaubriand, der noch hundertfünfundsiebzig Jahre nach seinem Tod den Ruhm der zur »Wiege der Romantik« erklärten Stadt sicherstellte. Tapfer beschränkte er sich darauf, Adamsberg die einhundertzwanzig Seiten Bericht zu überreichen, die er in seinem Namen zu Papier gebracht hatte. In den vielen Jahren ihrer Zusammenarbeit hatten sie sich stillschweigend darauf geeinigt, dass das Verfassen von Dokumenten dieser Art in Danglards Kompetenzbereich fiel. Der Kommissar besaß in diesen Dingen keinerlei Talent, während der Commandant für die Literatur und das geschriebene Wort leidenschaftlich glühte – Danglard konnte sich für das erlesenste Werk über die Buchmalerei ebenso begeistern wie für einen schlichten Verwaltungsbericht. Und er war mit einem bemerkenswerten Stil gesegnet, den er glaubwürdig an die unbeholfene Bürokratensprache anzupassen verstand, die man von einem Polizisten und speziell von Adamsberg erwartete. Vor allem aber brachte er die Daten und Fakten in eine thematische und logische Reihenfolge, wozu der Kommissar beim besten Willen nicht imstande war.
Als Adamsberg ohne Eile über die Autobahn Richtung Rennes fuhr – nur wenige Menschen hatten ihn je in Eile oder ungeduldig erlebt –, dachte er, dass er sich allein auf das Wiedersehen mit Franck Matthieu freute, dem Kommissar von Combourg, mit dem er tagelang das Waldgebiet um den Fundort der jungen Lucile erkundet hatte, der letzten Toten in dieser schrecklichen Serie, auf deren Körper sich die kleine, alles entscheidende Blutspur fand. Er und Matthieu hatten sich, so unterschiedlich sie waren, nahezu auf Anhieb gut verstanden, während der Kommissar von Angers die ganze Zeit in trotziger Distanz verharrte. Matthieu war Adamsberg, den man ihnen aus Paris geschickt und vor die Nase gesetzt hatte, ohne Vorbehalte oder eifersüchtige Verachtung begegnet. Auch nicht mit übertrieben guter Laune, sondern mit einer natürlichen, unaufdringlichen Offenheit. Es ging kein Funken Herablassung von ihm aus, dabei tat man Adamsberg in den Provinzkommissariaten gern als überschätzten Träumer oder Faulpelz ab. Ein kanadischer Kollege hatte ihn einmal als »Wolkenschaufler« bezeichnet und damit einen Spitznamen geschaffen, den man in der Pariser Brigade zwar sparsam, aber je nach Sachlage durchaus aufgriff. Matthieu hatte Adamsbergs Effizienz nie angezweifelt, ebenso wenig wäre es Adamsberg in den Sinn gekommen, Matthieus Qualitäten zu hinterfragen. Sicher, der Kommissar aus Combourg – eigentlich aus Rennes, aber Combourg unterlag seiner Zuständigkeit – war gelegentlich Zeuge der schweigsamen und zerstreuten Abschweifungen seines Pariser Kollegen gewesen, auch hatte er Bemerkungen aufgeschnappt, die in keinem offenkundigen Zusammenhang mit den Ermittlungen standen. Zugleich aber hatte Adamsberg ihn mit seiner Aufmerksamkeit für Details und seinem sensationellen visuellen Gedächtnis überrascht. Es hatte beispielsweise keiner Fotos bedurft, damit er sich an die Anordnung der zahlreichen Schnittwunden auf den Leichen erinnerte.
Es fiel Adamsberg auch jetzt nicht schwer, sich Matthieus Gesicht und Mimik zu vergegenwärtigen, er sah dessen runden Bretonenschädel mit den blonden Haaren und den kleinen blauen Augen präzise vor sich – typische Keltenvisage, hätte Danglard gesagt. Matthieu strahlte etwas Wohlwollendes aus, an das Adamsberg sich immer wieder klammerte, um die makabren Ereignisse der letzten Wochen, die ihm ebenfalls sehr deutlich, viel zu deutlich vor Augen standen, zu verdrängen.
Zehn Minuten vor Sitzungsbeginn lenkte er seinen Wagen auf den Parkplatz der Gendarmerie von Combourg. Das einschläfernde, rein administrative Treffen zog sich wie befürchtet über zwei Stunden hin. Am Ende wurde ihm erwartungsgemäß die Aufgabe zuteil, sämtliche Einzelberichte in einen Kollektivbericht zu verwandeln. Stoisch nahm er die Akten seiner vier Kollegen entgegen und ließ sie, zusammen mit der glänzenden Medaille, die ihm der Präfekt überreicht hatte, in seiner Tasche verschwinden. Als er ins Freie trat, war er zu betäubt, um die herrliche bretonische Luft zu genießen. Er sah sich nach Matthieu um, der nicht minder ermattet auf ihn zukam.
»Dieser ganze bürokratische Scheiß«, stöhnte Matthieu.
»Und der elende Papierkram«, ergänzte Adamsberg, hob seine schwerer gewordene Tasche hoch und lobpreiste Danglard, der sich der lästigen Pflicht annehmen würde. »Vierhundertdreißig Seiten, die neu gegliedert und gebündelt werden müssen. Wir sollten uns vorher unbedingt noch eine schöne Ablenkung gönnen. Ich weiß, du wohnst in Rennes, aber du kennst doch bestimmt dieses Schloss in Combourg?«
»Klar«, sagte Matthieu nach einem kurzen verblüfften Innehalten. »Welcher Bretone kennt es nicht? Hast du es dir nicht angesehen, als wir zusammen in Brissac gearbeitet haben? Du hättest nur sieben Kilometer weiter gemusst.«
Adamsberg zuckte mit den Schultern.
»Hab ich wohl verpasst. Und jetzt hängen mir meine Kollegen seit Tagen damit in den Ohren. Mein zweiter Auftrag für heute lautet: Schlossbesichtigung in Combourg. Anscheinend ist das ein Muss, keine Ahnung, warum.«
»Komm«, Matthieu packte ihn am Arm, »du wirst es sofort kapieren. Wir schauen es uns an und dann gehen wir einen trinken.«
»Gute Idee«, sagte Adamsberg und hängte sich die Tasche über die Schulter.
Matthieu setzte ihn in der Straße gegenüber dem Schloss ab. »Ich bin in zehn Minuten wieder da«, sagte er und verschwand zu Fuß in Richtung Stadtzentrum.
Als Kommissar Matthieu zwölf Minuten später zurückkehrte, stand Adamsberg wie angewurzelt an derselben Stelle und ließ seinen Blick über die Zinnen der mächtigen mittelalterlichen Festung schweifen, die hoch über der von Wäldern umgebenen Stadt thronte. Vielleicht beobachtete er aber auch die Wolken, die langsam an den Dächern der Türme vorüberzogen. Matthieu postierte sich neben ihn, in der Hand hielt er ein kleines Buch.
»Ich verstehe, warum die Kollegen so insistiert haben«, raunte Adamsberg ihm zu, als geböte die eindrucksvolle, düstere Strenge des alten Gemäuers, die Stimme zu senken.
»Und nun stell dir den armen Jungen vor, der von seinem niederträchtigen Vater gezwungen wurde, sich allein in dem am weitesten entfernten Turm schlafen zu legen. Abend für Abend schlotterten ihm die Knie, wenn er ohne Begleitung, nur mit einer Kerze in der Hand, den schmalen Korridor entlanglief, um zu seinem Zimmer am anderen Ende des Schlosses zu gelangen. Er schrieb später, dass der despotische und grausame Vater ihn manchmal vor dem Zubettgehen fragte: ›Der Chevalier hat doch nicht etwa Angst?‹ Und fügte hinzu: ›Wie er das zu mir sagte, hätte ich mich auch neben einen Toten gelegt.‹ Da war er acht Jahre alt. Armer Junge.«
»Von welchem Jungen redest du?«
Matthieu zögerte kurz.
»Du weißt nicht, wer hier aufgewachsen ist?«
»Welchen Verdienstorden kriegt man, wenn man es nicht weiß?«, fragte Adamsberg lächelnd.
Das seltsam schiefe, ebenso charmante wie unbeabsichtigte Lächeln des Kommissars, mit dem er in seinen Verhören schon so manchen Verdächtigen gefügig gemacht hatte, wischte Matthieus ungewohnte Ernsthaftigkeit beiseite.
»Den hier.« Matthieu hielt ihm das Buch hin. »Eine unschlagbare Waffe gegen alle Fragen.«
Adamsberg blätterte es rasch durch. Matthieu hatte einen schmalen Band mit wenig Text und vielen Illustrationen ausgewählt. Sein Blick blieb an dem Porträt des Vicomte François-René de Chateaubriand hängen. Den Namen hatte er schon mal gehört.
»Du wirst es nicht glauben«, sagte Matthieu. »Selbst von meinen Leuten weiß nur jeder Zehnte, wer der berühmte Bewohner der Festung war. Und nicht einer von tausend Bullen, ich eingeschlossen, hätte den Mörder dieser jungen Mädchen erwischt. Du ahnst womöglich, was uns mehr schlechte Laune bereitet?«
»Diese Mädchen.«
»So ist es. Ich schlage vor, wir setzen uns mit einem Gläschen auf die Terrasse da drüben, und dann erzähle ich dir, was es mit dem berühmten Schlossbewohner auf sich hat, von dem ich übrigens keine Zeile gelesen habe. Ich kann dir gerade mal drei Titel aus seinem Gesamtwerk nennen. Komm.«
Auf dem kurzen Weg zum Café verschickte Adamsberg eine einfache Frage von seinem Handy aus, ohne seinen ein wenig tänzelnden Gang zu unterbrechen. Wenn es einer wissen würde, dann Danglard. Adamsberg überflog die endlosen Textnachrichten, mit denen sein Stellvertreter ihm antwortete, und ließ es dabei bewenden. Jetzt wusste er zumindest in groben Zügen Bescheid.
»Dein berühmter Vicomte François-René de Chateaubriand«, sagte er, als sie vor einer Schale Cidre saßen, »ist einer der größten französischen Schriftsteller, Wegbereiter der Romantik und weltweit bekannt.«
Adamsberg stockte und blickte zu einem Schwarm Möwen.
»Sag nichts.« Mit erhobener Hand gebot er Matthieu Schweigen. »Ich hab’s gleich. Sein monumentales Hauptwerk sind die Erinnerungen von jenseits des Grabes.«
»Heimlich gegoogelt, was? Du klaust mir meine kleine Geschichte.«
»Von wegen gegoogelt. Ich habe einen der wenigen Männer meiner Brigade gefragt, die mir so etwas beantworten können.«
»Deinen Commandant Danglard?«
»Genau den«, sagte Adamsberg, während er rasch etwas in sein Notizbuch kritzelte. »Ich musste ihn mal wieder bremsen, sein kultureller Datenstrom ist so reißend, dass er ihn nicht eingedämmt bekommt.«
»Dann weißt du also noch nicht alles«, freute sich Matthieu. »Du weißt noch nichts von dem Hinkenden und der schwarzen Katze.«
»Wer sind die beiden?«
»Gespenster. Kannst du dir das Schloss von Combourg auch nur eine Minute ohne Gespenster vorstellen? Das wäre völlig witzlos. Möchtest du noch einen Cidre?«
»Wie viel Uhr ist es?«
»Gleich sieben. Zu spät, um nach einem solchen Tag die Strecke in der Dunkelheit zurückzufahren. Ich schlage dir alternativ ein kurzweiliges Bildungsprogramm vor.«
Matthieu hob die Hand, um nachzubestellen.
»Deine Spukgeschichte?«
»Zum Beispiel. Aber ich dachte vor allem an eine Begegnung, bei der es selbst deinem Commandant die Sprache verschlagen würde.«
»Begegnung mit wem?«
»Mit Chateaubriand.«
»Mit dem hier?« Adamsberg deutete auf eine Seite in seinem Notizbuch. »Willst du mich verarschen, ich habe gerade gelesen, dass er 1848 gestorben ist.«
Matthieu betrachtete voller Bewunderung das elegante Porträt von Chateaubriand, das Adamsberg mit feinem Strich aufs Papier geworfen hatte und das dem Dichter aufs Haar glich.
»Wie hast du das hingekriegt?«
»Es gibt ein Bild von ihm in deinem Buch.«
»Und das hat dir gereicht? Dafür hätte der Präfekt dir gleich den nächsten Orden verleihen können. Ich kann leider überhaupt nicht zeichnen.«
»Blättere mal um.«
Auf der nächsten Seite blickte Matthieu seinem eigenen Konterfei ins Gesicht. Adamsberg hatte sich bemüht, die harmonischen Züge besonders zur Geltung zu bringen, und es mit einer Lebhaftigkeit geschmückt, die vergessen machte, dass er kein wirklich schöner Mann war.
»Scheiße«, entfuhr es Matthieu mit heruntergeklappter Kinnlade. »Kannst du mir das signieren? Und mir schenken?«
Während Adamsberg der Bitte nachkam, war Matthieu aufgestanden, hatte bezahlt und klimperte nun mit seinen Autoschlüsseln.
»Beeil dich, sonst verpassen wir ihn.«
»Ich kann mich nicht beeilen.«
»Es ist genau seine Uhrzeit.«
»Verarsch mich nur«, wiederholte Adamsberg und verstaute sorgsam das Notizheft in seiner Tasche.
Matthieu ließ den Motor an und hielt in forschem Tempo Kurs auf Louviec.
»Er isst oft gegen acht im Gasthof Zu den zwei Schilden zu Abend, einem der besten Lokale weit und breit. Wo du auch ein hervorragendes Zimmer finden und mit reichlich Klatsch und Tratsch versorgt werden wirst. Davon abgesehen ist Louviec ein echtes bretonisches Dorf, praktisch unberührt, überall grüner Granit, Gassen mit rutschigen Pflastersteinen, mittelalterliche Säulen und Gewölbe, also genau das, was man sich wünscht, um Paris oder Rennes für ein paar Stunden zu vergessen. Ich empfehle das Huhn mit Pilzen und Gratin.«
»Klingt gut«, sagte Adamsberg und folgte seinem Kollegen in den bereits gut gefüllten Gasthof, der betont mittelalterlich eingerichtet war. Reproduktionen alter Tapisserien an den Wänden, Schwerter, Rüstungen, Holztische.
»Am besten setzen wir uns hier hin«, meinte Matthieu, »dann habe ich die Tür im Blick und kann dir ein Zeichen geben, wenn er hereinkommt. Und da er normalerweise an dem langen Tisch dort speist, hören wir auch, was geredet wird.«
»Du siehst, es war gar nicht nötig, dass wir uns beeilen, wir sind zwanzig Minuten zu früh.«
»Was mir die Zeit gibt, dir die Geschichte vom Hinkenden zu erzählen.« Matthieu verzog das Gesicht, als hielte ihn auf einmal etwas davon ab. »Aber wundere dich nicht, wenn ich mir das linke Auge reibe oder es mit der Hand bedecke.«
»Hast du Schmerzen?«
»Noch nicht. Aber sobald ich über das Gespenst rede, fängt es an. Ich habe das noch nie jemandem gesagt, behalte es bitte für dich.«
»Glaubst du an den Hinkenden?«
»Im Leben nicht. Trotzdem habe ich jedes Mal, wenn ich von ihm erzähle, das Gefühl, jemand drückt mir sehr fest auf mein linkes Auge. Wenn die Geschichte zu Ende ist, lässt der Druck nach.«
»Hast du das häufiger?«
»Nur wenn es um den Hinkenden geht. Jetzt wirst du denken, dass ich übergeschnappt bin. Hast du auch so eine Macke?«
»Ich zähle meine Macken schon gar nicht mehr. Also, schieß los.«
Matthieu grinste und hielt sich schützend eine Hand vors Auge, für alle Fälle.
»Ich bin ganz Ohr«, sagte Adamsberg, während eine Kellnerin Besteck und Teller vor ihnen auslegte.
»Es handelt sich um einen sehr alten Geist, er ging schon um, lange bevor Chateaubriands Vater das Schloss erwarb. Er war der Graf von Combourg und hieß Malo de Coëtquen. Bretonischer geht’s nicht. Bei einer Schlacht im Jahr 1709 verlor er ein Bein, das durch eine Holzprothese ersetzt wurde. Und dieses Holzbein hört man manchmal noch heute bei Nacht auf dem Steinboden im Schloss Combourg klopfen. Warte«, Matthieu tippte etwas in sein Smartphone, »hier, das schreibt Chateaubriand dazu: ›Es hieß, dass ein gewisser Graf von Combourg, der drei Jahrhunderte zuvor verstorben war‹ – in Wirklichkeit 1721 – ›sich zu bestimmten Zeiten zeigte und mit seinem Holzbein auf der Treppe des Geschützturms vernehmen ließ. Bisweilen spazierte sein Holzbein auch allein herum, in Begleitung einer schwarzen Katze …‹ Anderen Stimmen zufolge miaute auch der Geist der Katze hin und wieder. Chateaubriands Vater glaubte fest an diesen Spuk und hatte es nicht versäumt, seinen Kindern davon zu erzählen. Eine schöne Gutenachtgeschichte, nicht wahr? Reich mir doch bitte mal das Wasser herüber, damit ich mein Auge abtupfen kann.«
Matthieu feuchtete seine Serviette an und strich damit über sein Augenlid, das Adamsberg tatsächlich etwas gerötet vorkam.
»Achtung«, sagte er plötzlich, »da ist er, Josselin de Chateaubriand, der aktuelle. Auch der Vicomte von Combourg genannt. Guck ihn dir an, bitte möglichst diskret, er ist ein freundlicher und bescheidener Mann, trotz seiner etwas ungewöhnlichen Kleidung, aber das muss man verstehen, sein unglaubliches Schicksal lastet schwer auf seinen Schultern.«
Adamsberg drehte sich unauffällig zur Seite und sah, während er einen Schluck Cidre trank, zu seiner großen Überraschung den Mann hereinkommen, dessen Gesicht er eben erst in sein Notizbuch skizziert hatte. Der schlanke Körper, die glatten Gesichtszüge, das spitze Kinn, der melancholische Blick, die wohlgeformten Lippen – er war das vollkommene Ebenbild des Schriftstellers. Adamsberg hatte die »Begegnung«, die Matthieu ihm angepriesen hatte, für einen Scherz gehalten. Ungläubig starrte er den Mann an, der von Tisch zu Tisch ging, jeden und jede schlicht begrüßte, sich mit Leichtigkeit durch den Raum bewegte, gut, aber dezent gekleidet. Obwohl seine Kleidungsstücke einzeln betrachtet zeitlos waren – eng geschnittene Hose, weißes Hemd, Weste, langes schwarzes Jackett –, vermittelte das Gesamtbild etwas spürbar Neunzehntesjahrhunderthaftes. Verstärkt wurde dieser Eindruck durch einen weißen Schal und einen hochgestellten Hemdkragen, was ihm jedoch niemand verdenken konnte, denn es war bekannt, dass er einen empfindlichen Hals hatte. Einige erwiderten seinen Gruß mit »Guten Abend, Vicomte«, andere mit »Guten Abend, Chateaubriand« oder einfach »Guten Abend, Josselin«.
»Sieh ihn nicht so an«, zischte Matthieu. »Dreh dich wieder zu mir um. Mist, er kommt direkt auf uns zu. Stell dich dumm und tu so, als würdest du ihn nicht erkennen, damit wirst du ihm eine echte Freude bereiten.«
»Er macht aber schon ein bisschen auf neunzehntes Jahrhundert, oder täusche ich mich?«
»Weil der Bürgermeister höchstpersönlich ihn darum gebeten hat. Aus Marketinggründen, die Touristen wären enttäuscht, wenn sie Chateaubriand in Pullover und Stiefeln antreffen würden. Für den Einzelhandel in Louviec ist dieses Theater eine Goldgrube, glaub mir. Für Josselin selbst ein Fluch, er will mit Combourg und diesem lästigen Vorfahren nichts zu tun haben.«
»Und warum spielt er das Spiel dann mit?«
»Im Gegenzug erhält er vom Bürgermeister eine Pension und eine kostenlose Unterkunft. Ein Zubrot verdient er sich mit Privatunterricht in Geschichte, Literatur, Mathematik, Naturwissenschaften, Kunst, Philosophie und so weiter. Seine Kenntnisse sind wahrscheinlich nicht so bemerkenswert wie die von deinem Danglard, aber sie können sich sehen lassen. Seine Schüler machen jedenfalls rasche Fortschritte, er ist sehr gefragt.«
»In Naturwissenschaften ist Danglard eine Null … Was er anhat, ist also gewissermaßen seine Arbeitskleidung?«
»Ganz genau. Und trotzdem glaube ich, dass diese Kluft ihm nicht wirklich missfällt. Wahrscheinlich hält sein Vorfahr ihn doch noch an einem Jackenzipfel fest. Ohne dass er sich dessen bewusst ist. Eine Macke, wenn du so willst.«
Josselin de Chateaubriand trat zu den beiden Polizisten an den Tisch und streckte Matthieu, der Anstalten machte, sich zu erheben, seine Hand entgegen.
»Bleiben Sie sitzen, Matthieu«, sagte Chateaubriand mit einer sanften, beinah musikalischen Stimme. »Wir hatten schon mehrfach das Vergnügen miteinander, in Combourg oder Louviec, etwa, als damals diese einfältigen Touristen mein Haus stürmten, um Fotos zu schießen, und nicht zuletzt, als wiederum andere Eindringlinge jedes einzelne meiner Zimmer auf den Kopf stellten, weil sie hofften, auf wer weiß welche bislang unentdeckten Dokumente des berühmten Schriftstellers zu stoßen. In beiden Fällen hatten die Gendarmen von Combourg Sie zu Hilfe gerufen.«
»Vor fünf oder sechs Jahren, ja. Das war ein geradezu fanatisches Paar. Verurteilt wegen Einbruch und Hausfriedensbruch. Und entdeckt hatten sie im Übrigen nichts.«
»Außer mein Privatleben«, sagte Chateaubriand, »aber daran bin ich gewöhnt. Und Sie selbst hatten in der Sache äußerstes Fingerspitzengefühl gezeigt.«
»Danke für Ihre freundlichen Worte, Monsieur«, sagte Matthieu.
»Bitte nennen Sie mich Josselin, wie alle hier.«
Der Mann wandte sich nun höflich Adamsberg zu.
»Was Sie betrifft, wenn ich mich nicht täusche, war gestern im Lokalteil ein Foto von Ihnen. Sie sind der Kommissar, der den fürchterlichen Auswüchsen dieses Mörders ein Ende bereitet hat, und es ist mir eine Ehre, Ihnen dazu zu gratulieren. Allerdings wurde keine genauere Auskunft gegeben, wie Sie ihm auf die Schliche kamen. Ich nehme an, das ist beabsichtigt?«
»Der Fall interessiert Sie? Josselin?« Es war Matthieu unangenehm, ihn beim Vornamen zu nennen, aber da er wusste, dass Chateaubriand großen Wert auf diese zwanglose Anrede legte, tat er es.
»Nun, man fragt sich unweigerlich, wie der Kommissar aus diesem Labyrinth herausfinden konnte.«
»Möchten Sie einen Cidre mit uns trinken?« Matthieu bot ihm einen Stuhl an. »Ich glaube nicht, dass mein Kollege ein Geheimniskrämer ist.«
Josselin bedankte sich mit einem Nicken und nahm Platz, wobei er darauf achtete, die Schöße seines Jacketts auseinanderzuziehen.
»Fünf Opfer, alle mit Schnittwunden«, sagte Adamsberg, »aber das wissen Sie ja. Insgesamt hundertsechzig Schnitte, und jeder anders. Deutlich anders. Zu deutlich, hatte ich den Eindruck.«
»›Alles, was übertrieben ist, ist bedeutungslos‹, behauptete Talleyrand, doch in Ihrem Fall scheint es sich umgekehrt zu verhalten.«
»Das ist richtig, und als ich die Wunden genauer untersuchte, habe ich Ähnlichkeiten entdeckt, die nicht sehr auffällig, aber doch erkennbar waren und einem System folgten. Es lag auf der Hand, dass wir es mit einem Einzeltäter zu tun hatten, der im gesamten Nordwesten des Landes sein Unwesen trieb. Wir mussten über siebenhundert DNA-Tests durchführen, um den Mann zu identifizieren.«
»Sie haben DNA gefunden?«
»In einer feinen Blutspur, die breiter war als die Wunden. Er hatte seinen Handschuh durchbohrt.«
»Über siebenhundert DNA-Analysen …«, sagte Josselin nachdenklich. »Aber von wem denn eigentlich?«
»Von zahlreichen Handelsvertretern und Fernfahrern, die im Nordwesten unterwegs sind. Ich will nicht verheimlichen«, sagte Adamsberg lächelnd, »dass zwei meiner Mitarbeiter diese letzte Etappe nicht so toll fanden, und diejenigen, die sich dem Test unterziehen mussten, natürlich auch nicht.«
»Also, ich, Kommissar Adamsberg, hätte bei der Suche der Nadel im Heuhaufen bis zum bitteren Ende an Ihrer Seite gestanden und ich möchte Ihnen noch einmal mein Kompliment aussprechen. Aber da kommt Ihr Essen«, sagte er und stand auf, »ich will Ihre Mahlzeit nicht weiter stören. Huhn mit Pilzen, eine ausgezeichnete Wahl.«
Er verabschiedete sich mit einer Verbeugung, dabei fiel Adamsberg der kleine weiße Schal vor die Füße. Der Kommissar hob ihn auf und reichte ihn Chateaubriand.
»Tut mir leid, er versucht andauernd, mir zu entkommen. Ich sollte mir einen längeren besorgen, aber ich würde zu altmodisch damit wirken und das will ich auf keinen Fall.« Er legte sich den Schal mit einem Augenzwinkern wieder um den Hals.
Als Chateaubriand sich entfernt hatte und sich mit dem Wirt des Gasthofs unterhielt – einem kräftigen Mann in den besten Jahren, hochgewachsen, eine beeindruckende Erscheinung –, brummte Matthieu zufrieden.
»Perfekt«, sagte er, »du hast mit ihm gesprochen wie mit irgendeinem Typen von der Straße.«
»Womit du sagen willst, dass ich mich wie irgendein Typ von der Straße angehört habe?«
»Und wenn schon? Schämst du dich, dass du dich wie ein Bulle anhörst? Nichts anderes wollte er doch von dir, oder?«
»Man fragt sich, warum er an so vielen Details interessiert war. Ich hoffe, ich konnte seine Neugier stillen.«
»Du hast doch nicht etwa Angst, einen Chateaubriand enttäuscht zu haben? Du? Entspann dich, es ist ja nicht der Chateaubriand. Du hast dich durch seine gewählte Sprache und sein Äußeres verunsichern lassen.«
»Und wie erklärst du dir, dass er ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist?«
»Iss, bevor es kalt wird«, sagte Matthieu und füllte ihre Gläser wieder mit Cidre. »Du kannst dir denken, dass zu diesem Thema schon viel Tinte geflossen ist. Moment, hör mal, was da an dem großen Tisch geredet wird, könnte lustig werden.«
Es war eine Runde aus neun Leuten und mittendrin Chateaubriand, an seinem Stammplatz.
»Na, Vicomte«, rief ein Typ, der nur aus Muskeln gebaut zu sein schien, »was sagst du denn zu dem Ganzen?«
»Das ist Gaël, der Wildhüter«, flüsterte Matthieu Adamsberg zu. »Ein Provokateur und Streithammel. Josselin ist eine seiner Lieblingszielscheiben.«
»Hör endlich auf, mich ›Vicomte‹ zu nennen!«, erregte sich Chateaubriand. »Ich bin nicht mehr ›Vicomte‹ als jeder andere an diesem Tisch, wie oft soll ich das wiederholen … Was sage ich wozu?«, schob er hinterher, während er sein Omelette in Empfang nahm.
»Du weißt genau, was ich meine. Der Hinkende von Combourg, er läuft seit bald drei Wochen wieder nachts mit seinem Holzbein durch die Straßen.«
»Stimmt«, bestätigte eine dicke Frau, »ich habe ihn erst gestern unter meinem Fenster gehört, sein Holzbein hämmerte auf das Pflaster, dass mir angst und bange wurde.«
»Ich auch«, sagte ein Mann eifrig nickend. »Ich bin sofort zum Fenster gestürzt, aber es war nichts zu sehen. So ist das mit Gespenstern. Besonders mit diesem, von dem sieht man immer nur das Holzbein.«
»Das war gerade der Bucklige, wie du vielleicht erkennen kannst.« Matthieu deutete auf einen Mann, der mit dem Rücken zur Wand am Tresen saß. »Maël Yvig. Viele fassen ihm im Vorbeigehen an seinen Höcker, bringt angeblich Glück. Ihn macht das rasend, verständlicherweise. Josselin tut es übrigens nie.«
»Und wieso betrifft mich das mehr als andere?«, fragte Chateaubriand den Wildhüter.
»Tu jetzt bloß nicht so, Vicomte. Der Hinkende ist schließlich im Schloss Combourg zu Hause.«
»Wohne ich etwa auch dort? Ihr wisst alle, dass ich dieses Schloss noch nie von innen gesehen habe und nicht beabsichtige, es je nachzuholen. Ich stamme aus Louviec, nicht aus Combourg.«
»Trotzdem«, beharrte der Wildhüter, »der Hinkende ist irgendwie ein Chateaubriand.«
»Und was glaubst du, Gaël?«, rief Chateaubriand aufgebracht. »Dass ich das Gespenst aus dem Schloss geholt habe, um hier für Unterhaltung zu sorgen?«
»Wahrscheinlich irgendein Spaßvogel oder ein Kind, das mit einem Stock auf die Erde schlägt«, schaltete sich ein gut aussehender Mann mit dichtem weißem Haar ein, um Spannungsabbau bemüht.
»Der Arzt«, erklärte Matthieu. »Loig Jaffré.«
»Klar«, sagte der Bucklige. »Im Übrigen kenne ich niemanden, der respektvoller im Umgang ist als Josselin, er sucht nie Streit. Daran könntet ihr anderen euch ein Beispiel nehmen, ganz besonders du, Gaël. Der Erste, der ihm an den Kragen will, bekommt es mit mir zu tun.«
»Es ist immerhin vierzehn Jahre her, dass der Hinkende einen Fuß, oder besser, eine Stelze nach Louviec gesetzt hat«, rief die Dicke dazwischen. »Wisst ihr noch?«
»Ja, zwei oder drei Monate lang hörte man Nacht für Nacht sein Gehämmer. Und was ist dann passiert?«
»Man hat Armez in seinem Bett eine Kugel in den Kopf gejagt und sein ganzes Erspartes war futsch.«
Adamsberg sah mit hochgezogener Augenbraue zu Matthieu.
»Der einzige Mord, den Louviec je erlebt hat«, bestätigte Matthieu, »das hat die Leute nachhaltig beeindruckt. Hier ist es so ruhig, dass es keinem einfallen würde, seine Haustür abzuschließen. Armez hatte sein ganzes Geld törichterweise unter die Matratze gestopft. Von wegen gutes Versteck. Da waren völlige Dilettanten am Werk, skrupellose Idioten, hieß es. Deshalb wurde überall nach jungen Leuten gefahndet, die plötzlich mit Geld um sich warfen, ohne Ergebnis. Danach, und das ist der Punkt, an dem sich die Gemüter erregen, war der Hinkende aus Louviec verschwunden. Bis vor Kurzem.«
»Und jetzt, wo er zurück ist«, sagte ein schmächtiger Bursche, »was glaubt ihr, wird geschehen?«
»Ich frage mich, wo ihr euren Verstand gelassen gehabt«, sagte Chateaubriand, während er sein Glas gegen das Licht hielt und die Farbe seines Weins betrachtete, eine Geste, die sich in ihrer Anmut deutlich vom übrigen Gebaren am Tisch unterschied. »Erstens: Es gibt keine Gespenster, nur zur Erinnerung. Ihr seid Bretonen, ihr steht fest mit beiden Beinen auf der Erde. Zweitens: Ein Gespenst verlässt niemals seine Bleibe. Drittens: Das Gespenst von Combourg hat meines Wissens noch nie jemanden angegriffen. Viertens: Vor vierzehn Jahren war ich noch nicht nach Louviec zurückgekehrt. So weit seid ihr einverstanden? Jetzt hat einer von euch ein Hämmern gehört oder davon geträumt. Seither hört ihr es alle. Oder vielmehr, ihr bildet euch ein, es zu hören. Eine kollektive Halluzination. Nichts weiter als ein Hirngespinst, und je eher ihr die Sache wieder vergesst, desto schneller verschwindet euer Hinkender.«
Chateaubriands Vortrag und das Eintreffen dreier weiterer Flaschen setzten der Diskussion ein Ende, sie verlor sich in einem allgemeinen Stimmengewirr.
»Glauben die Leute wirklich daran?«, fragte Adamsberg.
»Ich fürchte, ja, die meisten. Die einen mehr, die anderen weniger.«
»Und sie denken, Chateaubriands Anwesenheit ist schuld, dass der Hinkende sich in Louviec herumtreibt?«
»So ungefähr, obwohl, du hast es ja selbst gehört, dass Chateaubriand sich vor vierzehn Jahren gar nicht in Louviec aufhielt. Aber in solchen Fällen spielt Logik keine Rolle. Hier im Dorf sind ja auch viele felsenfest davon überzeugt, dass deine Seele Schaden nimmt, wenn jemand auf deinen Schatten tritt, besonders auf den deines Kopfes, und dass dies früher oder später zum Tod führt. Viele andere, die Mehrheit, lachen darüber und laufen mit Vergnügen über jeden Schatten, der ihren Weg kreuzt. Vor allem Kinder spielen liebend gern Schattentrampeln, bis ihnen irgendwer ein paar hinter die Löffel gibt und sie verscheucht.«
»Das kenne ich aus meinem Dorf in den Pyrenäen. Wir mussten immer an der Hand meiner Großmutter laufen, und sobald jemand die Straße überquerte, hielt sie abrupt an. Um unsere Schatten zu schützen.«
»Dieser Aberglaube ist so alt wie die Welt und kein Volk ist ihm je entkommen«, sagte Matthieu und nahm endlich die Hand von seinem Auge. »Aber du hast mich vorhin nach dieser verblüffenden Ähnlichkeit gefragt. Es gibt dazu drei Hypothesen. Es ist extrem selten, dass man einen Doppelgänger hat, deshalb drängt sich zunächst der Verdacht der Hochstapelei auf. Opfer meiner Neugier, habe ich Nachforschungen angestellt und das Geburtenregister der Gemeinde und des Rathauses buchstäblich unter die Lupe genommen – nichts.« Matthieu schüttelte den Kopf. »Das Papier weist weder Kratz- noch Radierspuren auf, die Handschrift des Pfarrers und des Gemeindebeamten sind einwandfrei zu entziffern. Josselin wurde vor dreiundfünfzig Jahren als Sohn eines Vaters namens Auguste-Félix de Chateaubriand in Louviec geboren. Er hat die Ähnlichkeit mit dem Schriftsteller also nicht ausgenutzt, um unter falscher Flagge zu segeln. Außerdem würde ein Betrüger doch versuchen, daraus einen Vorteil zu ziehen, oder? Ihm brachte die Ähnlichkeit aber nur Ärger ein. Er wechselte von einer Stelle zur nächsten, jedes Mal rollte man wegen seines Aussehens und seines Namens den roten Teppich für ihn aus, nie verlangte man ein Diplom. Er hat keinerlei Ausbildung durchlaufen, beispielsweise zum Literaturlehrer, folglich scheiterte er krachend an seinen Aufgaben, die Lehrpläne und Verpflichtungen waren ihm ein Graus. Ein Leben voller Misserfolge und Talfahrten, das ihn eines Tages demütig nach Louviec zurückführte.«
»Deine zweite Hypothese?«
»Sein Vater, auch er gebürtig aus Louviec, war so stolz auf seinen Namen und seinen Sprössling, dass er Jahre damit zubrachte, sämtliche Archive zu durchforsten, um den umfangreichen Stammbaum der Familie zu rekonstruieren. Er findet sich in den Aktenbeständen des Rathauses, doch Josselin zeigt kein Interesse daran. Das Dokument misst gut einen auf zwei Meter, ist mit großer Akribie erstellt, es fehlt kein Name und kein Datum – der Vater war Notar und notorisch gewissenhaft –, ich habe es stundenlang studiert. Es gibt tatsächlich eine entfernte Verwandtschaftslinie, in der ein Josselin-Arnaud de Chateaubriand auftaucht, der Erste seines über Generationen weitervererbten Namens. Unser Josselin wäre in diesem Fall ein Cousin vierten Grades. Ganz schön weit entfernt, oder? Für eine solche Ähnlichkeit?«
»Zu weit.«
»Bleibt die Bastardthese, mein Favorit. Chateaubriand, der andere, der echte, wenn ich so sagen darf, war ein Frauenheld. Unwahrscheinlich, dass aus diesen zahlreichen Verbindungen, ob kurz oder lang, nicht auch eine Schar Nachkommen hervorgegangen ist, die er jedoch nicht anerkannt hat. Aber angenommen, eine dieser Frauen hätte genug Macht über ihn gehabt und ihn genötigt, dem Kind seinen Namen zu geben. Dann wäre unser Josselin ein direkter Nachkomme und trüge rechtmäßig seinen Namen.«
»Das hieße, es lägen zwei Jahrhunderte zwischen den beiden, immer noch eine lange Zeit für eine solche Ähnlichkeit.«
»Du darfst nicht vergessen, in diesen Kreisen waren Ehen oder Affären unter Blutsverwandten gang und gäbe. Was die genetische Möglichkeit einer solchen Anomalie erhöht. Ich sehe keine andere Erklärung, auch wenn sie unbefriedigend ist. Nimmst du noch ein letztes Glas, bevor wir gehen?«
»Ich weiß nicht«, sagte Adamsberg mit einer Geste, die sich im Unbestimmten verlor.
»Mach, was du willst, ich zwinge dich zu nichts.«
»Das meinte ich gar nicht«, stellte Adamsberg entschuldigend richtig. »›Ich weiß nicht‹ rutscht mir oft einfach so raus.«
»Und warum?«
»Ich weiß nicht«, sagte der Kommissar lächelnd. »Lass uns noch einen trinken, Matthieu.«
III
Am nächsten Morgen um 9 Uhr trat Adamsberg den Rückweg nach Paris an, den Kopf voller Geschichten über den Hinkenden, die Schattentrampler und den eleganten Josselin de Chateaubriand.
Und einen Monat später traf Danglard ihn morgens in seinem Büro an, vertieft in die Lektüre jenes Artikels über den Mord in Louviec, der ihn ohne ersichtlichen Grund völlig in Beschlag nahm. Gaël Leven war ein aggressiver Mann gewesen, Adamsberg erinnerte sich an sein Wortgefecht mit Chateaubriand in dem Gasthof. Beinahe hätte er Matthieu angerufen, um Einzelheiten in Erfahrung zu bringen, aber Danglard hatte recht, es ging ihn nichts an. Das wusste auch Matthieu, der Hunderte Kilometer entfernt an Adamsberg dachte und seine Meinung hören wollte. Nach einer Stunde des Zögerns schloss er die Tür seines Büros und griff zum Telefon.
»Adamsberg? Matthieu hier. Die Dinge laufen nicht gut bei uns, bist du im Bilde?«
»Ja, Gaël Leven. Wo?«
»In der dunklen Gasse, die zu seinem Haus führt. Er kam aus dem Gasthof, ziemlich betrunken, zumindest so betrunken, dass er einigen Leuten schwer auf die Nerven gegangen war. Unter anderem Josselin. Im Hinsetzen hatte Gaël, angeblich aus Versehen, aber das kaufte ihm niemand ab, Wein über Josselins graue Weste verschüttet. Du musst wissen – Gaël machte keinen Hehl daraus –, dass ihn an Josselin einfach alles aufregte: sein adliger Name, seine ›weibische‹ Kleidung, seine langen Locken. In der Regel hütete er aber seine Zunge, denn nur wenige teilten seine Ansichten in diesem Punkt. Zumal allen klar ist, dass der Bürgermeister von Chateaubriand erwartet, sein vornehmes, etwas angestaubtes Äußeres zu kultivieren. Aber sobald Gaël einen über den Durst trinkt, eskaliert die Situation. Der Wirt hat ihn am Kragen gepackt und rausgeworfen.«
»Wie reagierte Josselin? Wegen des verschütteten Weins, meine ich.«
»Er trocknete sich mit einer Serviette die Weste ab. Sehr gelassen.«
»Und dann?«
»Dann kommt der Arzt ins Spiel, der Typ mit der weißen Haarpracht, erinnerst du dich?«
»Ja, er hatte damals versucht, die Wogen zu glätten.«
»Er verließ den Gasthof zehn Minuten später und nahm denselben Weg wie Gaël. Und auf einmal sah er ihn da in seinem Blut liegen, vor Schmerzen wimmernd. Zwei Messerstiche in die Brust. Mit dem einen wurde die Lunge durchbohrt, mit dem anderen eine Rippe gebrochen und das Herz verletzt. Der Arzt rief einen Rettungswagen aus Combourg herbei und blieb bei dem Verletzten. Der geredet hat.«
Am Klang von Matthieus Stimme hörte Adamsberg, dass etwas nicht in Ordnung war.
»Was hat er gesagt?«
»Warte, damit du die Zusammenhänge verstehst, muss ich dir noch kurz eine Szene schildern, die sich am Abend vor dem Mord bei einem Empfang im Rathaus abspielte. Man hatte zur Vernissage eines örtlichen Malers eingeladen, es waren etwa sechzig Leute anwesend, darunter ein verbitterter, übellauniger Journalist, der beim Combourger Tageblatt und bei Sieben Tage in Louviec für das Vermischte zuständig ist. Josselin hatte nicht mitbekommen, dass der Mann auch da war, und ließ sich über die allgemeine Respektlosigkeit und den Spott der Journalisten aus, unter denen er sehr zu leiden habe, weil man, wie er ganz objektiv darlegte, an ihn tausendmal mehr Erwartungen stelle als an einen gewöhnlichen Menschen, der er aber sei. Daraufhin geht dieser Lokalreporter, Villing, auf ihn zu und rüttelt ihn heftig an der Schulter. Josselin mag ein Mann wie du und ich sein, trotzdem ist noch nie jemand handgreiflich gegen ihn, den Vicomte de Chateaubriand, geworden. Warum auch? Villing war in Rage – wie Gaël hatte er ordentlich getankt, er schnaufte wie ein Stier – und verteidigte seine Zunft. Er bezeichnete Josselin als Nichtskönner, als Versager, als jämmerlichen Lehrer, es sei schon eine Leistung, es mit der Visage und dem Namen zu nichts zu bringen. Und er werde die Wahrheit über Josselins Unfähigkeit in der Zeitung von Louviec enthüllen, jeder solle davon erfahren. Die Zeugen des Vorfalls waren sprachlos und schockiert, genauso wie der Bürgermeister.«
»Was hat Josselin getan?«
»Den Kopf geschüttelt und mit den Schultern gezuckt, und als der Kellner vorbeikam, hat er sich ein Glas Champagner genommen. Aber es war sonnenklar, dass diese Flut öffentlicher Beschimpfungen – die nicht alle aus der Luft gegriffen waren – ihn erschüttert hatte. Er streitet seine beruflichen Fehlschläge nicht ab, aber stell dir einmal vor, dieser Mistkerl von Villing würde Josselin de Chateaubriand in der Lokalzeitung als Nullnummer vorführen, binnen kürzester Zeit wäre das ganze Land auf dem Laufenden und der ehrwürdige Name Chateaubriand hätte einen ganz schönen Schlag weg. Plötzlich war es denn auch vorbei mit Josselins gewohnter Ruhe. Während der Bürgermeister versuchte, Villing ohne viel Aufhebens hinauszukomplimentieren, stieß Josselin ihn mit einem Kinnhaken zu Boden, was auf allgemeine Zustimmung traf. Nichts Schlimmes, aber demütigend.«
»Ausgezeichnet. Ich hätte wahrscheinlich dasselbe getan.«
»Und ich erst.«
»Womit dieser Villing einen weiteren Grund hat, seine Gemeinheiten zu veröffentlichen.«
»Dazu wird er keine Gelegenheit mehr haben, denn die Chefs vom Combourger Tageblatt und von Sieben Tage in Louviec haben ihn vor lauter Empörung sofort gefeuert. Das war am Abend des Mordes allerdings noch nicht bekannt. Villings Schmährede machte in Louviec schnell die Runde. Die meisten Einwohner bedauern den Zwischenfall, aber es gibt auch den ein oder anderen, der neidisch ist auf das Ansehen, das der ›aristokratische Schnösel‹, ›dieser Hochstapler‹ im Ort genießt, und sich heimlich ins Fäustchen lacht. Nur dass in Louviec eben nichts heimlich geschieht. Wenn du am Dorfeingang gegen einen Baum pinkelst, weiß in der nächsten Minute jeder am Dorfausgang darüber Bescheid.«
»Und was hat das mit dem Mord zu tun?«
»Das wirst du gleich verstehen. Aber behalte es für dich.«
»Selbstverständlich.«
»Hast du ein Blatt Papier zum Mitschreiben?«
»Liegt vor mir.«
»Die letzten Worte des Verletzten, die der Arzt aufschnappen konnte … Bist du so weit?«
»Lass hören.«
»Ich diktiere sie dir mit Pausen. Gaël brachte keinen zusammenhängenden Satz mehr über die Lippen, seine Worte waren abgehackt. Schreib auf, ich bin gespannt, was du davon hältst: ›Vic… bou… illing… ge… hau… to… ist…‹ Nach kurzer Unterbrechung fügte er hinzu: ›Dies… hat…‹ Das war’s. Die Aussage belastet eindeutig Chateaubriand, Adamsberg, es ist eine Katastrophe. Ich bin entsetzt.«
»Lass mich darüber nachdenken, ich rufe dich zurück. Du solltest keine voreiligen Schlüsse ziehen, vergiss nicht, der Mann war betrunken und lag im Sterben. Das wirkt sich nicht unbedingt vorteilhaft auf das Sprechen aus, und auf das Denken auch nicht.«
Adamsberg hatte sofort begriffen, was seinen Kollegen so schockierte. Er betrachtete das Blatt Papier und bemühte sich, Gaëls Gestammel mit Matthieus Augen zu lesen. »Vic… bou…« bedeutete demnach »Vicomte von Combourg«. Und bekanntlich versucht das Opfer als Erstes, den Namen des Mörders mitzuteilen. Hatte Gaël Leven Josselin »Vicomte« genannt? Ja, er erinnerte sich, dass Gaël ihn spöttisch so angesprochen hatte. Das Folgende lag auf der Hand: »Villing gehauen«, dann war vom Tod die Rede und das Ende blieb rätselhaft. Im zweiten Anlauf überdachte Adamsberg Gaëls Worte möglichst unvoreingenommen, dann rief er den Kommissar aus Combourg zurück.
»Und?«, fragte Matthieu gereizt. »Aus der Nummer kommt er nicht mehr raus, oder? Ich versuche, das Ganze hinauszuzögern, bis der Autopsiebericht vorliegt, aber danach bleibt mir keine Wahl. Dann heißt’s Verhör und Untersuchungshaft.«
»Die Anschuldigung wirkt auf den ersten Blick erdrückend, das will ich nicht bestreiten. Aber es gibt Dinge, die nicht zusammenpassen, zu viele Dinge. War Gaël dabei, als Villing Josselin im Rathaus beleidigte?«
»Ja, und er hat natürlich gelacht. Er hat sich ganz offensichtlich köstlich amüsiert.«
»Aber warum hätte Gaël auf diese Szene anspielen sollen?«
»Um Josselins Wut auf ihn zu erklären.«
»Josselin hätte doch zuerst Villing getötet, nicht Gaël, es wusste ja noch keiner, dass der Journalist rausfliegen würde. Gaël hatte gelacht, gut, aber daraus folgt noch lange kein Motiv. Gaël provozierte Josselin im Gasthof schon seit einer Weile, ohne dass dies je etwas zur Folge gehabt hätte. War es das erste Mal, dass Gaël ihn mit Wein übergoss?«
»Mindestens das fünfte Mal. Soweit ich weiß. Ich bin ja nicht tagtäglich in Louviec.«
»Siehst du, und Gaël wurde sicher nicht deswegen umgebracht. Josselin hat kein Motiv.«
»Mag sein, aber diese Worte sind nun mal in der Welt.«
»Und es gibt mindestens eines, das einer näheren Betrachtung nicht standhält. ›Villing gehauen‹. Gehauen, Matthieu? Das ist Kindersprache. Oder hörst du Gaël wie auf dem Schulhof rufen: ›Er hat Villing gehauen?‹ Verprügelt, geschlagen, fertiggemacht, was immer du willst, aber doch nicht gehauen. Nein, das funktioniert nicht. Zu kindisch für Gaël.«
»Ich verstehe, was du meinst, aber der Sinn seiner Worte bleibt bestehen.«
»Er bleibt es, was ›Vicomte von Combourg‹ betrifft, aber danach ist der Satz völlig schief und ergibt überhaupt keinen Sinn. Ganz zu schweigen von seinem unverständlichen Ende: ›tot ist‹. Wer ist denn tot, Matthieu? Und was sagt dir das ›Dies… hat…‹?«
»Nicht mehr als dir.«
»Du merkst selbst, nichts außer Josselins Titel ist stimmig. Mit viel gutem Willen könnte man Gaëls Worte so verstehen: ›Der Vicomte von Combourg hat Villing gehauen.‹ Das würde ich nicht zwingend eine Mordbezichtigung nennen.«
»Nein. Aber der Divisionnaire ist total fixiert auf diesen Namen: Chateaubriand. Und setzt mich unter Druck. Eine so spektakuläre Festnahme wäre ganz nach seinem Geschmack. Wie schätzt du die Lage ein?«
»Du hast mir noch nicht verraten, ob Gaël, so betrunken und aggressiv, wie er war, sich an dem Abend im Gasthof Ärger eingehandelt hatte?«
»Keinen handfesten. Die Leute kennen die Ausbrüche ihres Wildhüters, wenn er gesoffen hat. Sie hören nur mit einem Ohr hin, sein Gezeter perlt an ihnen ab wie Regen an einem Schieferdach, sie unterhalten sich einfach weiter, früher oder später schmeißt der Wirt Gaël raus, damit wieder Ruhe einkehrt … Warte, doch, einen Zwischenfall gab es. Eine Frau kam irgendwann hereingestürmt, schnurstracks auf Gaël zu, um ihm mit erhobener Faust zu drohen: ›Willst du mich umbringen, oder was, Gaël Leven? Wenn du mich nicht in Frieden lässt, garantiere ich dir, dass du es nicht ins Paradies schaffst.‹ Und zack, war sie wieder weg. Die Frau führt das Kurzwarengeschäft in Louviec, sie glaubt fest an die Geschichten mit den Schatten. Und als Chef-Schattentramplerin fürchtet und hasst sie Gaël gleichermaßen. Keine Sorge, ich habe meinen Job gemacht: Die Frau wurde als Erste verhört.«
»Noch vor Josselin?«
»Doktor Jaffré musste wegen einer notfallmäßigen Entbindung aufbrechen, kurz bevor der Krankenwagen kam. Unglücklicherweise ließ er in der Eile sein Telefon am Tatort liegen und hatte am nächsten Tag durchgehend Sprechstunde. Wir haben von Gaëls letzten Worten erst gestern Abend erfahren, als Jaffré uns endlich von zu Hause aus zurückrief. Heute Morgen war Josselin unterwegs, zunächst auf seinem üblichen Spaziergang im Wald, dann zum Einkaufen in Combourg. Das Wetter ist schön, soll er sich noch ein Weilchen dort vergnügen. Ich werde meine Männer nicht wie auf einer Treibjagd durch den Wald hetzen.«
»Zurück zu dieser Frau. Kaliber?«
»Kräftig. Aus dem Vollen geschnitzt, Arme wie Keulen. Am Nachmittag war Gaël ihr mindestens fünfmal hintereinander auf den Kopf gesprungen, na ja, auf den Schatten ihres Kopfes. Als sie ihn in der Herberge sitzen sah, konnte sie nicht widerstehen, sie ist rein, um ihm ›die Meinung zu geigen‹. Danach sei sie aber direkt nach Hause gegangen, Zeugen dafür gibt es nicht.«
»Sie hätte durchaus mit einem Messer in der Hand in der Gasse auf ihn warten können.«
»Aber ihm offen zu drohen und ihn anschließend umzubringen, hieße ja, sich selbst die Schlinge um den Hals zu legen.«
»Vielleicht ist sie ein bisschen dumm und hat gehandelt, ohne nachzudenken.«
»Sie ist zweifellos ein bisschen dumm. Sie zerreißt sich mit Leidenschaft das Maul über alle, selbst über Kinder. Sie heißt Marie Serpentin, aber die meisten nennen sie nur ›Die Schlange‹ oder ›Die Viper‹.«
»In Louviec geht’s ja lustig zu.«
»Sie langweilen sich einfach sehr.«
»Die Viper?«, wiederholte Adamsberg. »›Vi‹ wie in ›Vic‹.«
»Nur ohne ›bou‹. Ich denke, sie tickt nicht ganz richtig. Sie träumte von einer Bilderbuchfamilie mit sieben Kindern, war aber weder schön noch schlau genug, um einen einzigen Kerl an Land zu ziehen. Sie blieb allein mit ihrem Kurzwarenladen, und wie du weißt, redet man immer schlecht über andere, wenn es einem selbst nicht gut geht. Und sich fanatisch in irgendwelche Schattengeschichten hineinzusteigern, rührt bestimmt auch daher. So was gibt einem ein Ziel. Aber deshalb gleich ein Messer zu zücken, das erscheint mir wie ein zu großer Schritt.«
»Wohl wahr. Aber zumindest hast du mit ihr eine weitere Verdächtige. Mit ihr und allen, die Gaël provozierte, indem er auf ihren Schatten herumtrampelte. Gibt es Fußabdrücke?«
»Ja, und zwar sehr seltsame. Man könnte meinen, der Mörder sei in dem Blut ausgerutscht. Es sind glatte Abdrücke mit unregelmäßigen Aufwerfungen.«
»Der Mörder muss sich Plastiktüten um die Schuhe gebunden haben. Ich nehme an, ihr habt sämtliche Mülltonnen in der Umgebung durchsucht. Irgendwas Verdächtiges gefunden, Tüten oder Handschuhe?«
»Wir waren schon im Morgengrauen unterwegs. Keine Spur, weder von Handschuhen noch von Tüten.«
»Was ist mit Josselin? Wann hat er den Gasthof verlassen?«
»Er ist vor den anderen gegangen. Vor Gaël. Vierundzwanzig Zeugen. Auch er hätte in der Gasse auf Gaël warten können. Nicht gut, gar nicht gut. Deshalb frage ich dich noch einmal: Wie schätzt du die Lage ein?«
»Gib mir einen Moment zum Nachdenken. Einen langen Moment, bitte, ich denke so langsam nach, wie ich gehe und schreibe. Und schon gar nicht denke ich strukturiert nach.«