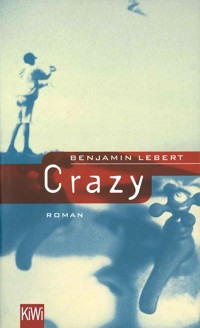8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo kann man Heimat finden zwischen Hoffnung und Verlorenheit? Keiner kann davon erzählen wie Benjamin Lebert. Ein Roman über die letzten Tage vor dem Erdbeben in Nepal. Kathmandu im April 2015. Bis zum großen Beben sind es noch neun Tage. Shakti, Achanda und Tarun leben in einem Kinderheim, das für sie so etwas wie ein Zuhause ist. Sie träumen von Freundschaft, der Pflegefamilie, einem Motorrad, sie erleben eine Ahnung von Glück. Ihre Eltern hatten sie in die Zwangsarbeit und in die Prostitution verkauft, irgendwann konnten sie fliehen. Man lässt sie glauben, dass es ihnen jetzt gut gehen wird, aber natürlich wissen sie es besser. Sie sind am Leben, sie trauen niemandem, sie suchen einen Weg durch die Dunkelheit und wissen nicht, wie wenig Zeit ihnen bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Benjamin Lebert
Die Dunkelheit zwischen den Sternen
Roman
Über dieses Buch
Wo kann man Heimat finden zwischen Hoffnung und Verlorenheit? Keiner kann davon erzählen wie Benjamin Lebert.
Kathmandu im April 2015. Bis zum großen Beben sind es noch neun Tage. Shakti, Achanda und Tarun leben in einem Kinderheim, das für sie so etwas wie ein Zuhause ist. Sie träumen von Freundschaft, der Pflegefamilie, einem Motorrad, sie erleben eine Ahnung von Glück. Ihre Eltern hatten sie in die Zwangsarbeit und in die Prostitution verkauft, irgendwann konnten sie fliehen. Man lässt sie glauben, dass es ihnen jetzt gut gehen wird, aber natürlich wissen sie es besser. Sie sind am Leben, sie trauen niemandem, sie suchen einen Weg durch die Dunkelheit und wissen nicht, wie wenig Zeit ihnen bleibt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Coverabbildung: Gavin Hellier/plainpicture
Covergestaltung: KOSMOS, Büro für visuelle Kommunikation
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490477-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Noch neun Tage
Achanda
Tarun
Shakti
Noch acht Tage
Achanda
Tarun
Shakti
Noch sieben Tage
Shakti
Tarun
Achanda
Die Dunkelheit senkt sich [...]
Noch sechs Tage
Shakti
Tarun
Achanda
Noch fünf Tage
Shakti
Tarun
Shakti
Noch vier Tage
Achanda
Tarun
Shakti
Noch drei Tage
Achanda
Shakti
Noch zwei Tage
Tarun
Shakti
Noch ein Tag
Shakti
Achanda
Tarun
Shakti
Heute
Tarun
Achanda
Shakti
Tarun
Achanda
Tarun
Nachbemerkung
Noch neun Tage
Achanda
Die Sonne ist eine Verräterin. Sie ist nicht schüchtern wie Misha, die ihre Augen senkt. Sie will nicht schlichten wie Housemother. Sie ziert sich nicht. Sie streckt ihren schimmernden Finger aus und sagt hier, hier und hier. Hier, sagt sie, der zerfetzte Körper eines Fisches im Staub, Gewölk aus Insekten drumherum. Hier der Straßenhund: steif, zottelig, hungergesichtig. Die feuchte Nase als Wegweiser. Er ist noch am Leben, obwohl er es besser wissen müsste.
Wir kennen uns, wir beide. Wir gehören Kathmandu, seinen Pfaden, seinem Granatapfelrot. Wir haben viel gemeinsam. Wir können uns nicht entgehen und haben doch nichts voneinander.
Hier das hellhäutige Mädchen auf der Tafel, die an der Hauswand über den schiefen Balkonen befestigt ist. Das Mädchen auf der Tafel ist glücklich, weil es die süße Flüssigkeit trinkt, die prickelt und ein Feuerwerk auf der Zunge zündet. Daneben eine zweite Tafel: dasselbe Getränk, andere Farben. Anderes Mädchen. Aber auch hellhäutig. Auch glücklich.
Hier, hier und hier – die Motorräder, dunkel, grollend –, künstliche Bestien, die alles Leben und die Geister der Stadt wie Beute vor sich herjagen. Ich träume, ich werde auch eins haben. Es wird nicht mehr lange dauern. Ich werde mein Gesicht mit einem Tuch verhüllen und einen Helm und eine dieser Brillen tragen, die meine Augen auslöscht. Dann werde ich davonfahren. Staub wirbelt auf, und nichts bleibt zurück. Auch nicht die Erinnerung.
Ich werde Shakti mitnehmen. Sie wird kein albernes Kind mehr sein, das auf einem Bein hüpft und das Krokodil-Lied singt. Sie wird etwas anderes sein. Erwachsen. Und schön. Ja, sehr schön wird sie sein. Und glücklich, wenn ich sie mit mir nehme. Und die Bestie nur auf meine Befehle hört und uns fortträgt.
Die Sonne lügt. Genauso wie die Nacht. Die Nacht lügt, weil sie verbirgt, ohne ein Unterschlupf zu sein. Die Sonne lügt, weil sie alles herzeigt. Auch das, was gar nicht da ist.
Ich bin froh, wenn das Treffen mit dem Alten vorbei ist. Der Alte ist verschlagen und heckt immer etwas aus. Sein breiter Mund grinst, obwohl es nichts zu grinsen gibt. Er geht mit leisen Sohlen auf Wegen, auf denen er nichts zu suchen hat. Seine Hände nehmen viel und geben wenig. Seine Hände sind kräftig. Seine Hände zittern, wenn sie zuschlagen wollen.
Der Junge weicht mir nicht von der Seite. Der Junge, der Tarun heißt. Bleibt in meiner Nähe. Will unbedingt dabei sein. Der Junge hat den Alten noch nie gesehen, und ich verrate ihm auch nicht, was ich mit dem Alten zu tun habe.
Das geht dich nichts an, sage ich. Einfach ein Mann, den ich treffen muss. Mehr nicht. Ich sage ihm, dass er zurückbleiben soll, wenn ich mit dem Alten rede. Dass der Alte nicht mitkriegen darf, dass er zu mir gehört.
Weil er es sich sonst anders überlegen könnte.
Und ich in Schwierigkeiten komme.
Ich sage ihm, dass er nicht wissen darf, wie der Alte aussieht. Weil es nicht gut ist für ihn, wenn er es mit dem Alten zu tun bekommt. Weil es zu gefährlich ist für ihn.
Der Junge hat etwas Grünes an, das ein Brother von weither dagelassen hat. Etwas Grünes mit seltsamer Aufschrift. Ich mag die Sachen nicht, die die Menschen von weither dalassen. Alle bei uns im Haus finden sie schön. Ich finde nicht, dass sie schön sind. Sie sehen lieblos aus. Es macht keinen Unterschied, wer sie trägt. Und man hat dann so ein Gefühl, als wäre es egal, welcher Morgen kommt oder ob man zu den Göttern betet. Manchmal habe ich Angst, dass es wirklich egal ist. Dass wir eh verloren sind. Aber das darf man nicht denken. Man denkt es trotzdem. Unbeabsichtigt. Wenn die Nacht draußen weit ist wie eine schwarze Wüste, die den Hunden gehört, den Hunden und Gaunern. Und wir Kinder dicht an dicht in den Stockbetten liegen. Aber zeigen darf man es nicht, keinesfalls.
Rinki und Prakash dürfen zur Schule gehen. Sie dürfen die Schuluniform anziehen. Das Blau der Uniform ist schön. Die Faltenröcke der Mädchen leuchten schon von weitem, wenn sie nachmittags in Gruppen den Hügel heraufkommen. Helles Blau. Blaues Glück. Ich mag die Farbe Blau. Sie leuchtet in meinen Träumen.
Der Junge ist seltsam. Seine nackten Füße patschen über den Boden aus Erde und Steinen. Hier an der abfallenden Stelle hat sich ein Rinnsal schmutziges Wasser gebildet, und die Steine sind schlüpfrig.
Patsch, patsch.
Tage und Nächte hat er nur geheult. Ohne Unterlass geheult. Dünn ist er. Und klein. Ein Hauch von einem Nichts. Aber auch in einem Hauch von einem Nichts können Tränen sein.
Ich weiß noch, wie es war, als er so geweint hat. Er hat nicht leise geweint, so wie andere. Er hat laut geweint. Auch nachts. Besonders dann.
Wir alle waren deshalb aufgekratzt und unruhig und sind aufeinander losgegangen.
Am dritten Tag ist er weggelaufen. Gleich am Morgen nach dem Reis. Śarana, der gute Mann, war nicht da. Und auch keine Brothers und Sisters von weither. Housemother hat mich losgeschickt, nach ihm zu suchen. Weil ich älter bin als die anderen und schon reifer. Das denkt Housemother zumindest. Und sie denkt, dass ich mich damit auskenne. Viele von uns Kindern laufen ja am Anfang weg. Seltsam, ich selber bin nicht weggelaufen. Jedenfalls nicht von hier.
Das Weglaufen ist sowieso nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass man fast immer gefunden wird, wenn man wegläuft. Ich will nicht dran denken, was passiert ist, als ich einmal gefunden wurde. Das war an einem anderen Ort. Ist aber noch nicht lange her. Ich will nicht dran denken und kann doch nicht anders. Wie sie mich an den Wagen gebunden haben. Wie ich über den Boden geschleift wurde.
Die Augen des Jungen sind vorsichtig. Sie verweilen nie lange an einer Stelle. Seine Augen haben Angst. Angst vor dem, was sie sehen könnten. Angst vor dem, was sie schon gesehen haben.
Der Junge ist damals nicht weit weg gelaufen. Er ist im Keller eines Hauses gewesen, hat er gesagt. Dann hat man ihn gefunden, und sie jagten ihn weg. Sie haben ihn nicht zu uns zurückgebracht, obwohl sie wussten, dass er wahrscheinlich zu uns gehört. Sie haben sich nicht drum gekümmert. Die Leute in der Gegend mögen uns nicht.
Der Junge hat sich unten in der Tempelanlage von Budhanilkantha herumgetrieben. Nahe am trüben Wasser, wo der steinerne Vishnu liegt und schläft, tief schläft auf der Weltenschlange Ananta, die über seinen Schlaf wacht. Über den Jungen wachten nur die alten Sadhus mit ihren bemalten, ausgezehrten Gesichtern. Die Sahdus und Tauben. Der Junge konnte nicht wegfliegen wie die Tauben. Er konnte nur rennen. Schnell rennen. Aber ich habe ihn erwischt in den Gassen.
Ich weiß noch, was ich alles zu ihm gesagt habe. Ich weiß noch, dass ich gesagt habe: Du brauchst nicht wegzulaufen. Du hast es gut bei uns in dem Haus, das Recovery Home heißt. Unter den Gipfeln des Shivapuri. In unserem Haus ist es gut. Du bist nicht allein. Über ein Dutzend anderer Kinder sind da. Śarana, das ist ein guter Mann, habe ich gesagt. Freundlich. Und ganz und gar nicht wie die anderen. Er kümmert sich um jeden von uns. Um die Kleinen, die erst sechs oder sieben sind, genauso wie um die Älteren. Und um dich wird er sich auch kümmern. Du musst nicht mehr für einen bösen Sir oder eine grausame Maharani arbeiten, habe ich gesagt. Die dich quälen. Das Arbeiten ist jetzt vorbei. Endgültig vorbei. Auch, wenn du es nicht glauben kannst. Du bist frei – so wie wir anderen Kinder auch. Du kannst spielen, mit uns auf den Playground gehen. Housemother passt auf uns auf. Und wer weiß, vielleicht kannst du schon bald zurück ins Dorf zu deiner Familie. Das habe ich gesagt. Ich habe nicht gelogen. Ich habe alles gesagt, was Śarana immer zu uns sagt. Ich habe sogar versucht, seine Stimme nachzuahmen, die manchmal so sanft ist, dass nichts gegen sie bestehen kann. Auch nicht das Tönen von Kathmandu. Kein Hupen, Knattern und Rufen. Nicht das Hundegebell und die vielen Handglocken, die ihre Töne in der Luft verstreuen, um das Ohr eines Gottes zu finden. Kein lautes, schleimiges Ausspucken, und was da noch alles ist. Nichts kommt gegen Śaranas Stimme an, wenn sie sanft ist. Auch nicht die Schreie in mir.
Damals hat mich der Junge noch kein bisschen gekannt. Ich weiß nicht, ob er mir zugehört hat. Ob er alle meine Worte überhaupt richtig verstehen konnte.
Manchmal verstehen mich die Kinder nicht. Meine Sprache ist nicht mehr Nepali, die Sprache der Heimat. Meine Sprache ist Hindi, die Sprache der Ferne, in die man mich gebracht hat, als ich noch kleiner war als der Junge. Die Sprachen ähneln sich. Viele Wörter sind gleich oder klingen verwandt. Die Lieder, die in dem schwarzen Fernsehkasten gesungen werden, sind Hindi. Die Kinder kennen sie und singen mit. Wenn ich rede, ahmen sie mich manchmal nach, und sie machen es ziemlich gut. Trotzdem sind es zwei verschiedene Sprachen.
Etwas an mir muss aber überzeugend für den Jungen gewesen sein. Denn er ist freiwillig zurückgegangen zum Haus. Seitdem hängt sich der Junge an mich. Erst ist er vor mir weggelaufen, und jetzt folgt er mir überallhin. Es ist schwierig mit ihm.
Da ist der Alte. Er schleicht um die Kleinbusse am Budhanilkantha-Platz. Wie immer. Ich erkenne ihn sofort. Er späht und wartet. In die staubige Weite des Vormittags, in der Raum ist für so viel Bewegung, Herzschlagen, Tod. Helle Schwaden gleiten durch die Luft, hüllen die Busse ein. Der Staub fällt auf die Menschen herab. Auf die roten Saris, die dreiteiligen Kurtas. Auf abgewetzte Hosen. Auf die Waren der Händler, auf Stoffe, Kartoffeln, Kürbisblätter, Zwiebeln, Blechgeschirr. Auf das Holzbündel, unter dem die kleine Frau verschwindet. Auf die Ziege, die aus einer schlammigen Pfütze trinkt mit ihrer rauen Zunge.
Da sind die jungen Männer, die bei den Bussen stehen und warten und die Richtung hinausbrüllen, in die ihr Bus fährt. Die Busse sind immer überfüllt. Die Leute stehen geduckt drin. Ein Durcheinander ist das aus Ellbogen, Knien, Ungeduld. Die Kerle kassieren das Geld für die Fahrt – 30 Rupien, manchmal ein bisschen mehr. Und wenn Menschen von weither da sind, viel mehr. Aber das kommt hier fast nie vor, nein. Die Typen halten die Geldscheine in Händen – kleine Scheine außen, große Scheine innen –, und wenn der Bus anfährt und schwarzen Rauch spuckt, springen sie hinein und knallen die Schiebetür zu. Dann recken sie den Oberkörper aus dem Fenster und brüllen die Halteorte auf die Gassen hinaus, wo ein kleiner Bus im Gewühl der Fahrzeuge und Menschen nichts mehr zählt.
Der Alte wartet, späht. Wir sind noch weit genug entfernt. So dass er uns nicht sehen kann.
Ich hätte Tarun nicht mitnehmen sollen. Dass er dabei ist, wird für Probleme sorgen. Ganz egal, wie’s läuft. Aber wenn ich den Jungen jetzt zurück zum Haus schicke, verpetzt er mich. Man muss auf der Hut sein. Auch vor den anderen Kindern. Besonders vor denen. Sie sind klein, aber sie haben Klauen und Zähne. Sie setzen sie ein. Manchmal wissen sie nicht, was sie tun. Und manchmal wissen sie’s genau. Dann ist die Gefahr am größten.
Das letzte Mal, als ich verpetzt wurde, war nicht gut. Śaranas Stimme ist nicht sanft gewesen.
Ich muss dem Jungen das Gefühl geben, dass wir zusammengehören. Ein Team sind.
Aber sehen darf der Alte den Jungen nicht.
Der Junge schaut mich an. Er ist aufgeregt und quasselt mit seiner hellen Stimme, die wie eine Pfeifdrossel klingt. Ich sage ihm nicht, dass da drüben schon der Alte ist und wartet. Ich sage ihm jetzt nur, dass ich allein weitergehen werde und er hierbleiben soll. Ich sage ihm, dass er beim Laden an der Ecke den Beaten Rice kaufen soll, wie es uns Housemother aufgetragen hat. Den Beaten Rice und das bisschen Faden zum Ausbessern der Klamotten. Ich gebe ihm den Geldschein von Housemother. Und ich gebe ihm noch eine Münze. Die einzige Münze, die ich habe und die Śarana mir gegeben hat. Für die Münze gibt es zwei gelbe Bonbons.
– Wir treffen uns wieder hier, sage ich. Ich beeile mich.
Er quasselt weiter, will wissen, wo der Alte ist. Ich rede streng mit ihm. Ich kann mich nicht länger um ihn kümmern. Ich lasse den Jungen jetzt zurück. Ich hoffe, dass er wartet. Dass er nichts Dummes macht.
Ich verschwinde in Richtung des Alten.
Ich werde es schnell hinter mich bringen, und dann habe ich wieder etwas, das ich Krishna geben kann. Bis alles abbezahlt ist. Es wird nicht mehr lange dauern. Noch ein paar Mal zum Alten gehen … noch ein paar Mal …
Krishna wird lächeln. Auf seine offene, verschlagene Art.
Ich hoffe, dass Krishna Wort hält.
Keine Sorge, Junge. Du kannst auf mich zählen. Das sagt er immer, wenn ich zu ihm und seinen Leuten komme. Aber ob es stimmt, das sagt niemand.
Der Alte hat mich entdeckt. Er grinst mit seinem breiten Mund. Obwohl es nichts zu grinsen gibt.
Ich will auf meine Bewegungen achten, wenn ich mich ihm nähere. Ich will, dass sie weich aussehen, geschmeidig. Ich will nicht, dass mein Körper sagt: Ich habe Angst.
Ich tue, was ich immer tue, kurz bevor ich den Alten treffe. Ich denke fest an die Zeichnung oben in meiner Mappe. Die Zeichnung von dem Mädchen. Ich selber habe das Mädchen gemalt. Das Mädchen ist hellhäutig und hat große Augen. Das Mädchen hat große Augen und ist weiß und hat ganz hohle Wangen und ein spitzes Kinn. Die Lippen sind schmal, und die Nase ist klein. So sieht das Mädchen aus, das ich gemalt habe. Das Mädchen sieht so aus, damit niemand weiß, wer das Mädchen wirklich ist. Es ist Shakti. Nur ich weiß das. Das Mädchen, das ich gemalt habe, sieht in Wahrheit ganz anders aus. Das Mädchen, das ich gemalt habe, ist nicht schön. Aber in Wahrheit ist sie es.
Ich mag den Ort nicht. Ich mag den Mann hinter der Theke nicht, der uns Kinder immer wegscheucht und nur nett ist zu den Leuten, die zahlen. Nie gibt er uns auch nur eine einzige Flasche von einem süßen Getränk, obwohl er viele davon hat. Sehr viele. Wenn ich aber mit dem Alten hier bin, scheucht mich der Mann nicht weg. Er legt die Hände für ein »Namaste« aneinander. Ich mag den Ort nicht.
Draußen ist ein Garten mit etwas Grün. Der schimmert angenehm in der Sonne. Und Frauen knien dort draußen und waschen das Geschirr. Aber wir setzen uns nie nach draußen. Immer gehen wir nach oben in das Zimmer, wo der Alte seine Sachen hat. Da ist es schattig. Das offene Viereck des Fensters ist mit einem Tuch verhängt, in dem sich der Wind verfängt. Es riecht hier wenig nach Räucherwerk und viel nach Schnaps und ein bisschen nach Bast und streng vom Abtritt in der Ecke.
Da ist der Tisch, an dem wir sitzen, auf dem eine Schicht Staub liegt. Der Alte ist stolz auf den Tisch. Der Tisch kommt aus einem anderen Land.
– Du wirst da nie hinkommen, hat der Alte gesagt. So weit schaffst du’s nicht, Junge.
Dabei müsste er es besser wissen. Ich habe fast mein ganzes Leben in einem anderen Land verbracht. Einem riesigen Land: Indien. Für mich war das Land nicht riesig. Für mich bestand das Land aus ein paar fleckigen Wänden ohne Fenster, langen, dunklen Gängen, einem kalten Küchenfußboden, aus Betten, die nie sauber zu kriegen waren. Das heißt, selbst wenn sie sauber waren, sind sie nicht sauber gewesen. Sie sind nicht sauber gewesen, weil der Herr gesagt hat, dass sie nicht sauber waren. Trotzdem bin ich dort gewesen, in diesem Land. Und ich habe es auch zurückgeschafft, und ich habe überlebt.
Ich mag es nicht, an seinem Tisch zu sitzen. Fühle mich unwohl dabei. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Im Haus sitzen wir Kinder immer auf dem Boden. Ich denke an den Jungen und frage mich, was er treibt. Ob er die gelben Bonbons schon gelutscht hat. Ob er wartet. Sein kleiner Körper ist immer unruhig. Zappelt, will sich bewegen. Seine dürren Beine wollen laufen.
Es stimmt, man kommt weit, wenn man in Bewegung ist wie der Junge. Manchmal kommt man weiter, wenn man gar nichts tut. Aushalten nennt man das.
Das Mädchen bringt ein Tablett mit einer Tasse für den Alten, in der Chiyaa ist. Kleine Wolken steigen aus der Tasse. Das Mädchen hält das Tablett gut fest. Sie macht das sehr gut. Ich erinnere mich noch an die Stimme des Herrn im Hotel und wie sie durch die Räume schallte, wenn er die Mädchen anbrüllte und ihnen klarmachte, was sie zu tun und zu lassen hatten.
Dieses Mädchen hier macht es gut. Ihr Rücken ist gerade, aber ihre Lippen lächeln nicht. Die Mädchen im Hotel haben wenigstens ab und zu gelächelt. Dieses Mädchen hier lächelt nie.
Der Alte schlürft Chiyaa. Der Alte will wissen, was es Neues gibt. Es gibt kaum Neues. Aber das ist dem Alten egal. Er will alles wissen. Das ist die Abmachung, immer wieder. Ich halte mich dran. Ich weiß, wofür ich es mache.
Wissen, ja, ich habe das verstanden. Wissen, das bedeutet etwas. Wissen, das bedeutet, dass man den Dingen nicht ausgeliefert ist. Wenn man den Dingen nicht ausgeliefert ist, kann man genauso gut Herr über sie sein. Und auch Herr über andere Menschen, die selber Herr über gar nichts sind. Das ist etwas. Das ist viel.
Der Alte schlürft Chiyaa, und ich erzähle ihm, dass Housemother immer noch Rückenschmerzen hat und auf der Matte liegt und viel Ruhe braucht und leise wimmert, wenn sie schläft. Ich erzähle dem Alten, dass der Brother von weither wieder da war. Und die Sister, die Nele-Sister heißt – mit ihren Haaren so hell wie gleißendes Licht. Ich erzähle dem Alten, dass sie wieder für uns gemalt hat und wir Sätze gelernt haben auf Englisch: Ich heiße Achanda. Ich bin fünfzehn Jahre alt. Ich erzähle dem Alten, dass Śarana in der letzten Zeit dreimal dagewesen ist. Er hat Hefte für uns mitgebracht, zum Schreiben. Er hat müde ausgesehen. Die Leute, die über uns im Haus wohnen, haben sich beim Landlord beschwert, weil wir zu viel Krach machen. Der Landlord hat keine Geduld. Der Landlord hört weg. Er hört nicht, wie sanft Śaranas Stimme ist. Śarana muss sich vielleicht nach einem neuen Haus für uns umsehen. Śarana hat immer viel zu tun. Śarana muss Medikamente kaufen für Housemother.
Śarana hat geschlafen, auf dem Boden. Er hat sich ganz klein gemacht, fast so klein wie wir Kinder sind. Und Raj ist zu ihm hingekrochen, hat ihn auf die Wange geküsst. Das macht Raj immer. Er will sich bei Śarana einschmeicheln.
Der Alte mag Śarana nicht. Er mag nicht, dass Śarana gut zu uns Kindern ist. Er findet, Śarana sollte sich um seine eigenen Sachen kümmern und nicht um uns Kinder. Er findet, dass wir Kinder faul sind. Kinder müssen arbeiten, findet der Alte. Besonders die Mädchen. So will es die Tradition. Was für einen Sinn hat es, sie in ein Haus zu stecken, wo sie tun und lassen können, was sie wollen, und verwöhnt werden wie Prinz und Prinzessin? Was haben ihre Eltern davon, denen sie verpflichtet sind? Machen sie ihnen Ehre? Und der Gemeinschaft? Den Ahnen? Kinder haben Pflichten, findet der Alte. Und Śarana auch. Śarana ist feige, findet der Alte. Śaranas Vater war in der Verwaltung des zweitgrößten Krankenhauses von Kathmandu angestellt. Śarana hat studiert und hatte die besten Noten. Śarana hätte etwas aus sich machen können. Aber er weicht seinen Pflichten aus und wirft sein Leben weg.
– Du, Junge, machst es richtig, sagt der Alte. Du weichst den Pflichten nicht aus. Nicht wahr, Junge?
Ich denke fest daran, dass unser Treffen gleich vorbei ist. Dass ich es bald geschafft habe. Zumindest für heute. Gleich kann ich abhauen von hier. Ich schaue den Alten an, der nichts mehr sagt. Dem Alten wachsen Büschel aus den Ohren. Er hat ein zufriedenes Gesicht, mit Augen, die mich gelassen ansehen. Keine Augen, die Angst haben. Ich versuche, mich nicht von ihnen beirren zu lassen. Ich habe mich nicht gedrückt. Ich bin wieder hierhergekommen und habe meine Aufgabe erfüllt. Ich kann stolz auf mich sein. Zumindest ein bisschen. Der Alte kann sich nicht beschweren. Und Krishna wird sich auch nicht beschweren können.
Gleich habe ich es geschafft, denke ich. Gleich steht der Alte auf und geht hinüber zu dem Stoffbeutel, der am Nagel an der Wand hängt. Wie immer. Er wird die zwei Zigaretten für mich herausholen, wie immer. Und das Geld. Das Geld ist das Wichtigste. Ich denke an Krishna, der seine Hand öffnet und lacht. Und an Shakti denke ich. An ihre langen fettigen Haare, die sie sich nicht abschneiden lässt, obwohl sie voller Läuse sind. Daran, wie grob sie oft ist. Wie sie die scheue Misha geboxt hat. Wie freudig ihre tiefschwarzen Augen aufblitzen, wenn sie eines ihrer Lieder singt.
Gleich steht er auf, der Alte, denke ich. In jedem Augenblick.
Aber der Alte steht nicht auf. Der Alte bleibt sitzen. Er schlürft seinen Chiyaa, bis kein Schluck mehr ist in der Tasse. Er sitzt da. Er sagt nichts. Er sieht mich an.
Dann steht er doch auf. Aber geht nicht hinüber zum Stoffbeutel. Er bleibt stehen und reckt sich. Sein T-Shirt rutscht ein Stück nach oben, und ich sehe seinen Bauchnabel und die Haare um seinen Bauchnabel. Irgendwas stimmt nicht, denke ich. Der Alte macht zwei Schritte um den Tisch herum. Ich schaue auf seine Hände. Versuche zu erkennen, ob sie zittern. Wenn die Menschen freundlich reden, dann folgen fast immer Schläge. Ich weiß das. Ich habe es oft genug erlebt. Und der Alte hat freundlich geredet. Hat er zu freundlich geredet?
Er bleibt stehen. Links von mir steht er und nah am Tisch. Von unten schaue ich auf ihn. Ich darf seine Hände nicht aus dem Blick lassen. Besonders auf seine linke Hand muss ich achten, die Unreine, die man beim Toilettengang verwendet. Menschen, die zuschlagen, benutzen meistens die unreine Hand. Sie tun das, ohne darauf zu achten. Aber ich habe darauf geachtet. Meine Arme sind bereit hochzuschnellen und seinen Schlag abzuwehren. Aber die Hände des Alten zittern nicht. Er bleibt stehen und schaut auf mich herab. Er grinst. Obwohl es nichts zu grinsen gibt.
Ich höre ihn sagen:
– Du willst dein Geld haben, nicht wahr?
Ich höre ihn sagen:
– Ich sage dir was, heute gibt’s kein Geld. Es gibt erst das nächste Mal wieder Geld. Vielleicht. Es gibt das nächste Mal Geld, wenn du etwas für mich tust. Nur dann. Weißt du, ich will nämlich etwas haben. Etwas, das du mir besorgen kannst. Du bist ein tüchtiger Junge. Ich habe mich immer auf dich verlassen können. Aber weißt du, es reicht nicht, einfach nur tüchtig zu sein. Sehr selten sogar. Das weißt du doch.
Ich höre diese Worte. Jedes einzelne von ihnen und weiß genau, was sie bedeuten. Ich höre seine Worte und blicke jetzt nicht mehr auf die Hände des Alten. Das ist nicht mehr nötig. Jetzt blicke ich auf meine eigenen Hände. Sie liegen auf meinen Oberschenkeln, und meine Hände sind dunkelbraun und zerfurcht und schmal. Sie haben nichts zu fassen bis auf die dünnen Oberschenkel, und sie tun weh, weil das Nichts weh tut, und das Nichts tut immer am meisten weh, und mit Nichts kann man nicht zu Krishna gehen.
Ich höre den Alten sagen:
– Du weißt doch, dass es nicht ausreicht, hierherzukommen, um mir Geschichten zu erzählen. Irgendwann reicht das nicht mehr. Was sind Geschichten gegen das, was man selber fühlen und anfassen kann?
Wenn du mir bringst, was ich haben will, wirst du auch wieder was kriegen. Vielleicht wird es dann sogar mehr für dich geben. Stell’s dir vor. Da, wo etwas ist, da ist mehr. Für dich. Aber zuerst einmal für mich. Du sollst was finden und zu mir bringen. Etwas, das mir gefällt. Das mir Freude macht. Was du finden sollst, ist nicht groß. Es ist klein. Und weich. Und es riecht gut. Nach den violetten Blüten der Bougainvillea. Nach Nelken, Kardamom und anderen Gewürzen. Und ein klein bisschen wie Geschöpfe der Tiefe riechen, weißt du. Wie der Fisch im blauen Meer. Das Meer ist weit weg, Junge. Aber das, was du mir holen sollst, ist ganz nah. Und dein Glück ist auch nah. Wenn du mir holst, was ich will.
– Was soll ich denn holen?, frage ich.
Er sagt es mir.
Er sagt es mir, ohne dass seine Stimme klein wird und verlegen. Und ängstlich. Nein, seine Stimme wird groß, so groß wird sie und ist satt und feucht wie der Regen, der in einigen Wochen über das Land kommt, und wie Regen stürzen seine Worte auf mich herab – jetzt und hier – und spülen mich fort.
– Da ist ein Mädchen, sagt der Alte. Du kennst es. Es wohnt bei euch, im Haus. Ich hab es oft gesehen, wenn Housemother es losschickt, Einkäufe zu machen, das Wasser zu holen. Ich sehe es, wenn ihr auf dem Playground seid. Ich mag, was ich sehe. Ich mag, wie ölig ihr Haar glänzt, wenn sie es offen trägt, und ich mag es mit Zöpfen. Mit bunten Bändern in den Zöpfen. Ich mag, wie das Mädchen herumhüpft und dann stolziert, als wäre es erwachsen. Ich mag ihr rundes Gesicht. Und weißt du, Junge, manchmal kann ich gar nicht schlafen, weil ich es so mag. Und ich möchte, dass du mir etwas von dem Mädchen holst. Etwas, das mir das Mädchen nahebringt. Ganz nah. Etwas Intimes. Ich will, dass du mir das kleine Höschen bringst, das das Mädchen unten herum anhat und das niemand sieht, unter dem Stoff, den sie drüber trägt. Das Höschen, das ganz nach ihr riecht. Nach dem Feuchten da unten. Ich weiß, dass du es kannst, Junge. Du bist geschickt. Es wird einfach sein für dich. Du sollst es stehlen, wenn es nach der Wäsche zum Trocknen aufgehängt wird. Dann kriegst du dein Geld. Und wenn du noch mehr Geld haben willst, dann stiehlst du es, wenn es nicht gewaschen ist. Dann habe ich noch mehr Freude dran. Gleich, wenn sie es ausgezogen hat, stiehlst du es und kriegst mehr Geld.