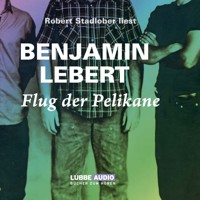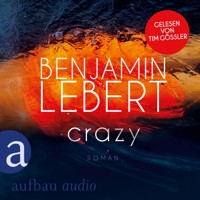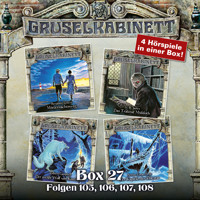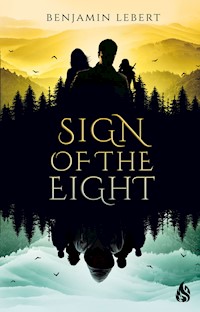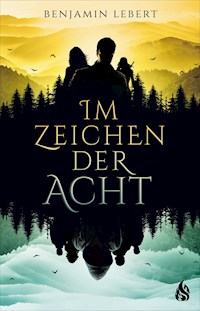9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wann immer wir von einer großen Liebe erzählen, erzählen wir letztlich eine Spukgeschichte." Benjamin Lebert erzählt von einer Liebe im Rhythmus der Gezeiten - und von der Faszination, die die Rätsel der Vergangenheit uns aufgeben. Johannes Kielland ist ein junger Historiker, der seit seiner Kindheit ein leidenschaftlicher Sammler von Berichten über mystische Begebenheiten ist. Nun wird eine der Geschichten, die er ausgegraben hat, plötzlich lebendig. Die Frau eines in Sylt gestrandeten Toten wendet sich an ihn und erzählt ihm die Geschichte einer mysteriösen Beziehung und eines geheimnisvollen Handschuhs. Immer tiefer verstrickt sich Kielland in das fremde Schicksal, und die Wahrheit, nach der er sucht, erscheint unergründlich und trügerisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Benjamin Lebert
Mitternachtsweg
Roman
Hoffmann und Campe
Für alle Heimatlosen
An den Händen eines Menschen lässt sich nicht nur erkennen, was sie im Leben berührt und zu halten versucht haben, sondern auch, was ihnen entrissen worden ist.
Prolog
Er sah den Wagen die schmale Straße entlangrollen, beinahe lautlos durchschnitt er die Abendluft. Ein silbergrauer Mercedes. Er wusste, dass er nun nicht länger zu warten brauchte.
Gerade war die Sonne hinter den Dünen im Meer versunken. Nach und nach schwanden die Farben am Himmel. Durchsichtig legte sich die Sommerdämmerung über die Insel, das Licht der angegangenen Laternen schuf sich Raum.
Der Wagen kam vor dem kleinen Friedhof zum Stehen. Der Motor wurde abgestellt. Die Frau stieg aus. Ein leichter Wind ging, fuhr ihr ins Haar und zupfte an dem Stoff ihres einfarbigen und teuer aussehenden Sommerkleids. Er hörte das Geräusch der Zentralverriegelung, das mit einem kurzen Aufleuchten der Lichter einherging, und das Klackern ihrer Absätze, als sie an die weiße Friedhofspforte trat.
Er stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite, weit genug entfernt, als dass sie ihn hätte bemerken müssen, aber nah genug, um selbst einen guten Blick auf sie zu haben. Hinter ihm das mächtige geschwungene Kirchengebäude, das aus vier halbovalen Backsteinschalen bestand und an eine große Arche erinnerte. Die Friedhofspforte war geschlossen, aber nicht verriegelt. Die Frau rüttelte an der Klinke, bis die Pforte aufsprang. Die Hecke, die den Friedhof umgab, war nicht besonders hoch. Die einheitlichen Holzkreuze zeichneten sich schmal und dunkel in der Luft ab. Er sah, wie sie mit behutsamen Schritten die vorderste Reihe der Holzkreuze entlangging und dann vor dem einen Grab am Ende der Reihe stehen blieb.
Er wusste, dass sie immer wieder zu diesem Friedhof kam. Schon seit mehreren Wochen. Immer in der Dämmerung. Und immer blieb sie vor diesem einen Grab am Ende der Reihe stehen. Ihr Körper war ihm zugewandt. Er sah den hellen Fleck ihres Gesichts. Außer dem Autoschlüssel trug sie nichts bei sich, keine Umhängetasche, keine Blumen. Sie war lang und schmal und schien, als er sie dort stehen sah, etwas Zurückgenommenes, Einfaches an sich zu haben, wie das in den Himmel zeigende Holzkreuz, vor dem sie stand. Sie war die einzige Person, die sich jetzt gerade dort aufhielt.
Zwei Autos fuhren vorüber. Ein abendlicher Spaziergänger tauchte auf, ging an der Friedhofshecke entlang und lief weiter die Straße hinunter. Man hörte seine Schritte verklingen.
Sie blieb geraume Zeit vor dem Grab stehen. Einmal neigte sie sich kurz hinab, wie um mit einer Hand die aufgehäufte Erde vor dem Kreuz glatt zu streichen. Dann wandte sie sich ab und blickte in Richtung der Dünen und in die tiefer werdende Dunkelheit, die vom Meer heranzog.
Er stand im Schatten des Kirchenportals und folgte ihrem Blick. Die nahe Nacht und die heraufkommende Kühle in der Luft spürte er. Und er hörte mit merkwürdig zunehmender Deutlichkeit die Wellen, die auf den Strand schlugen.
Dann wandte sie sich um und ging langsam an den Kreuzen entlang auf die Holzpforte zu, schloss sie hinter sich, entriegelte den silbergrauen Mercedes und öffnete die Autotür.
Er hatte die Straße überquert, trat langsam von hinten an sie heran. Er spürte die Angst, die seinen Körper durchströmte. »Liebes«, sagte er leise, »ich bin hier.«
Sommer 2006 – Ein Mann erhält Post
Es war ein Morgen im Juli, heiß und blendend mit Staubpartikeln im Wind.
Peter Maydell ging durch die Straßen der Lübecker Innenstadt. Er trug einen Anzug, der – wie er hatte feststellen müssen – für diesen Tag zu warm war. An einem Gurt um seine Schulter hing die mit Papieren prall gefüllte Ledertasche, mit der er in den zurückliegenden Jahren als Redakteur für die Lübecker Zeitung schon so oft diesen Weg gegangen war. Sein aufrechter Gang und der federnde Schritt verrieten sein wahres Alter nicht, wohl aber die tiefen Falten und einige Kleinigkeiten, wie der Zipfel seines farblich passenden Einstecktuchs und die goldenen Manschettenknöpfe mit dem grünen Malachit.
Wieder einmal war er in Gedanken bei der Entscheidung, endlich den Schreibtisch in der Redaktion aufzugeben, den er bis jetzt, noch Jahre nach seiner Pensionierung, für zwei Tage in der Woche behalten hatte, um der Zeitung die kleinen Geschichten vom Lande zu liefern, für die er schon in den Jahren seiner festen Anstellung als Redakteur bei den Lesern beliebt gewesen war. »Landeier« hieß die Panorama-Rubrik, die den Leser mit skurrilen Geschichten aus der Provinz versorgte und mit einem Humor, der hier im Norden nicht allzu oft zu finden war, zum Schmunzeln brachte.
Vor dem Überqueren der nächsten Kreuzung zögerte er einen Moment, seine Reaktionen ließen inzwischen zu wünschen übrig. Dann überquerte er die Straße, hielt auf der anderen Straßenseite noch einmal an, um sich eine Welle seines weißgrauen Haares aus dem Gesicht zu streichen, rückte den Gurt seiner Tasche an die richtige Stelle und ging weiter. Er bog in die nächste Straße ein und tauchte in das Spiel aus Schatten und Licht der versetzt stehenden Gebäude in der Morgensonne, das er um diese Jahreszeit besonders schätzte.
Auf dem morgendlichen Weg in die Redaktion war häufig noch nicht abzusehen, wie der Tag am Schreibtisch aussehen würde. Heute allerdings erwarteten ihn zwei Aufgaben, beide wenig dazu angetan, seine gute Laune aufrechtzuerhalten.
Zum einen war da eine Frau, die ihn in der Redaktion besuchen wollte. Sie war die Ehefrau eines ehemaligen Kollegen von der LZ, dessen Stelle vor wenigen Wochen gestrichen worden war. Er hatte den Kollegen, für den die Entlassung aus heiterem Himmel kam, geschätzt und sich zu diesem Gespräch überreden lassen, obwohl er nicht wusste, was sich die Frau davon versprach, und schon gar nicht, was er ihr sagen sollte.
Seine zweite Aufgabe bestand darin, den Artikel über die Treckerparade zu schreiben. Am gestrigen Sonntag waren die Bauern des Umlands mit ihren alten, hergerichteten Traktoren umjubelt durch die Stadt gefahren. Eigentlich eine rührende Sache, diese Parade, fand Maydell, wenn diese Aufgabe nicht schon das sechste Jahr in Folge an ihn gegangen wäre.
Während er im Geiste schon an seinem Schreibtisch saß, überlegte er nun, ob er seinen Bericht mit etwas Positivem oder mit etwas Negativem beginnen sollte. In den letzten Jahren war es ihm immer wichtiger geworden, wie eine Geschichte begann. Das galt für das ganze Leben. Im Anfang fand man den Schlüssel zur Moral einer jeden Geschichte. Nicht an ihrem Ende, wie in den Märchen.
Mit etwas Positivem beginnen hieße in diesem Fall mit dem Eicher-Traktor, der von der Jury zum schönsten Traktor der diesjährigen Parade gewählt worden war. Und das Negative wäre die von fünf umtriebigen Rentnern initiierte Protestaktion, deren Bestreben es in diesem Jahr gewesen war, die Parade aufgrund der Lärmbelästigung in ihrem Wohngebiet zu verhindern.
Er musste daran denken, seine letzten Artikel über die Parade noch einmal zu überfliegen, um sich nicht zu wiederholen.
Und es gab noch etwas, woran er denken musste.
Das Gedicht, das er gestern Abend wieder ausgegraben hatte. Es musste heute vertieft werden, sein besonderes Ritual auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht hatte er sich deshalb über die vielen Jahre seines Lebens einen wachen und erinnerungsfähigen Geist erhalten, denn dieses Ritual hatte er schon lange Zeit, genau genommen so lange er zurückdenken konnte. Eine Woche, ein Gedicht. Das war die Regel.
Maydell liebte die Romantiker. Wenn er eine kurze Zeitreise hätte antreten können, dann wäre seine Wahl auf diese Epoche gefallen, wo die Menschen einen schmerzlich sehnsuchtsvollen Blick in die Weite warfen, die das Leben war, und hofften, sich selbst darin zu erkennen. Obwohl er wusste, dass dieses verklärende Sehnen wenig zu tun hatte mit der Gnadenlosigkeit aller Dinge, gönnte er sich gern diese gedankliche Zuflucht in der Romantik.
Heute war es ein Gedicht aus dieser Zeit, das ihm über die Jahre abhandengekommen war und das er zum letzten Mal gelesen hatte, als er ein junger Mann gewesen war. Plötzlich war es wieder da. Gestern, aus heiterem Himmel.
Hör’, es klagt die Flöte wieder,
Und die kühlen Brunnen rauschen.
Golden weh’n die Töne nieder …
Als er das Gebäude mit der von wildem Wein überwachsenen Fassade erreichte, dachte er, wie schön es war, dass sich die Redaktion noch immer hier im Herzen der Stadt befand. Und er dachte daran, dass er froh sein konnte, diesen Schreibtisch im dritten Stockwerk am Ende des Flures noch zu haben. Er nahm sich vor, in der Angelegenheit seines entlassenen Kollegen heute mehr Elan zu zeigen. Vielleicht konnte er ja tatsächlich etwas bewirken, ein paar Gespräche führen …
Die junge Frau am Empfang überreichte ihm das längliche Paket, das mit einer Schnur umwickelt war. Als Maydell las, wer es ihm geschickt hatte, lächelte er. Wieder eine Zuschrift von Johannes Kielland. Die Sendungen dieses rätselhaften Mannes waren für ihn immer etwas Besonderes. Und er war auch ein bisschen stolz darauf, dass Kielland gewissermaßen seine persönliche Entdeckung gewesen war.
Angefangen hatte es vor zwei Jahren, als er ihm einen Bericht in die Redaktion geschickt hatte – sieben Seiten lang und auf der Schreibmaschine geschrieben. Zusammen mit einem handschriftlichen Brief und der Frage, ob dieser Bericht nicht eventuell für eine Veröffentlichung in der Lübecker Zeitung in Betracht käme.
Maydell hatte nicht vorgehabt, ihn zu lesen. Aber als er einmal beim Schreiben eines eigenen Artikels nicht recht weiterkam, war Johannes Kiellands Text eine willkommene Ablenkung gewesen. Dieser erste von Kielland geschickte Text war ein Tatsachenbericht über ein altes Baumhaus in den Tiefen des Bayerischen Waldes gewesen, in dem in manchen Mondnächten Menschen zusammenkamen, um dort oben, verborgen im Blätterwerk, Rituale durchzuführen, bei denen kleinere Tiere zu Tode kamen. Und er handelte von der Freundschaft dreier Schuljungen, die sich immer zu später Stunde auf die Lauer gelegt und diese Geschehnisse beobachtet hatten.
Maydell hatte – was bei unaufgefordert eingesandten Texten selten vorkam – den Bericht interessiert gelesen und beim damaligen Chefredakteur die Veröffentlichung durchgesetzt. Und seither schickte ihm dieser Kielland in unregelmäßigen Abständen Berichte, manchmal einzelne, manchmal gleich mehrere auf einmal.
Allesamt waren es Texte mit leichtem Gänsehautfaktor, und sie erfreuten sich bei den Lesern wachsender Beliebtheit.
Johannes Kielland schickte die Berichte immer als Postsendung, und obwohl Maydell sie noch mal abtippen musste, um sie bearbeiten zu können, weigerte sich Kielland, das zu ändern, und hatte seine Bitte jedes Mal ohne Begründung abgelehnt, bis Maydell aufgab, danach zu fragen.
Ein einziges Mal hatten sie sich getroffen, an einem Wintertag in einem Café in Hamburg, von dem aus man auf das Wasser der Elbe blicken konnte, auf dem Eisschollen trieben.
Maydell, der nie daran gezweifelt hatte, dass es sich bei Kielland um einen gesetzten Herrn seines eigenen Alters handelte – Typ Oberstudienrat oder zerstreuter Professor –, war nicht wenig überrascht, als ein junger Mann auftauchte, ganz in Schwarz gekleidet, mit langen fettglänzenden Haaren. Er hatte Lidschatten aufgetragen. Die mandelförmigen Augen waren schwarz nachgezogen. Um seinen Hals hingen Bänder mit Ankern und Totenköpfen daran. An den Fingern blitzten schwere Ringe, die Fingernägel waren schwarz lackiert. Um die Hüfte trug er einen silberverzierten Gürtel. Die Gürtelschnalle hatte die Form eines zähnefletschenden Wolfskopfes. Der schwarze Mantel aus Leder, den der junge Mann getragen hatte, reichte bis zu seinen Stiefeln hinab.
Erst an diesem Tag erfuhr er also, dass der Verfasser der ihm zugeschickten Berichte ein 22-jähriger Geschichtsstudent war, der zusammen mit zwei Katzen in Altona wohnte. Ein leidenschaftlicher Sammler von Geschichten über mystische Begebenheiten, der sich gern in antiquarischen Buchhandlungen und in öffentlichen Bibliotheken aufhielt und in seinen schwarzen Kladden alles notierte, was ihm unterkam. Und der ganze Jahrgänge alter Fachzeitschriften aufkaufte, etwa die Kriminalistik, ein Blatt für Polizeibeamte.
Sie hatten über eine Stunde gemeinsam in diesem Café gesessen und sich unterhalten. Obwohl Kielland auf Maydell den Eindruck eines Grüblers machte, war der Blick seiner schwarz umränderten Augen wasserklar gewesen. Daran konnte er sich gut erinnern. Und an seine Stimme, die weich klang, was bei einem Mann, der dieses raue Erscheinungsbild für sich gewählt hatte, überraschte. Und natürlich an die vielen Pausen, die entstanden, weil er nicht so recht wusste, was er außerhalb der Artikel mit dem jungen Mann reden sollte. Auch Kielland schien nicht darauf aus zu sein, ihm mit dem Ehrgeiz eines jungen, aufstrebenden Journalisten sonderlich viele Fragen zu stellen.
Was ein bisschen weiterhalf, war auch hier die Romantik gewesen, mit der sich der junge Student auszukennen schien.
Draußen vor den Fenstern waren die Schneeflocken herabgesunken, und Kielland hatte dann auf seine Armbanduhr geblickt und gesagt, dass es für ihn Zeit wäre, aufzubrechen, er müsse an diesem Nachmittag noch seinen Dienst in der Filiale einer großen Spielwarenladenkette antreten, mit dem er sein Studium finanzierte.
Die beiden Männer verabschiedeten sich in der kalten Winterluft. Maydell sah den jungen Mann in dem langen Ledermantel, der an seinem schmächtigen Körper herabhing und ihm ein enormes Gewicht aufzuerlegen schien, über den glatten Asphalt davongehen. Ein junger Mann, der aussah, als würde er in einer Welt, von der Maydell nichts wusste, einer Bande von finsteren Kriegern angehören, die Gott weiß wofür, aber immer nur im Licht der Sterne in die Schlachten zogen.
Das Paket, das ihm Kielland heute geschickt hatte, war wesentlich schwerer als alle vorausgegangenen.
Da ist ja einiges zusammengekommen, dachte Maydell. Er trug es unter dem Arm die Treppen hinauf in das Redaktionszimmer, das in weichem Blätterschatten lag. Maydell ließ die schwere Umhängetasche schnaufend neben der Tür auf den Holzboden sinken, trug das Paket zu seinem Schreibtisch hinüber, schob die Computertastatur ein wenig beiseite und legte es zwischen Tastatur und einem Stapel von Büchern ab. Dann holte er eine Schere aus der obersten Schreibtischschublade und schnitt die Paketschnur durch.
An diesem Abend konnte sich Peter Maydell nicht auf das Konzert einer bekannten Pianistin konzentrieren, zu dem er mit seiner Frau nach Hamburg gefahren war. Seine Gedanken schweiften umher und kehrten immer wieder zu der Sendung zurück, die er heute von Kielland erhalten hatte. Es hatte sich, entgegen seiner Erwartung, nicht um eine Sammlung mehrerer Berichte gehandelt – sondern um einen einzelnen zusammenhängenden Text, um ein viele Seiten umfassendes Manuskript. Leider hatten ihn die Ereignisse des Tages immer wieder davon abgehalten, sich darin zu vertiefen. Er hatte nur den beigelegten Brief gelesen, der ihn neugierig gemacht hatte, aber nun, je länger er darüber nachdachte, zunehmend beunruhigte:
Lieber Herr Maydell,
dieses wird meine letzte Sendung an Sie sein. Ich will Ihnen die Geschichte erzählen, die das Unheil heraufbeschworen hat, dem ich – wie es jetzt aussieht – wohl nicht mehr entkommen kann. Aber ganz egal, was mit mir geschieht, welches Ende mir persönlich in dieser Geschichte zufällt, letztlich scheint mir nur eines von Bedeutung zu sein: dass es sich hierbei um eine große Liebesgeschichte handelt.
Immer Ihr Johannes Kielland
Peter Maydell hatte Kiellands Sendung mit nach Hause genommen. Das Manuskript lag auf seinem Nachtschrank.
Wie gut, dachte er nun, während das Konzert zu Ende ging, dass es seine Frau nicht störte, wenn er abends im Bett lange las. Er nahm kaum wahr, dass sie sich eben zu ihm hinüberbeugte und ihn auf die linke Wange küsste.
Johannes Kiellands Manuskript
Die Geschichte, die ich hier erzählen will, beginnt an einem Grab. Jedenfalls der kleine Teil der Geschichte, der meine Person betrifft. Ihr ganzes Ausmaß wird von niemandem mehr zu ermessen sein.
Das Grab ist auf einem Friedhof gelegen, den man in wenigen Schritten durchquert hat. Er ist von einer knapp einen Meter hohen Rosenhecke umgrenzt. Auf der weißen Eingangspforte ist die altmodische Inschrift Heimstätte für Heimatlose zu lesen.
Der Friedhof befindet sich auf der von salzigen Winden heimgesuchten Insel Sylt. Wo die Menschen über die Jahrhunderte hinweg ihren Kampf mit dem Meer führen, das sich ihr schmales, langgestrecktes Stück Land einverleiben will. Das Stürme und Fluten hatte kommen lassen, in denen Menschen und ganze Siedlungen verschwanden, das fruchtbare Wiesen und Äcker mit Flugsand überwehte, Körnchen auf Körnchen zu Dünen häufte, Dörfer unter Sand begrub, Schiffe gegen die Küste warf. Wo Schutzmaßnahmen ersonnen wurden, um den brandenden Kräften standzuhalten. Von wo die Männer der Insel über die Jahrhunderte hinausgefahren waren auf das Meer. Um Heringe und Schellfische zu fangen, um Wale zu jagen, und später, um in fernen Gefilden Handel zu treiben, während ihre Ehefrauen zurückgeblieben waren und nach hartem Tagewerk, nachdem das Vieh versorgt, der Boden bestellt, die Hausarbeit getan und der Hunger der Kinder gestillt war, abends in eine Handarbeit vertieft in schummrigen Stuben am Ofen saßen und draußen der Wind durchs Dünengras fuhr und das Meer heranrollte. Beharrlich, gleichgültig. Bis zum heutigen Tag führt es Menschen, die mit ihm in Berührung kommen, die Flüchtigkeit all ihrer Geschichten vor Augen, verleiht ihnen dadurch aber auch einen Wert.
Der Friedhof, von dem hier die Rede ist, liegt in Westerland, hinter den Dünen. Die letzte Ruhestätte unbekannter Schiffbrüchiger, die das Meer an den Strand der Insel gespült hat. Die Gräber sind schlicht. Die Kreuze tragen keine Namen. Nur das Datum der Beisetzung des jeweiligen Toten ist in das Holz eingeschrieben, sowie der Ort, an dem er gefunden wurde – Westerland Strand, Rantum Strand, Hörnum Strand.
Der Friedhof wurde im Jahr 1855 eingerichtet, auf einer weiten sandigen Ebene, die damals nicht zu dem kleinen Ort Westerland gehörte. Der Strandvogt Wulf Hansen Decker hatte sich dafür eingesetzt, dass angespülten Seeleuten eine christliche Beisetzung zuteilwurde. Vorher hatte man sie einfach dort, wo man sie fand, in Dünenschluchten, höchstens in einer Grube im Sand verscharrt. Jede Bestattung kostete Geld. Außerdem fürchtete man die Pest, und es herrschte der Aberglauben, alles, was die See ausspeie, sei verflucht. Strandvogt Decker trotzte der Kirchen- und Ortsgemeinde so lange, bis man ihm den Flecken Erde außerhalb des kleinen Ortes zur Verfügung stellte. Es sollte sich herausstellen, dass die Sylter Bevölkerung Mitgefühl mit den Opfern des Meeres zeigte.
Die Frauen warteten auf ihre zur See gefahrenen Männer, Kinder auf ihre Väter. Und in den Nebeln, die immer wieder vom Meer heraufzogen und die Insel einhüllten, mussten sie sich alle die Frage gestellt haben, ob nicht der eigene Vater oder der Ehemann der nächste Angeschwemmte sein konnte.
Wenn Nachricht kam, dass ein Sylter draußen auf dem Meer den Tod gefunden hatte, dann ging die Frau, der seine Liebe gegolten hatte, vielleicht nach Tagen der Trauer an den Nordseestrand, vielleicht nahm sie ihr Kind an der Hand, und gemeinsam blickten sie auf das weite Wasser hinaus, dorthin, wo keine Blicke außer den ihren hinlangten, hinaus auf das Meer, das den geliebten Mann einbehalten hatte, und sandten ihre Wünsche aus, dass sich seine Seele aus den salzigen, dunklen Tiefen würde befreien können …
Die erste Beisetzung auf dem Friedhof der Heimatlosen fand an einem Tag im Oktober statt. Strandvogt Decker notierte in seinem Protokollbuch über den aufgefundenen Toten: »Auf dem rechten Arm war die englische Flagge und auf dem linken der gekreuzigte Jesus tätowiert, sonst ohne Kennzeichen.« Die Leiche wurde vom Landvogt untersucht und in einen nach Landessitte gefertigten schwarzen Sarg gelegt. Man hob den Toten auf einen Bauernwagen und transportierte ihn zu dem Friedhof, wo sich bereits einige Menschen eingefunden hatten – die Frauen trugen Strickjacken, darunter Kleider aus grobem Stoff, und um die Köpfe hatten sie Tücher gewickelt, die die Ohren warm hielten. Die Männer trugen Mützen, wetterfeste Mäntel und genagelte Stiefel. Das Geräusch der sich am Strandufer brechenden Wellen – für die Sylter das beständige Tönen der Welt – drang herüber, und durch die Luft wirbelten Regentropfen. Eine kurze Einweihungsrede wurde gehalten, und dann ließ man den Sarg an Stricken in die Grube hinab.
Elisabeth zu Wied, Königin von Rumänien, hielt sich zu dieser Zeit häufig auf der Insel auf. Sie war nicht nur Königin, sondern auch eine Dichterin, die empfänglich war für Stimmungen und den leisen Herzschlag von Geschehnissen, die letztlich unergründlich blieben. Sie sollte dem Friedhof später seinen Namen geben und einen Gedenkstein stiften, den man noch heute dort finden kann. Gegenüber der Eingangspforte, am Ende des kleinen Friedhofs, ragt der unbehauene Granitblock aus der Erde, in den eine verwitterte silbergraue Marmortafel eingelassen ist mit den letzten Zeilen eines Gedichts:
Wir sind ein Volk, vom Strom der Zeit
Gespült zum Erdeneiland,
Voll Unfall und voll Herzeleid,
Bis heim uns holt der Heiland.
Das Vaterhaus ist immer nah,
Wie wechselnd auch die Lose,
Es ist das Kreuz von Golgatha,
Heimat für Heimatlose.
Insgesamt sollten im Verlauf eines halben Jahrhunderts 53 Menschen auf diesem Friedhof beerdigt werden. Nur ein einziger Toter konnte anhand eines Schlüsselbundes identifiziert werden: der 17-jährige Hamburger Schiffsjunge Harm Müsker. Es war der Wunsch seiner Angehörigen, die sich eine Überführung der Leiche nicht hatten leisten können, dass auch er auf dem Sylter Seemannsfriedhof beigesetzt wurde.
1905 wurde Westerland Stadt. Das Kirchenkollegium beschloss, dass Angeschwemmte von diesem Jahr an auf dem städtischen Friedhof an der St.-Niels-Kirche beerdigt werden sollten.
Erst im Spätsommer des Jahres 2005, nachdem hundert Jahre vergangen waren, kam es wieder dazu, dass man einen Toten auf dem Friedhof der Heimatlosen beisetzte. Diese Ausnahme war der Grund für meinen ersten Besuch auf der Insel und der Inhalt eines Artikels von mir, der bald darauf in der Lübecker Zeitung erschien.
Bei der Leiche handelte es sich um einen Mann von ungefähr zwanzig bis dreißig Jahren. Auch er vom Meer angespült, gefunden in den Dünen, nicht einmal einen Kilometer vom Friedhof der Heimatlosen entfernt. Früher wäre er in das Protokollbuch des Strandvogts Decker eingetragen worden. Jetzt wurde er im abschließenden Bericht eines Polizeibeamten erwähnt. Und in einer Notiz im Sylter Anzeiger, einer Zeitung, die ich abonniert hatte. Solche kleinen Blätter waren oft die Quellen meiner Geschichten.
Als ich nach Sylt fuhr, um für meinen Artikel zu recherchieren, hörte ich in meinen Gesprächen immer zuallererst den Namen eines kurz zuvor verstorbenen Sylters, von dem alle eine hohe Meinung hatten.
Dieser Mann war 1948 aus französischer Kriegsgefangenschaft nach Westerland zurückgekommen. Aus Dankbarkeit für das eigene Überleben und in Erinnerung an seine gefallenen Kriegskameraden ging er über Jahre hinweg ehrenamtlich die wenigen Schritte von seinem Haus hinüber zum Friedhof der Heimatlosen, um die Anlage sauber zu halten, die Blumenbeete zu versorgen und die Spendenkassette zu leeren, die häufig aufgebrochen wurde. In seinen letzten Lebenswochen hatte er sich mit der Unterstützung vieler anderer Westerländer erfolgreich dafür starkgemacht, dass der nicht zu identifizierende angeschwemmte Tote, der ganz in der Nähe aufgefunden worden war, an keiner anderen Stelle als dort auf dem Friedhof der Heimatlosen begraben wurde. Am Ende kam genug Geld zusammen, um die Bestattung zu finanzieren. Heutzutage werden unbekannte Leichen verbrannt. Das war in diesem Fall anders.
Ich habe damals auch mit dem Kriminalhauptkommissar gesprochen, der für die Ermittlungen im Fall der Wasserleiche zuständig war. Er hieß Hubert Fleissner und war ein Bayer, den es vor Jahren hierher an die Nordseeküste verschlagen hatte. Man glaubte ihm anzusehen, dass er wusste, wie sich ein Küstensturm anfühlte, und dass er sich mit dem Meer auskannte. Man glaubte ihm aber auch anzusehen, dass sich in seinem Innern noch immer das Felsengebirge erhob, das er aus seiner Kindheit kannte.
Fleissner erzählte mir, dass die Leiche des Mannes an einem Morgen im Spätsommer entdeckt worden war, von einer Frau auf einem Strandspaziergang. Das heißt vielmehr von dem kleinen Hund, den die Frau an diesem frühen Morgen ausgeführt hatte, einem weißen West-Highland-Terrier. Die Frau war Astrologin und suchte in der Nebensaison auf der Insel Erholung von ihrer gutbesuchten Heilpraxis, von den Terminen, die schon bis ins nächste Jahr hinein vergeben waren. Allein, ohne ihren Ehemann, nur mit dem Hund.
Als die Leiche entdeckt wurde, hatte sich aus einer winddurchtosten Schwärze gerade der beginnende Tag hervorgekämpft, der noch kühl und diesig war und jedes Land außerhalb dieser Insel in weite Fernen zu rücken schien. Der Hund fand die Leiche, deren Gesicht im feuchten Sand verborgen war, am unteren Rand der dem Strand zugekehrten Dünenseite. Die Frau alarmierte sofort die Polizei.
Der Körper des Toten war aufgeschwemmt. Man drehte ihn um: Die Augenhöhlen waren leer. Sein Mund geöffnet und voller Sand, seine Worte verschüttet. Eine zerrissene Jacke öffnete sich über dem, was einmal ein Pullover gewesen war. Die Hose hielt kaum noch in Fetzen zusammen. Sturmmöwen und Krähen hatten durch die Löcher in der Kleidung Fleischteile losgehackt und ließen sich ungern beim Fressen stören.
Man versuchte, die üblichen Erkundungen einzuholen. Herauszufinden, ob ein Mann in dem betreffenden Alter als vermisst gemeldet worden war, ob jemand in jüngster Zeit von einem Schiff oder Boot ins Wasser gestürzt war. Die Erkundigungen führten zu keinem Ergebnis. Fest stand, dass der Mann ertrunken war und einige Wochen im Wasser getrieben hatte.
Eher nebenbei erwähnte der bayerische Kriminalbeamte noch ein Kleidungsstück, von dem man sich kurze Zeit vergebens erhofft hatte, es könnte zur Feststellung der Identität des Toten beitragen: ein dünner Handschuh, den der Tote an der linken Hand getragen hatte. Offenbar eine Art Schutzhandschuh aus einem nicht zu identifizierenden Material mit sehr widerstandsfähigen Fasern, die weder durch das Salzwasser noch durch scharfe Vogelschnäbel Schaden genommen hatten. Ausgeblichen war der Handschuh sonderbarerweise auch nicht. Er war tiefschwarz. Ein Mann, der ein Berufskleidungsgeschäft führte, wurde zu Rate gezogen, wusste aber nichts Genaueres über den Handschuh zu sagen. Einer von Fleissners Kollegen kam mit der Annahme, dass derartige Handschuhe vielleicht auf den Bohrinseln in der Nordsee Verwendung fanden: Die Annahme erwies sich als falsch. Die Ermittlungen, die in diese Richtung verliefen, ergaben nur, dass offenbar auf keiner der Bohrinseln draußen auf See ein Mann vermisst wurde. Die Sache mit dem Handschuh blieb ungeklärt.
Für Fleissner folgten Gespräche mit seinen Vorgesetzten, mit einem Leichenbestatter und dem Pfarrer der St.-Christophorus-Kirche. Nach den in solchen speziellen Fällen nicht unüblichen Meinungsverschiedenheiten und zur Schau gestellten Eitelkeiten wurde beschlossen, den Handschuh in den Sarg zu dem Toten zu legen und mit ihm hinab in die Erde des Friedhofs zu lassen …
Während ich das schreibe, sitze ich in einem Zimmer auf Sylt. Der Raum ist klein und spärlich beleuchtet. Es ist eines von zwölf Zimmern in diesem Hotel, einem der wenigen, die in diesen sommerlichen Tagen, an denen es auf der Insel von Besuchern wimmelt, noch kurzfristig eines zu vermieten hatten. Das Hotel liegt direkt gegenüber dem Friedhof der Heimatlosen. Mich fröstelt beim Gedanken daran. Trotzdem ist es richtig, hier zu sein. Ganz nah. Ich werde mich dem stellen, was mich erwartet. Ich weiß, was geschähe, würde ich es nicht tun. Ich weiß, warum ich hier bin.
Der Schreibtisch, an dem ich sitze, steht schräg zum Fenster. Draußen ist die Nacht heraufgezogen. Ich spüre die Unruhe des Wassers hinter dem Dünenwall, glaube die Stimmen einzelner Wellen zu hören, ihre Rufe. Ab und zu erzittert das Fenster unter den Windstößen. Die Häuser dieses Ortes, über deren Eingangstüren manchmal Namen stehen wie »Haus Marianne«, »Haus Westerlön« oder »Haus Nordland«, geben sich der Schwärze hin, die der orangefarbene Laternenschein nicht friedlich stimmen kann. Die Häuser sind größtenteils im Bauboom der sechziger Jahre entstanden. Sie sind hässlich, bei Tag und bei Nacht.
Als ich die Insel zum ersten Mal im letzten Spätsommer besuchte, blieb ich drei Tage lang und ging der Recherche für meinen Artikel nach. Ich dachte, es würde nur einer von vielen Artikeln sein, die ich schon geschrieben hatte und noch schreiben würde …
Ich muss an meine beiden Katzen denken – die Laute und die Leise. Die Laute sprang jeden Morgen auf mein Kopfkisten und maunzte in mein Ohr, um endlich zu fressen zu bekommen. Die Leise hielt sich versteckt. Ein Besucher würde ihre Anwesenheit nicht bemerken. Ich bemerkte sie immer. Eine wohltuende Anwesenheit. Manchmal hörte man aus einem verborgenen Winkel meiner Wohnung ein leises Miauen.
Die beiden Katzen waren zwei von fünfunddreißig, die nach Wochen in dem mehrstöckigen Gebäude, in dem ich wohnte, in der heruntergekommenen Bleibe eines illegal in Deutschland lebenden Mannes aufgefunden worden waren. Der Mann hatte sich abgesetzt. Beinahe ein Drittel dieser Katzen war tot. Geschichten sind Wiederkehrer. Ich weiß nicht, wie es meinen Katzen jetzt geht und in welchem Zustand man sie vorfindet, wenn sich jemand eines Tages Zugang zu meiner Wohnung verschafft. Vielleicht sind sie bis dahin verschwunden. Ich habe die Tür zu meinem schmalen Balkon offen gelassen.
Ich frage mich, was wohl geschehen wäre, hätte ich den schwarzen Handschuh, den dieser an die Sylter Küste gespülte Tote getragen hatte, in meinem Bericht ausgespart – so, wie ich es einmal angedacht hatte. Oder wenn ein Redakteur der Lübecker Zeitung dessen Erwähnung herausgekürzt hätte – so, wie manches aus meinen Texten gekürzt wurde. Ob dann alles anders gekommen wäre …
Ich trete ans Fenster und blicke hinaus zu den schmalen Kreuzen auf dem Friedhof. In manchen Schriften, die ich im Laufe meiner Recherche für den Artikel im Sylter Archiv eingesehen habe, wurde er auch als Friedhof der Namenlosen bezeichnet. Unser erster Besitz im Leben ist der Name. Der Name ist ein Gefäß, in das wir unser Leben hineingeben; das, was für die Begrabenen da drüben auf der anderen Straßenseite der Friedhof ist. Eine von Menschen erdachte Heimstätte für Heimatlose. Vielleicht beginnt Heimat manchmal erst dort, wo wir gezwungen sind, unseren Namen zurückzulassen. Ich schließe die Augen, und auf einmal sehe ich den Friedhof vom Meer überspült vor mir, so wie den Friedhof von Alt-Rantum. Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts versank das erste Dorf, das man Rantum nannte, in den Fluten der Nordsee. Noch hundert Jahre später wollen Inselchronisten nach Stürmen an der Seekante der Dünen neben Grundmauern, Brunnen und Einfriedungswällen auch Grabstätten eines Friedhofs im Wasser ausgemacht haben.
In einem stillgelegten Becken im Hamburger Hafen lag ein alter verrosteter Stückgutfrachter, der auf seine Verschrottung wartete. So lange, bis er verschrottet wurde, diente sein Lagerraum als Club.
Ein junger Hamburger, der sich schon vorher damit einen Namen gemacht hatte, an außergewöhnlichen Orten Events zu veranstalten, war rechtzeitig zur Stelle gewesen. In unregelmäßigen Abständen fanden dort Partys statt. Ich hatte gehört, die Menschen, die dorthin gingen, trugen Schwarz und schwelgten in der Finsternis. Menschen wie ich. Und die Musik, die dort gespielt wurde, half ihnen dabei.
In einer Nacht im Oktober des letzten Jahres sollte ich ihr dort zum ersten Mal begegnen.