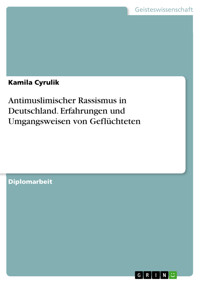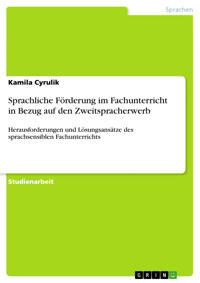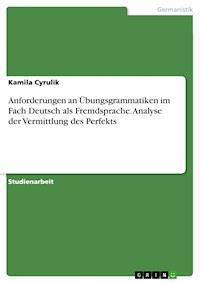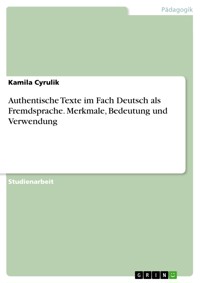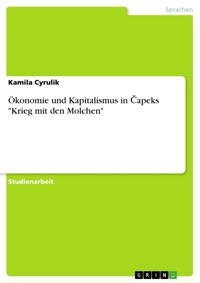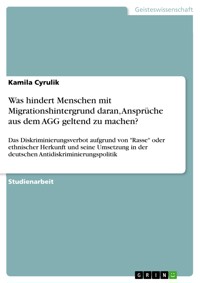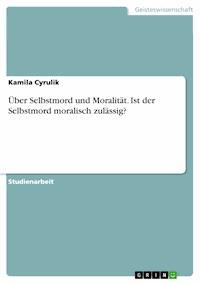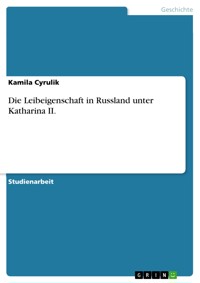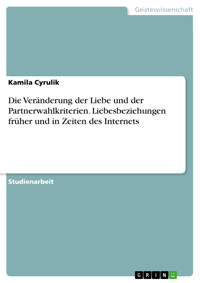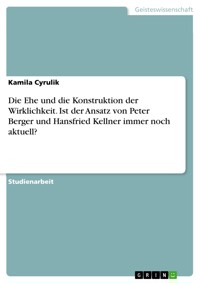
Die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit. Ist der Ansatz von Peter Berger und Hansfried Kellner immer noch aktuell? E-Book
Kamila Cyrulik
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Soziologie - Beziehungen und Familie, Note: 1,3, Universität Trier, Veranstaltung: Wissensoziologie, Sprache: Deutsch, Abstract: Die folgende Arbeit ist der sozialen Konstruktion des Wissens gewidmet. Sie setzt sich mit einem speziellen Fall von Wirklichkeit auseinander, nämlich derjenigen, die in einer Ehe zwischen zwei Menschen entsteht. Mit diesem Thema beschäftigen sich Peter Berger und Hansfried Kellner. Der von den beiden Autoren stammende mikrosoziologische Absatz „Die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Abhandlung zur Mikrosoziologie des Wissens“ wurde im Jahr 1965 veröffentlicht. In diesem gehen sie der Frage nach, welchen Einfluss die Eheschließung auf die Wirklichkeitskonstruktion der Ehepartner ausübt und welche gesellschaftlichen Prozesse mit einer Heirat einhergehen. Wie aktuell ist aber dieses wissenssoziologische Werk angesichts der heute zu beobachtenden Pluralisierung von Lebensformen und damit einhergehenden wachsenden Lebensansprüchen von Menschen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Phänomenologische Grundlagen für Wirklichkeitskonstruktionen
3 Ehe und Familie heute und im Kontext von Berger und Kellner
3.1 Ehe als „Fundament“ der Familie
3.2 Ehe als nomischer Bruch und nomosbildendes Instrument
3.2.1 Ehe als „dramatischer Vorgang“
3.2.2 Der identitätsbildende und stabilisierende Charakter des ehelichen Gesprächs
3.3 Liebe als „Steuerungsinstanz“ der Institution Ehe
4 Schlussfolgerung
5 Tabellenverzeichnis:
6 Literaturverzeichnis:
1 Einleitung
„Auf welcher Weise entsteht gesellschaftliche Ordnung überhaupt? Die allgemeinste Antwort wäre, daß Gesellschaftsordnung ein Produkt des Menschen ist, oder genauer: eine ständige menschliche Produktion. Der Mensch produziert sie im Verlauf seiner unaufhörlichen Externalisierung.“[1]
Wie das obere Zitat von Peter L. Berger und Thomas Luckmann impliziert, haben Menschen einen entscheidenden Einfluss darauf, wie die Realität, in der sie leben, geschaffen wird. Den Tätigkeiten der Menschen kommt somit eine konstruktive Bedeutung bei der Konstruktion der Wirklichkeit zu.[2]
Die Beschaffenheit der sozialen Konstruktion von Wissen und ihr Auftreten im Alltag ist der Gegenstand der Wissenssoziologie. Wesentlich hierbei ist vor allem, dass die Wirklichkeit durch das soziale Handeln der Individuen „erzeugt“ wird.[3] Das wohl wichtigste wissenssoziologische Werk, das alle weiteren Beschäftigungen mit dem Thema hervorrief, geht auf die oben zitierten Soziologen zurück und trägt den Titel „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie.“[4]
Der sozialen Konstruktion des Wissens ist auch die folgende Ausarbeitung gewidmet. Sie setzt sich jedoch mit einem speziellen Fall der Beschaffenheit der Wirklichkeit auseinander, nämlich mit solchem, welcher durch eine Ehe zwischen zwei Menschen entsteht. Mit diesem Thema beschäftigen sich Peter Berger und Hansfried Kellner. Der, von den beiden Autoren stammende mikrosoziologische Absatz „Die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Abhandlung zur Mikrosoziologie des Wissens“ wurde im Jahr 1965 veröffentlicht. Er geht der Frage nach, welchen Einfluss die Eheschließung auf die Wirklichkeitskonstruktion der Ehepartner ausübt und welche gesellschaftliche Prozesse mit einer Heirat zusammenhängen.[5] Die beiden Autoren stellen folgende These auf:
„Wir behaupten, daß in unserer Gesellschaft die Ehe einen im Vergleich zu anderen signifikanten Beziehungen privilegierten Status einnimmt. Anders ausgedrückt: Die Ehe ist in unserer Gesellschaft ein entscheidendes nomisches Instrument. Wir behaupten ferner, daß diese wesentliche gesellschaftliche Funktion dieser Institution nicht verstanden werden kann, wenn dieser Umstand nicht begriffen wird.“[6]
Wie aktuell ist aber dieses wissenssoziologische Werk, angesichts der heute zu beobachtenden Pluralisierung von Lebensformen und damit einhergehenden wachsenden Lebensansprüchen von Menschen?
Mit dieser Frage beschäftigt sich die folgende Arbeit. Dazu werden zuerst die phänomenologischen Grundlagen für die Wirklichkeitskonstruktionen untersucht. Danach wird auf die allgemeine Definition von Familie und die Wichtigkeit von Ehe als die Basis der Familie eingegangen, um dann die wissenssoziologischen Thesen von Berger und Kellner, bezüglich der in einer Ehe stattfindenden Konstruktion der Wirklichkeit, auf die Aktualität zu prüfen.
2 Phänomenologische Grundlagen für Wirklichkeitskonstruktionen
Im Folgenden soll die Grundlage für ein Verständnis des phänomenologisch-wissenssoziologischen Ansatzes von Berger und Kellner gelegt werden. Dies erfolgt zum Teil unter Verwendung des Werkes: „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ von Berger und Luckmann.
Wie in der Einführung kurz angedeutet, folgen Berger und Kellner dem wissenssoziologischen Prinzip der Konstruktion von Alltag und gehen dementsprechend davon aus, dass das Individuum der Schöpfer der Alltagswirklichkeit ist.[7] In dieser Phänomenologie setzt man Intersubjektivität, d.h. die Annahme, dass mehrere Betrachter ein Sachverhalt gleichermaßen wahrnehmen und dementsprechend ähnlich interpretieren, als Grundlage allen sozialen Handelns voraus. Diese Intersubjektivität ist eine Konstruktion des Alltagsverstandes.[8] Berger und Kellner schreiben diesbezüglich Folgendes:
„Jede Gesellschaft hat ihre besondere Art und Weise, die Realität – ihre Welt, ihr Universum, ihr Ensemble von Symbolen – zu definieren und zu begreifen. Dies ist bereits in der Sprache als der symbolischen Basis einer Gesellschaft vorgegeben. Auf dieser Basis und mit ihrer Hilfe entsteht ein vorgefertigtes Typisierungssystem, vermittels dessen die unzähligen Erfahrungen der Wirklichkeit zu ordnen sind. Diese Typisierungen und ihre Ordnung sind Allgemeingut der Gesellschaftsglieder, wodurch sie nicht nur den Charakter der Objektivität annehmen, sondern als gegeben, als die Welt tout court, als die einzige Welt, die der normale Mensch denken kann, genommen werden.“[9]
Das Individuum nimmt somit die es umgebende Welt mithilfe eines gesellschaftlichen Typisierungssystems wahr,[10] welches es laut Berger und Luckmann im Rahmen seiner Primärsozialisation verinnerlichte.[11] Auf diese Weise kann es durch das Zurückgreifen auf den vorhandenen „Wissensapparat“ sein alltägliches Leben ordnen und wird somit von erheblichen kognitiven Anstrengungen des „immer wieder Neues erkennen“ entlastet. Diese Apparat wird auch nomischer genannt und ist, wie Berger und Kellner betonen „biographisch kumulativ“, er dehnt sich also im Zuge der Sozialisation durch die Biographie des Einzelnen immer wieder aus.[12] Es ist dabei sehr wichtig, dass die Abweichungen vom gesellschaftlich vorgebildeten Typisierungsapparat innerhalb der Toleranzgrenzen des gesellschaftlichen Konsensus liegen, damit ein fortbestehender Zusammenhang der Gesellschaft gesichert ist.[13]
Berger und Luckmann sprechen somit von einer intersubjektiven, allen Mitgliedern einer Gesellschaft gemeinsamen Alltagswelt, jedoch ist diese nicht für alle identisch.[14] Denn es geht, wie Berger und Kellner unterstreichen, um scheinbare Objektivität von Realität.[15] Intersubjektivität bei Berger und Luckmann bezieht sich somit nicht auf die gesamtgesellschaftliche Wirklichkeit, sondern auf den kleinen intersubjektiv erfahrenen Ausschnitt der Wirklichkeit.[16]
Dies bringen folgende Worte zum Ausdruck: