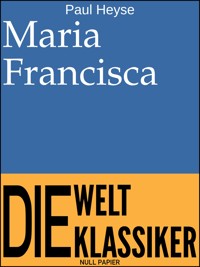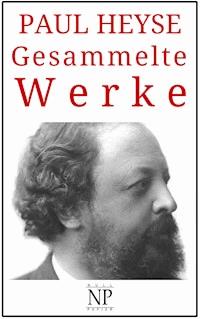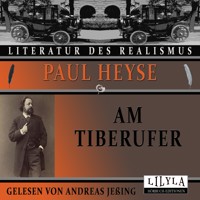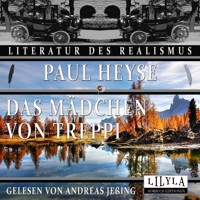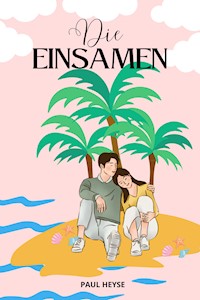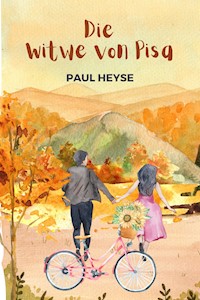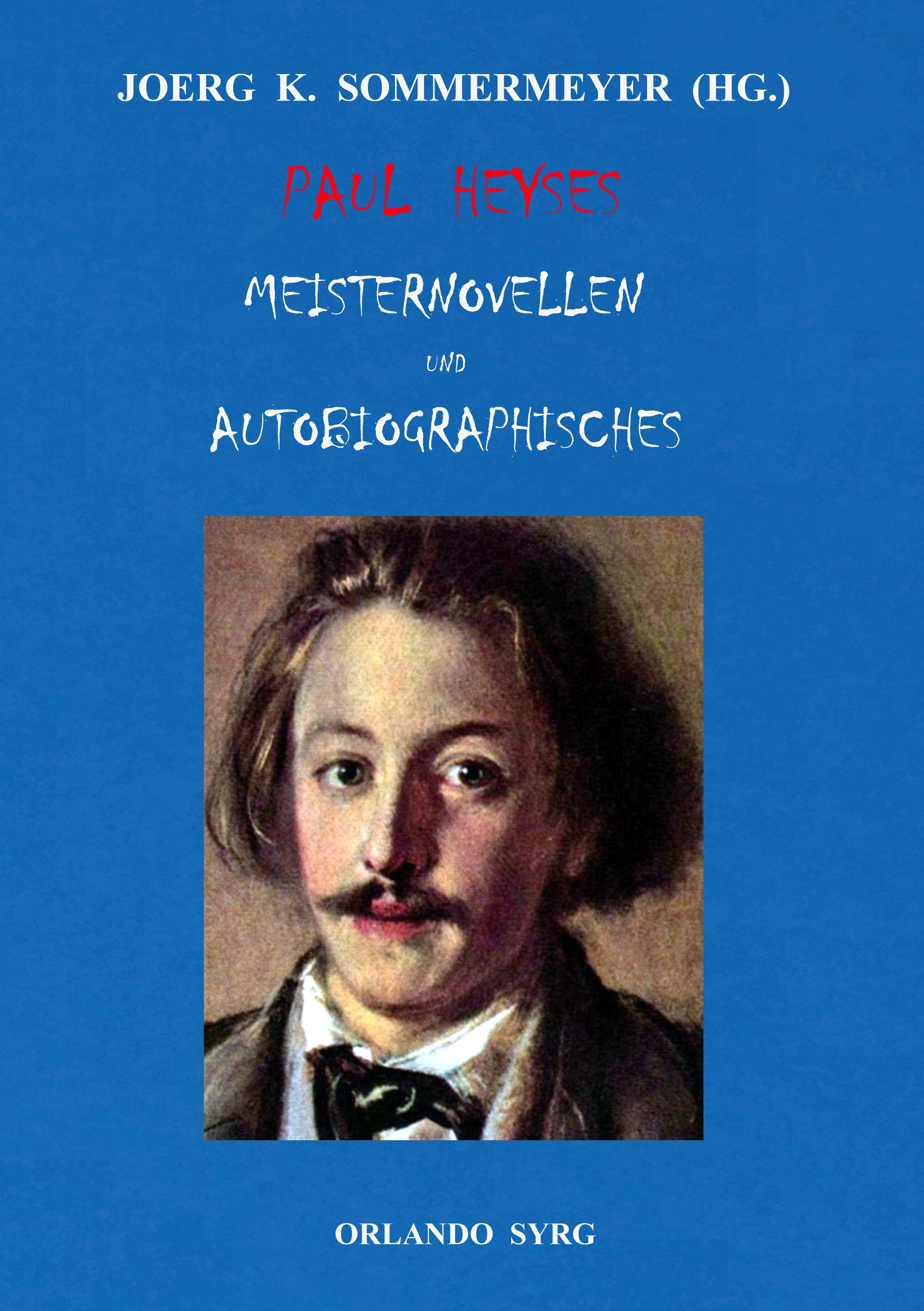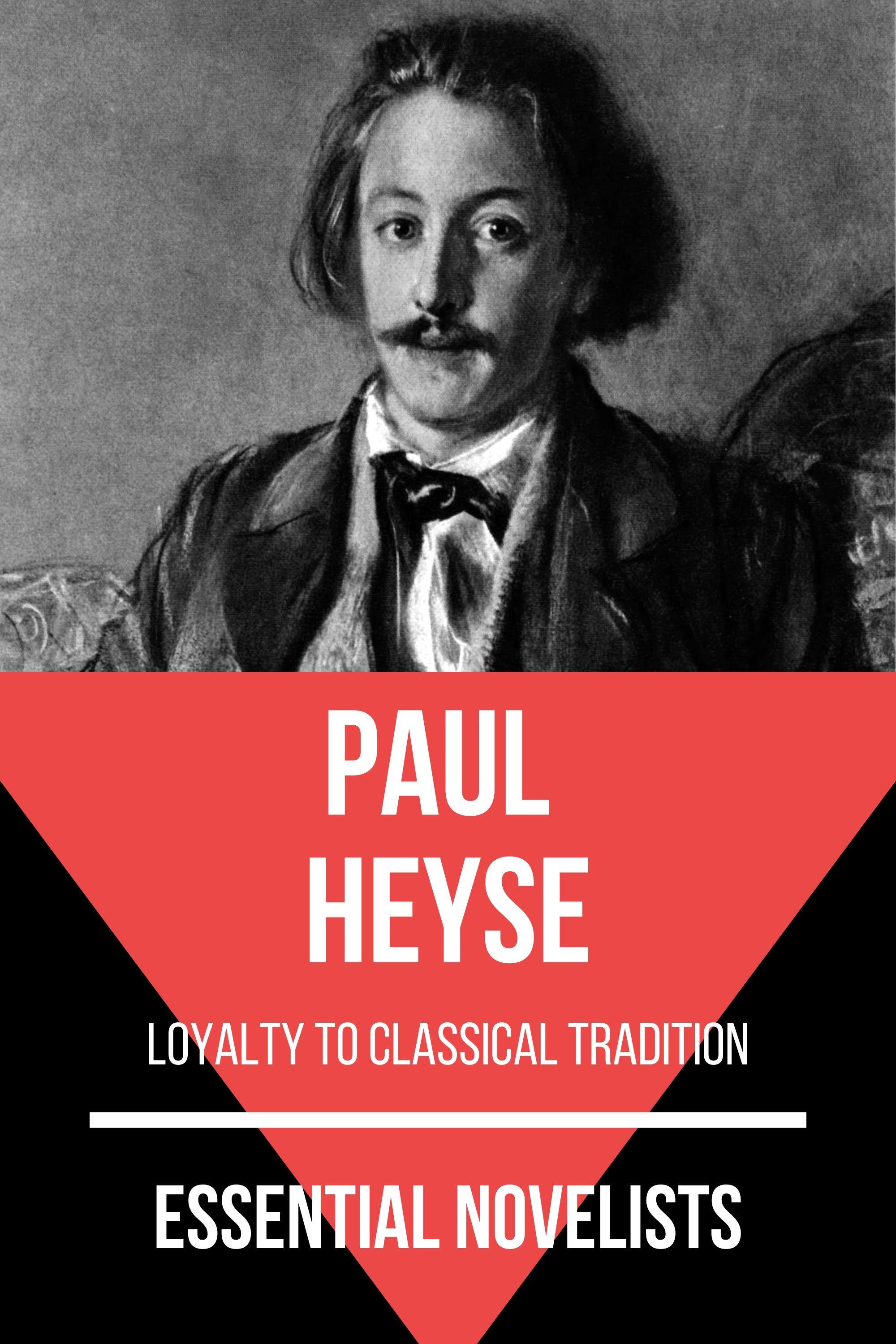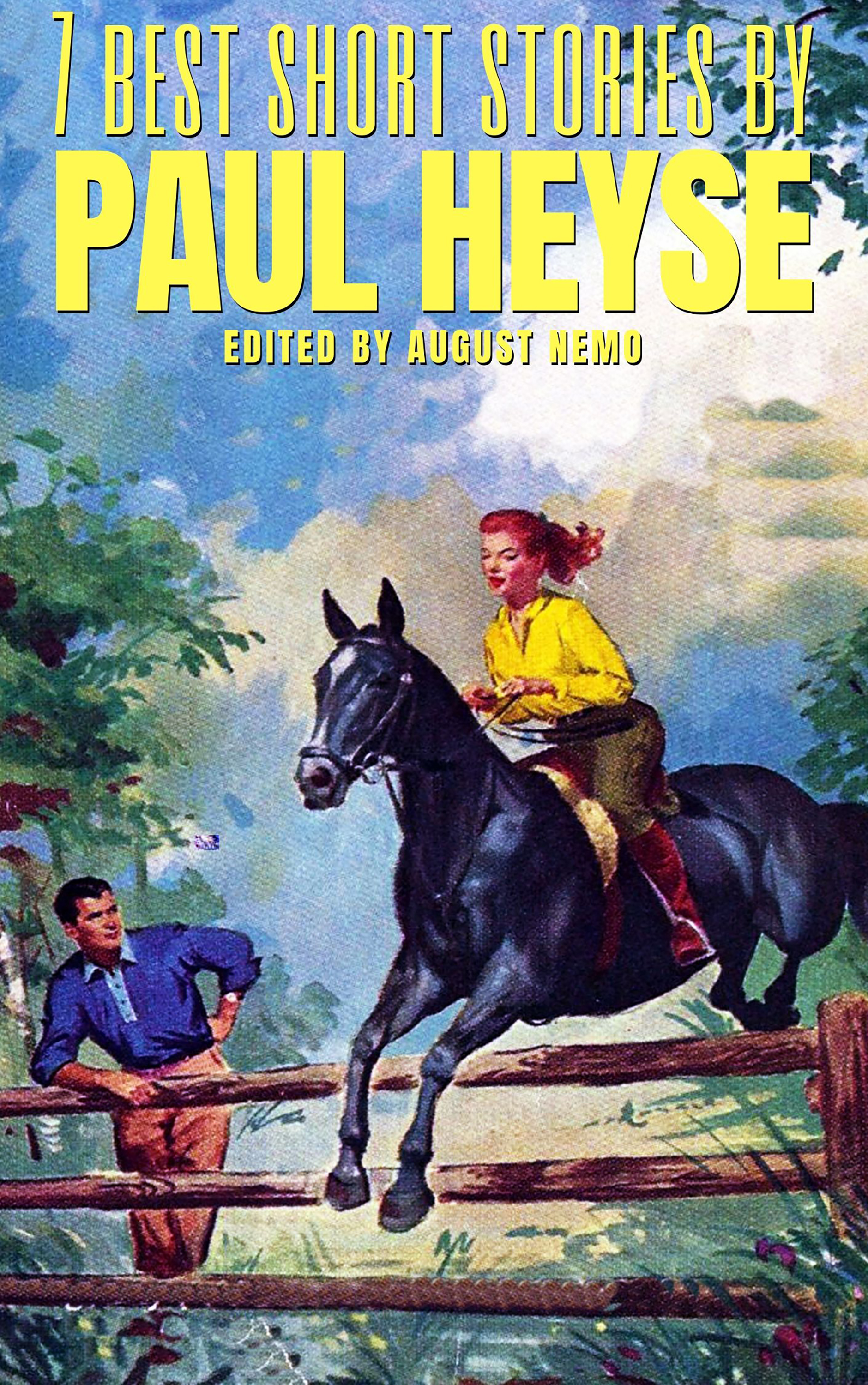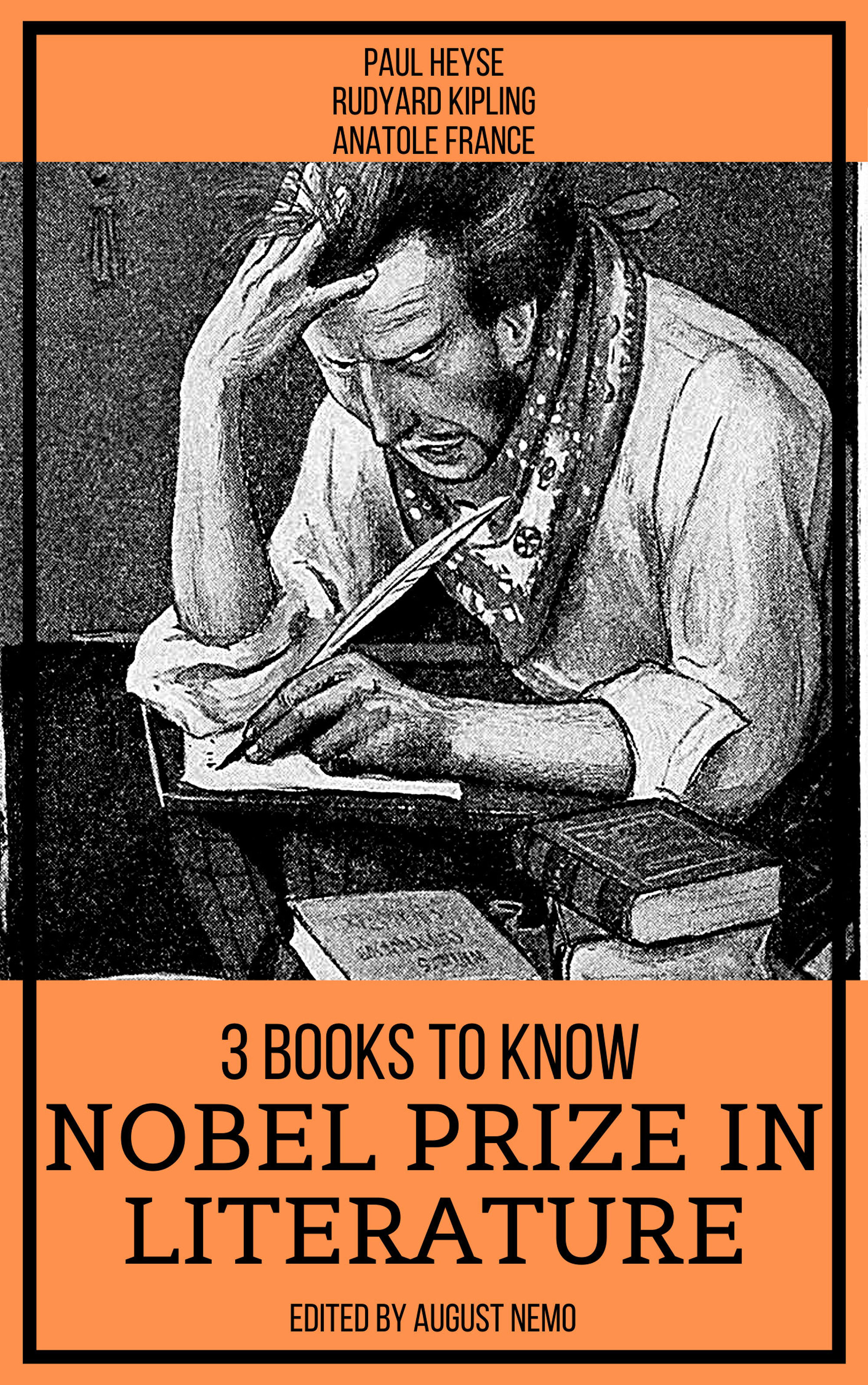Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 54
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Die Einsamen
Novelle
Paul Heyse
Die Einsamen
Novelle
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-43-3
null-papier.de/neu
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Die Einsamen
(1857)
Mehrere Tage lang hatten heftige Südstürme das Meer erschüttert, auf dem hohen Felsenufer Sorrents mit Frühlingsungestüm den Saft in den Feigenbäumen aufgerüttelt und den Boden mit fruchtbaren Regenschauern gepflügt. Manche wollten ein gärendes Murren im Innern des Vesuv vernommen haben und weissagten einen nahen Ausbruch. Auch schienen öfters die Häuser bis in die Grundfesten zu wanken, und nachts hörte man ein drohendes Klirren der Geräte, die im Schrank nahe beieinander standen. Als aber am letzten April die Sonne endlich über den Aufruhr Herr wurde, standen die kleinen Städte auf der Ebene von Sorrent unversehrt zwischen ihren Wein- und Orangengärten, der Felsengrund hatte sich nicht aufgetan, sie zu verschlingen, und dem tosenden Meer war das Ufer dennoch zu hoch gewesen, um hinaufbrandend alles, was Menschen seit Jahrhunderten gepflanzt, in die Tiefe zu reißen.
Am Nachmittage dieses letzten April, der zugleich ein Sonntag war, verließ ein deutscher Poet – sein Name tut nichts zur Sache – das Haus, in dem er sehr wider seine Neigung durch den Sturm war gefangen gehalten worden. Tagelang hatte er vom Fenster aus über das Meer gestarrt, den Mantel um die Knie geschlagen, denn der Steinboden seines Zimmers hauchte eine empfindliche Kälte aus, den Hut auf dem Kopf, ein Glas Wein nach dem anderen hinabschlürfend, ohne ein Wärmegefühl in sich erwecken zu können. Der kleine Büchervorrat, der ihn auf der Reise begleitete, war in Neapel zurückgeblieben, und im Hause seines Wirts war außer dem Kalender und einem Messbuch kein gedrucktes Blatt aufzutreiben. Wie oft hatte er sich vermessen, dass ihn in der Einsamkeit Langeweile nie anwandeln solle. Aber so viel und sehnsüchtig er die Muse zur Gesellschaft heranflehte, der Wind verschlang seinen Ruf, und die Kälte ließ endlich keinen anderen Gedanken in ihm aufkommen als den Wunsch, die Sonne wiederzusehen.
Sie war denn auch durchgebrochen, und er hatte die Hälfte dieses gesegneten Tages redlich damit verbracht, auf dem Altan sitzend sie sich auf die Haut scheinen zu lassen. Und als er vollends nach Tische den Bergweg hinaufstieg, wurden alle erstarrten Gefühle in ihm mit Macht wieder lebendig. So groß, so golden und gewaltig hatte er die siegreiche Frühlingssonne nie gesehen, so erfrischend war ihm der Hauch des Meeres nie ins Mark gedrungen. Diese Blätter da an den Feigenbäumen waren in einer Nacht fingerlang hervorgeschossen. Die Büsche dort hat die Sonne eines halben Tages in weiße Blüten gebracht. Und wo nur der Wanderer, vom Duft gelockt, den Boden näher untersucht, dunkeln ihm unabsehliche Veilchenbeete entgegen. Die Luft wimmelt von Schmetterlingen, die nicht älter sind als dieser Tag; alle Pfade ringsum sind von Menschen zu Fuß oder in sausenden kleinen Wagen belebt. Dazu die Glockenstimmen der Kirchen und Kapellen auf vier Stunden Wegs, das Jauchzen der Burschen, die bergan zogen, um ein Kirchenfest in Sant’ Agata, einem Dorfe auf dem Grat des Berges, mitzufeiern, und die lang gezogenen Ritornelle der Weiber, die Hand in Hand zur Vesper wandelten, oder auf den sonnigen Dächern stehend ins Meer hinausblickten.
Je weiter der Deutsche, einer mäßig ansteigenden Straße folgend, sich dem Feiertagsjubel entzog, desto mehr beklemmte es ihm das Herz, dass er dem Dank für die Fülle der Wunder, die auf ihn eindrang, mit nichts Luft zu machen vermochte. Am liebsten hätte er dort auf dem Felsen stehend in die weite Landschaft hinausgesungen, ein Lied ohne Worte, einen bloßen Widerhall aller Frühlingsstimmen um ihn her. Aber er hatte einigen Grund, seiner Stimme zu misstrauen, dass sie eine würdige Heroldin seines Gefühls sein würde. Wie neidisch dachte er an jenen Tenor zurück, der in Rom ihn manchen Abend entzückt hatte! Mit dieser Stimme hier die Weite auszufüllen! Wie armselig, stumm wie ein Dieb, klanglos wie der Stock in seiner Hand kam er sich vor, als er durch alle singende und klingende Wonne der Natur hindurchschritt.
Was rühmen sie die Poesie als die höchste Kunst? rief er zornig aus. Kann sie eine Brust von der Übermacht eines solchen Eindrucks befreien? Ruft mir die Größten her, die jemals über melodische Worte zu gebieten hatten, ob sie nicht dem Unermesslichen gegenüber verstummen gleich mir armem Nachgeborenen. Womit wollen sie Licht und Äther und Meer und die Düfte, die aus jenem Orangenhain heraufwehen, nur von ferne würdig verherrlichen? Sogar der letzte unter allen, die sich noch einer Muse rühmen, ein Tänzer selbst könnte es ihnen hier zuvortun. Kann er nicht das Streben in den Himmel hinauf, ins All hinein, wenigstens mit Zeichen und Gebärden andeuten, mit seiner ganzen Person und vom Wirbel bis zur Zehe seine Trunkenheit ausströmen? Und nun ein Maler vollends! Der unbedeutendste und einfältigste, wenn er nur gelernt hat, die Linie des Berges dort und das Kloster am äußersten Rande, dahinter den Wald, die Grenze des Meeres, im Vordergrunde den frisch vom Winde geknickten Baum auf ein Blatt zu bringen – wie glücklich muss es ihn machen! Und wenn er gar ein Meister ist und die zitternde Helle über der gelben Bergwand in Farben widerstrahlen kann, dort in der Tiefe die See, die noch immer wühlt und die Wellen wirft wie Fetzen eines silberdurchwirkten Gewandes, den Duft drüben am Vesuv, die weißen Glockentürme zwischen dem jungen Laub der Kastanien – ich könnte ihn geradezu umbringen vor Neid!