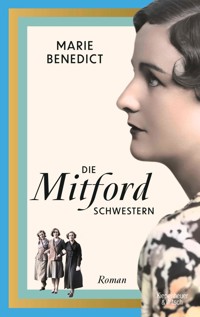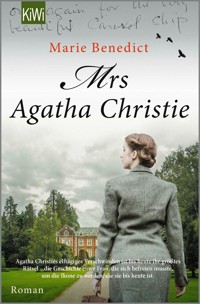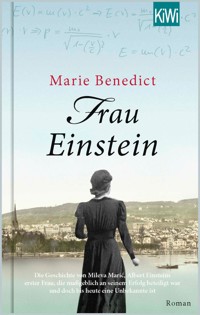9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte
- Sprache: Deutsch
Marie Benedict widmet sich Hedy Lamarr, einer Frau, die das Weltgeschehen maßgeblich beeinflusst hat und deren Errungenschaften vergessen wurden. Das Buch erzählt die Geschichte der Schauspielerin, Glamour-Ikone und Wissenschaftlerin. Die Schönheit von Hedy Lamarr, die mit bürgerlichem Namen Hedwig Maria Kiesler hieß und jüdischer Abstammung war, führte sie zu einer kometenhaften Schauspielkarriere in Wien und zur Heirat mit einem österreichischen Waffenhändler. Durch ihn hatte sie Zugriff auf die Pläne des Dritten Reichs, ein Wissen, das sie später nutzte, um an der Seite der Alliierten zu kämpfen. Im Jahr 1937 verließ sie ihren gewalttätigen Ehemann und floh über Paris und London nach Hollywood. Dort wurde sie zu Hedy Lamarr, dem weltberühmten Filmstar. Was keiner wusste: Sie war Erfinderin. Und sie hatte eine Idee, die dem Land helfen könnte, die Nazis zu bekämpfen und die moderne Kommunikation zu revolutionieren … wenn ihr nur jemand zugehört hätte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Marie Benedict
Die einzige Frau im Raum
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Marie Benedict
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Marie Benedict
Marie Benedict, geboren 1973, studierte am Boston College Geschichte und Kunstgeschichte und an der Boston University School of Law. Ihre Bücher über starke Frauen der Weltgeschichte haben Bestsellerstatus. Ihr Roman »Frau Einstein« verkaufte sich über 100.000 Mal allein in Deutschland. Sie ist Anwältin und lebt mit ihrer Familie in Pittsburgh.
Marieke Heimburger, geboren 1972, hat in Düsseldorf Literaturübersetzen für Englisch und Spanisch studiert. Seit 1998 übersetzt sie englischsprachige Literatur, u. a. Stephenie Meyer, Rowan Coleman, Kiera Cass, Sally McGrane, seit 2010 auch aus dem Dänischen, u. a. Jussi Adler-Olsen, Anna Grue, Mads Peder Nordbo.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Marie Benedict widmet sich Hedy Lamarr, einer Frau, die das Weltgeschehen maßgeblich beeinflusst hat und deren Errungenschaften vergessen wurden. Das Buch erzählt die Geschichte der Schauspielerin, Glamour-Ikone und Wissenschaftlerin.
Die Schönheit von Hedy Lamarr, die mit bürgerlichem Namen Hedwig Maria Kiesler hieß und jüdischer Abstammung war, führte sie zu einer kometenhaften Schauspielkarriere in Wien und zur Heirat mit einem österreichischen Waffenhändler. Durch ihn hatte sie Zugriff auf die Pläne des Dritten Reichs, ein Wissen, das sie später nutzte, um an der Seite der Alliierten zu kämpfen. Im Jahr 1937 verließ sie ihren gewalttätigen Ehemann und floh über Paris und London nach Hollywood. Dort wurde sie zu Hedy Lamarr, dem weltberühmten Filmstar. Was keiner wusste: Sie war Erfinderin. Und sie hatte eine Idee, die dem Land helfen könnte, die Nazis zu bekämpfen und die moderne Kommunikation zu revolutionieren … wenn ihr nur jemand zugehört hätte.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: The Only Woman in the Room
© 2019 by Marie Benedict, Published by Arrangement with Heather Benedict Terrell
All rights reserved
Aus dem amerikanischen Englisch von Marieke Heimburger
© 2023, 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Robert Coburn / Kontributor / Getty Images
ISBN978-3-462-30256-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
2. Teil
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Anmerkung der Autorin
Für Jim, Jack und Ben
1. Teil
Kapitel 1
17. Mai 1933
Wien
Die Scheinwerfer blendeten mich so sehr, dass ich kaum die Augen öffnen konnte. Nach Sicherheit suchend, tastete ich nach dem Arm meines Bühnenpartners, während ich mir gleichzeitig ein selbstbewusstes Lächeln abrang, bis ich wieder sehen konnte. Beifall brandete auf. Von dieser Kakofonie aus Lärm und Licht wurde mir ganz schwindelig. Die Maske, die ich anlässlich meines Auftritts aufgesetzt hatte, rutschte einen Moment beiseite, und ich war nicht mehr Elisabeth, die 15-jährige bayerische Prinzessin, sondern schlicht die 18-jährige Hedy Kiesler aus Wien.
Ich durfte nicht zulassen, dass die Gäste des berühmten Theaters an der Wien sahen, wie meine Darstellung der späteren Kaiserin von Österreich, der von mir glühend verehrten Sisi, Risse bekam. Auch nicht, nachdem der Vorhang gefallen war. Elisabeth war der Inbegriff des einst glanzvollen Habsburgerreiches, das über sechshundertvierzig Jahre Bestand gehabt hatte, und in diesen demütigenden Tagen nach dem Großen Krieg klammerten sich die Menschen an diese Lichtgestalt.
Ich schloss kurz die Augen, richtete den Blick tief nach innen und schob Hedy Kiesler mit all ihren kleinen Sorgen und vergleichsweise belanglosen Zielen beiseite. Ich riss mich noch einmal zusammen und schlüpfte wieder in die Rolle der angehenden Kaiserin, machte mir ihre stählerne Härte zu eigen und ihre immense Verantwortung bewusst. Dann schlug ich die Augen wieder auf und sah hinaus, auf meine Untertanen.
Das Publikum vor mir nahm konkrete Gestalt an. Es saß nicht auf seinen samtroten Plüschsitzen und klatschte. Die Leute waren aufgesprungen und spendeten stehend Beifall – eine Ehre, die einem Schauspieler in Wien nur selten zuteilwurde. Als zukünftiger Kaiserin gebührte mir das, doch als Hedy fragte ich mich, ob dieser Applaus wirklich für mich war oder nicht doch für jemand anderen aus dem Sissy-Ensemble. Hans Jaray, der den Kaiser Franz Joseph an meiner Seite als Prinzessin Elisabeth verkörperte, war immerhin eine Legende am Theater an der Wien. Ich wartete, bis die anderen Schauspieler sich verbeugten. Sie erhielten anhaltenden Applaus, doch als ich mich dann in die Bühnenmitte bewegte und verneigte, tobte das Theaterpublikum. Das war mein Moment.
Ach, wie ich mir wünschte, Papa hätte meinen Auftritt heute Abend sehen können. Wenn Mama kein Unwohlsein vorgetäuscht hätte, um meinem wichtigen Abend Aufmerksamkeit zu entziehen, hätte Papa mein Debüt am Theater an der Wien sehen können. Er hätte die Begeisterung des Publikums genossen, und vielleicht hätte diese Euphorie ein wenig dazu beigetragen, den Makel zu mildern, der seit meinem etwas gewagten Leinwandauftritt in Ekstase an mir haftete – eine Filmrolle, die ich selbst nur zu gerne vergessen würde.
Der Applaus ließ nach, und das Publikum wurde unruhig, als ein paar üppig mit Blumen beladene Platzanweiser durch den Mittelgang spazierten. Die Wiener waren eher reservierte Menschen, und diese in aller Öffentlichkeit zur Schau gestellte überbordende Geste verstörte sie. Ich konnte förmlich hören, wie sie sich fragten, wer es wagte, die Premiere am Theater an der Wien für so eine Dreistigkeit zu missbrauchen. Nur der begeisterte Überschwang einer Mutter oder eines Vaters hätte das entschuldigen können, aber meine zurückhaltenden Eltern schieden als Urheber einer solchen Aktion aus. Hatten Angehörige meiner Kollegen sich zu diesem Fauxpas hinreißen lassen?
Die Platzanweiser näherten sich der Bühne, und ich sah, dass sie keine gewöhnlichen Blumen in den Armen trugen, sondern edelste Gewächshausrosen. Vielleicht ein Dutzend Sträuße. Was mochten so viele zarte rote Blumen wohl kosten? Ich fragte mich, wer sich in diesen Zeiten eine derartige Dekadenz leisten konnte.
Die Blumenträger erklommen die Treppe, offenbar hatten sie Anweisung erhalten, die Pracht vor versammeltem Publikum zu überreichen. Ich wusste nicht, wie ich mit diesem Verstoß gegen die Regeln des guten Tons umgehen sollte, und sah zu den anderen Schauspielern, die genauso ratlos dreinschauten. Der Inspizient fuchtelte herum im Versuch, diesen unpassenden Auftritt zu unterbinden, doch jemand musste den Platzanweisern viel Geld gegeben haben, denn sie ignorierten den gestikulierenden Mann und stellten sich in einer Reihe auf. Und zwar vor mir.
Einer nach dem anderen überreichte mir einen Strauß, bis meine Arme voll waren, dann legten sie die Blumen mir zu Füßen ab. Ich spürte die missbilligenden Blicke meiner Kollegen im Rücken. Meine Bühnenkarriere stand und fiel mit dem Wohlwollen dieser ehrenwerten Darsteller; sie konnten mich jederzeit mit wenigen gezielt geäußerten Worten von diesem Sockel holen und mich durch eine der vielen anderen jungen Schauspielerinnen ersetzen, die sich nach dieser Rolle verzehrten. Ich hatte das Gefühl, die Blumen ablehnen zu müssen – doch dann kam mir ein Gedanke.
Ich hatte keine Ahnung, wer mir diese Blumen geschickt hatte. Vielleicht war es ja ein prominentes Mitglied einer der sich bekriegenden Regierungsparteien gewesen – ein konservativer Christlichsozialer oder ein sozialistischer Sozialdemokrat. Oder noch schlimmer: Mein Gönner könnte mit der nationalsozialistischen Partei sympathisieren und sich die Vereinigung Österreichs mit Deutschland und seinem frisch gewählten Kanzler Adolf Hitler wünschen. Das Machtpendel schlug täglich in eine andere Richtung aus, niemand konnte es sich leisten, etwas zu riskieren. Am allerwenigsten ich.
Der Applaus versiegte. In der entstandenen unangenehmen Stille nahmen alle Theatergäste wieder Platz. Alle bis auf einen. In der Mitte der dritten Reihe, am teuersten Platz im ganzen Saal, blieb ein stattlicher Herr mit kantigem Gesicht stehen und sah mich unverwandt an.
Kapitel 2
17. Mai 1933
Wien
Der Vorhang fiel. Meine Schauspielkollegen warfen mir fragende Blicke zu. Ich antwortete mit einem Achselzucken sowie einem Kopfschütteln und hoffte, so meine eigene Ratlosigkeit und meine Missbilligung der Angelegenheit deutlich zu machen. So schnell wie es mir inmitten der vielen Gratulationen schicklich erschien, flüchtete ich in meine Garderobe und schloss die Tür. Wut und Sorge erfüllten mich: Würden diese Blumen von meinem Triumph ablenken, von dieser Rolle, mit der ich Ekstase endlich hinter mir lassen konnte? Ich musste herausfinden, wer mir das angetan hatte – und ob es sich um ein irgendwie fehlgeleitetes Kompliment oder einen gezielten Affront handelte.
Ich zog den im größten Gebinde versteckten Umschlag hervor und schlitzte ihn mit meiner Nagelschere auf. Ich zog eine dicke, goldumrandete, cremefarbene Karte hervor, hielt sie ins Licht der Lampe an meinem Schminktisch und las:
Für eine unvergessliche Sissy. Ihr Friedrich Mandl
Friedrich Mandl? Wer war das? Der Name kam mir bekannt vor, ich konnte ihn aber nicht zuordnen.
Meine Garderobentür erbebte unter einem herrischen Klopfen. »Fräulein Kiesler?« Es war Else Lubbig, die Garderobiere des Theaters an der Wien, die seit zwanzig Jahren sämtliche Schauspieler aller Produktionen einkleidete. Selbst während des Großen Krieges und der bedrückenden Jahre nach der Niederlage Österreichs assistierte die grauhaarige Matrone allen Schauspielern, die mit ihren Aufführungen dazu beitrugen, die Bevölkerung Wiens bei Laune zu halten – wie zum Beispiel mit der Figur der Kaiserin Elisabeth, die die Menschen an Österreichs glorreiche Vergangenheit erinnerte und sie von einer strahlenden Zukunft träumen ließ. Das Stück sparte natürlich die späten Jahre der Kaiserin aus, als die goldene Leine des missmutigen Kaisers sich mehr und mehr in ein Joch verwandelte, unter dem ihr kaum noch Bewegungsfreiheit blieb. Doch daran wollten die Menschen in Wien nicht denken, sie waren Weltmeister im Verdrängen.
»Herein«, rief ich.
Ohne das Rosenmeer auch nur eines Blickes zu würdigen, machte Frau Lubbig sich daran, mein sonnengelbes Kleid aufzuschnüren. Während ich mir Creme ins Gesicht schmierte, um das dicke Bühnen-Make-up und damit die letzten Reste meiner Maske zu entfernen, löste sie mein Haar aus der vom Regisseur für die Herzogin für passend befundenen komplizierten Hochfrisur und bürstete es aus. Frau Lubbig schwieg, aber ich konnte spüren, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie aussprechen würde, worüber gewiss das ganze Theater grübelte.
»Wunderschöne Blumen, Fräulein Kiesler«, sagte Frau Lubbig schließlich, nachdem sie mir Komplimente zu meinem Auftritt gemacht hatte.
»Ja«, antwortete ich und wartete gespannt.
»Darf ich fragen, wer der Absender ist?« Sie war mit meinen Haaren fertig und wandte sich meinem Korsett zu.
Ich hielt inne und überlegte, was ich antworten sollte. Ich konnte lügen und behaupten, der florale Fauxpas sei von meinen Eltern gekommen, aber das wäre Tratsch, den sie gegen anderen Tratsch eintauschen konnte. Wenn ich ihr hingegen ehrlich antwortete, hätte ich etwas bei ihr gut. Und es konnte nie schaden, bei Frau Lubbig etwas gutzuhaben.
Lächelnd sah ich zu ihr auf und reichte ihr die Karte. »Ein gewisser Friedrich Mandl.«
Sie sagte nichts, aber ich hörte, wie sie scharf Luft einsog, und das sprach Bände.
»Haben Sie von ihm gehört?«, fragte ich.
»Ja, das habe ich.«
»War er heute Abend in der Vorstellung?« Ich wusste, dass Frau Lubbig von den Kulissen aus jeder Vorstellung folgte und die von ihr betreute Schauspielerin im Blick behielt, damit sie sofort Hand anlegen konnte, falls ein Saum sich löste oder eine Perücke schief saß.
»Ja.«
»War das der Mann, der nach dem Schlussapplaus stehen blieb?«
Sie seufzte. »Ganz genau.«
»Was wissen Sie über ihn?«
»Das möchte ich nicht sagen, Fräulein Kiesler. Das steht mir nicht zu.«
Ich verkniff mir ein Lächeln angesichts Frau Lubbigs vorgeschützter Bescheidenheit. Sie verfügte über einen wahren Schatz an Geheimnissen und damit in vielerlei Hinsicht über mehr Macht als jeder andere im Theater.
»Sie würden mir einen großen Gefallen tun.«
Sie hielt inne und strich sich über das hochgebürstete Haar, als würde sie über meine Bitte nachdenken. »Ich habe nur Klatsch und Gerüchte gehört. Nicht alles davon schmeichelhaft.«
»Bitte, Frau Lubbig.«
Ich betrachtete sie im Spiegel und sah, wie ihr von feinen Fältchen durchzogenes Gesicht arbeitete, als gehe sie das sorgfältig im Gedächtnis abgelegte Dossier durch, um dann zu entscheiden, welches Häppchen Information wohl angebracht wäre.
»Nun, Herrn Mandl eilt ein gewisser Ruf in puncto Frauen voraus.«
»So wie allen anderen Männern in Wien auch«, gluckste ich. Wenn das alles war, brauchte ich mir keine Sorgen zu machen. Mit Männern konnte ich umgehen. Mit den meisten jedenfalls.
»Es geht da um etwas mehr als die üblichen Schikanen, Fräulein Kiesler. Eine seiner Romanzen führte zum Selbstmord einer jungen österreichischen Schauspielerin, Eva May.«
»Herrje«, flüsterte ich, aber ich durfte nicht zu harsch urteilen, denn auch ich hatte bereits so einige Herzen gebrochen und durch meine Abweisung zum Selbstmordversuch eines Verehrers beigetragen. Diese Information über Herrn Mandl war natürlich schrecklich, aber das konnte noch nicht alles gewesen sein. Ich hörte Frau Lubbig an, dass sie etwas zurückhielt, dass sie noch mehr zu erzählen hatte. Aber sie ließ sich bitten. »Wenn Sie mir noch mehr erzählen, stehe ich in Ihrer Schuld.«
Sie zögerte. »Es handelt sich um eine Information, die man dieser Tage nur mit großer Vorsicht an andere weitergibt.« In diesen unsicheren Zeiten war Wissen eine harte Währung.
Ich nahm ihre Hand und sah ihr fest in die Augen. »Diese Information ist einzig und allein für mich bestimmt, zu meiner Sicherheit. Ich verspreche Ihnen, dass ich sie an niemand anderen weitergeben werde.«
Nach einer langen Pause sagte sie: »Herrn Mandl gehört die Hirtenberger Patronenfabrik. Die Firma stellt Munition und militärische Waffen her, Fräulein Kiesler.«
»In der Tat eine verwerfliche Industrie. Aber irgendjemand muss es ja tun«, sagte ich. Mir war nicht klar, was die Branche mit dem Menschen zu tun hatte.
»Es geht dabei nicht so sehr um die Ausrüstung, die er produziert, Fräulein Kiesler, sondern um die Menschen, an die er sie verkauft.«
»Aha?«
»Ja, Fräulein Kiesler. Man nennt ihn auch den Kaufmann des Todes.«
Kapitel 3
26. Mai 1933
Wien
Neun Tage nach meinem Bühnendebüt in Sissy, an einem in zartes Mondlicht getauchten Abend voller dunkelvioletter Schatten, beschloss ich, den Rest des Nachhausewegs vom Theater im 6. Bezirk zu Fuß zu gehen, und sprang trotz der späten Stunde aus der Droschke. Ich sehnte mich nach einer Pause, einem ruhigen Intermezzo zwischen der auf jede Aufführung folgenden Aufregung im Theater und dem mich allabendlich erwartenden elterlichen Überschwang zu Hause.
Es waren nur wenige Passanten unterwegs, ein gemütlich schlenderndes älteres Paar, vielleicht auf dem Heimweg nach einem Restaurantbesuch, sowie ein pfeifender junger Mann. Ich fühlte mich sicher. Die Viertel, die ich auf dem Weg nach Döbling durchquerte, wurden immer wohlhabender. Aber derartige Argumente hätten die Sorge meiner Eltern nicht zu dämpfen vermocht, wenn sie gewusst hätten, dass ich alleine zu Fuß ging. Ich war ihr einziges Kind, und sie behüteten mich sehr.
Ich schob die Gedanken an Mama und Papa beiseite und lächelte in Erinnerung an die diese Woche in der Presse erschienene Kritik. Glühende Worte über meine Darstellung der jungen Sisi hatten den Kartenverkauf so sehr angeheizt, dass für die letzten drei Abende sogar noch Stehplätze verkauft wurden. Mein Ansehen am Theater war gestiegen, und selbst unser sonst so kritischer Regisseur hatte Komplimente verlauten lassen. Diese Anerkennung tat mir nach dem Skandal rund um mein Mitwirken in Ekstase besonders gut. Ich hatte mich auf die Nacktszenen eingelassen, weil sie mir im künstlerischen Kontext des Films nicht weiter dramatisch vorgekommen waren – und darum nicht mit der entsetzten Reaktion der Öffentlichkeit einschließlich meiner Eltern gerechnet. Nun wusste ich, dass meine Entscheidung, nach dem Ausflug zum Film zum Theater zurückzukehren, richtig gewesen war. Ich hatte das Gefühl, nach Hause zu kommen.
Ich war ein einsames Kind gewesen und hatte schon früh versucht, die ständige Abwesenheit meiner Eltern, die das allgegenwärtige Kindermädchen und der Hauslehrer nicht auszugleichen vermochten, und die generelle Leere in meinem Leben mithilfe der Schauspielerei auszugleichen. Zunächst dachte ich mir eher schlichte Figuren und Geschichten aus, die ich mit meinen Puppen auf der improvisierten Bühne unter dem riesigen Schreibtisch in Papas Arbeitszimmer spielte, doch dann übernahm ich immer häufiger selbst die Rollen. Als ich eingeschult wurde und auf einmal mit einer großen, bunten Bandbreite von Menschen in Berührung kam, nutzte ich die Schauspielerei, um durch die Welt zu navigieren, sie war wie ein Trumpf, den ich jederzeit ziehen konnte, wenn ich ihn brauchte. Ich konnte genau das werden, was die Menschen um mich herum sich insgeheim am sehnlichsten wünschten, und im Gegenzug bekam ich alles, was ich von ihnen wollte. Doch erst als ich zum ersten Mal auf einer richtigen Bühne stand, begriff ich die Tragweite meines Talents. Ich konnte mich restlos verstecken hinter einer völlig anderen Maske, einer Rolle, die ein Regisseur oder Autor geschaffen hatte. Ich konnte den Blick auf das Publikum richten und mit meinem Talent die Menschen beeinflussen.
Der einzige Schatten, der sich auf alles Lichte von Sissy legte, war die allabendliche Lieferung von Rosen. Immer dieselbe Anzahl, jedes Mal eine andere Farbe. Mal Fuchsiarot, mal Blassrosa, Elfenbein, Blutrot, sogar Zartviolett war dabei gewesen, und jedes Mal zwölf Dutzend davon. Es war obszön. Wenigstens die Art und Weise der Anlieferung hatte sich geändert. Die Blumen wurden mir nicht mehr in einer überbordenden Geste vor aller Augen auf der Bühne überreicht, sondern während des letzten Aktes diskret in meine Garderobe gebracht.
Der rätselhafte Herr Mandl. Ein paar Mal dachte ich, ich hätte ihn zwischen anderen Gästen in der begehrten dritten Reihe gesehen, aber ich war mir nicht sicher. Seit dem kurzen Brief, der den ersten Rosen beilag, hatte er keinen weiteren Versuch unternommen, mit mir in Kontakt zu treten – bis heute. Als ich vorhin in die Garderobe zurückkehrte, steckte eine goldumrandete Karte zwischen den sonnengelben Blüten, die farblich perfekt zu meinem Kleid passten. Sie enthielt die handgeschriebenen Zeilen:
Liebes Fräulein Kiesler,
es wäre mir eine Ehre, Sie nach der Aufführung ins Hotel Imperial zum Abendessen einladen zu dürfen. Wenn es Ihnen recht ist, geben Sie bitte meinem Fahrer Bescheid, er wird bis Mitternacht am Bühneneingang warten.
Ihr Friedrich Mandl
Meine Eltern würden schier verzweifeln, wenn ich auch nur in Erwägung zöge, mich allein mit einem fremden Mann zu treffen – und dann auch noch in einem Hotelrestaurant! Auch wenn es sich dabei um ein Luxushotel handelte. Doch nach allem, was ich bisher über Herrn Mandl in Erfahrung gebracht hatte, war ich ohnehin nicht erpicht darauf, mich auf diese Einladung einzulassen. Behutsame Erkundigungen hatten immer mehr Informationen über meinen rätselhaften Gönner zutage gefördert. Die wenigen Freunde, die ich in der isolierten Theaterwelt hatte, sagten, ihn treibe ausschließlich die Profitgier an, und die Moral derer, an die er seine Waffen verkaufte, interessiere ihn nicht. Doch die wichtigste Information kam völlig ungefragt von der Hüterin so vieler Geheimnisse, von Frau Lubbig, die mir zuflüsterte, Herr Mandl sei der Liebling einiger rechtsgerichteter Autokraten, die überall in Europa wie Pilze aus dem Boden schossen. Dieser Aspekt beunruhigte mich am meisten von allen, denn Österreich kämpfte um seine Unabhängigkeit, während es zunehmend von landhungrigen Diktaturen umgeben war.
Dass ich nicht mit ihm im Hotel Imperial essen gehen wollte, war eine Sache – jedoch konnte ich ihn nicht weiter völlig ignorieren. Immerhin verfügte Herr Mandl über viele politische Kontakte, und in der aktuellen Situation musste man stets auf der Hut sein. Ich war ratlos, wie ich am besten auf die Aufmerksamkeit dieses deutlich älteren Mannes reagieren sollte, denn meine bisherigen Tändeleien hatte ich stets zu jungen, formbaren Männern meines Alters gepflegt. Ich bat Frau Lubbig, Herrn Mandls Fahrer abzulenken, während ich mich am Bühneneingang vorbeischlich und das Theater zum Vorderausgang verließ.
Mit klappernden Absätzen ging ich die Peter-Jordan-Straße hinunter. Die Häuser hier wurden aus unerfindlichen Gründen »Cottages« genannt, denn es handelte sich dabei keineswegs um kleine, strohgedeckte Häuser mit niedrigen Decken, sondern vielmehr um großzügige, englischen Landhäusern nachempfundene Villen mit großen Gärten.
Wenige Meter von meinem Elternhaus entfernt wurde es auf einmal dunkler. Ich sah auf in der Annahme, Wolken hätten sich vor den Mond geschoben, doch die Sichel leuchtete unverändert. Ich überlegte, ob die Dunkelheit etwas mit dem nahe gelegenen Wienerwald zu tun haben könnte, wo Papa und ich so gerne Sonntagsspaziergänge unternahmen.
Kein einziges elektrisches Licht war zu sehen, außer im Haus meiner Eltern. Stockdunkle Fenster, hier und da ein schwacher Kerzenschein, glotzten mich allenthalben an, und da endlich fiel mir der Grund für die Finsternis ein. Viele der hiesigen Anwohner pflegten die Tradition, vom Sonnenuntergang am Freitag bis zum Sonnenuntergang am Samstag auf elektrisches Licht zu verzichten, obwohl sie ihre Religion sonst gar nicht so streng orthodox ausübten. Ich hatte es vergessen, weil es ein Brauch war, den meine Eltern nicht pflegten.
Es war Sabbat in Döbling, einem jüdischen Viertel in einem katholischen Land.
Kapitel 4
26. Mai 1933
Wien
Ich war kaum über die Schwelle getreten, da umfing mich bereits der Duft. Ich musste die Rosen nicht sehen, um zu wissen, dass das ganze Haus voll davon war. Warum um alles in der Welt hatte Herr Mandl sie jetzt auch hierher geschickt?
Aus dem Salon waren die unbeschwerten Klänge einer Klaviersonate von Bach zu hören. Als die Tür hinter mir ins Schloss klickte, verstummte die Musik und meine Mutter rief: »Hedy? Bist du das?«
Ich reichte Inge, unserem Hausmädchen, meinen Mantel und antwortete: »Wer sonst sollte es sein um diese Zeit, Mama?«
Papa kam aus dem Salon und begrüßte mich. Eine kunstvoll geschnitzte Holzpfeife im Mundwinkel, fragte er: »Na, wie geht es unserer Sisi? Hast du wieder alle anderen überstrahlt, wie Die Presse behauptet?«
Lächelnd sah ich zu meinem hochgewachsenen Vater auf, der mit seinen ergrauenden Schläfen und den Fältchen um die blauen Augen einfach umwerfend aussah. Selbst zu dieser späten Stunde – immerhin nach elf – war er immer noch tadellos gekleidet. Zu dem gebügelten dunkelgrauen Anzug trug er eine gestreifte weinrote Krawatte. Ganz der zuverlässige, erfolgreiche Direktor einer der bekanntesten Banken Wiens, des Creditanstalt-Bankvereins.
Er nahm mich bei der Hand, und ich musste kurz an die Wochenenden meiner Kindheit denken, wenn er am Nachmittag immer geduldig all meine Fragen über die Welt und wie sie funktioniert beantwortete. Nichts, was ich fragte, war ihm zu fern, ganz gleich, ob es sich um Geschichte oder Naturwissenschaften, um Literatur oder Politik drehte, und ich konnte nie genug kriegen von diesen Stunden mit ihm, in denen er mir seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte. Eines sonnigen Nachmittags, nachdem ich ihn kindlich-naiv gefragt hatte, was Pflanzen essen, hatte er eine geschlagene Stunde damit verbracht, mir den Vorgang der Fotosynthese zu erklären. Die Geduld, mit der er mir meine nicht nachlassenden Fragen zu Natur und Technik beantwortete, war bewundernswert. Aber solche Stunden waren rar, weil meine Mutter, die Arbeit und gesellschaftliche Verpflichtungen ihn ständig beanspruchten. Ohne ihn quälte ich mich durch viele Stunden des Auswendiglernens mit verschiedenen Lehrern oder Hausaufgaben und Routinen mit meinem Kindermädchen oder – aber das war eher selten – mit Mama, die mir eigentlich nur Beachtung schenkte, wenn ich an einem Klavier saß und sie sich über meinen mangelnden Fortschritt beklagte. Ich liebte Musik, aber inzwischen spielte ich nur noch auf dem Bechstein, wenn Mama nicht zu Hause war.
Papa ging mir voraus in den Salon und ließ mich auf einem der vier Brokatstühle vor dem Kamin Platz nehmen, in dem an diesem kühlen Frühlingsabend ein Feuer brannte. Während wir auf Mama warteten, fragte Papa: »Bist du hungrig, Prinzesschen? Wir könnten Inge bitten, dir einen Teller zuzubereiten. Du siehst immer noch zu schmal aus nach deiner Lungenentzündung.«
»Nein, danke, Papa. Ich habe vor der Vorstellung etwas gegessen.«
Ich sah mich um. An den mit gestreifter Tapete verkleideten Wänden hingen zahlreiche Familienporträts, und die zwölf Sträuße zartrosa Rosen waren kunstvoll im Raum verteilt – vermutlich das Werk meiner Mutter. Papa hob vorerst nur eine Augenbraue – wir wussten beide, dass Mama die entscheidende Frage stellen wollte.
Als meine Mutter hereinkam, schenkte sie sich erst einmal ein Glas Sherry ein. Wort- und blicklos kommunizierte sie mir, dass sie enttäuscht von mir war.
Es wurde still. Wir warteten darauf, dass Mama das Wort ergriff. Sie trank einen ausgiebigen Schluck und sagte schließlich:
»Sieht aus, als hättest du einen Verehrer, Hedy.«
»Ja, Mama.«
»Was hast du getan, um ihn zu derartigem Balzverhalten zu animieren?« Sie schlug den üblichen vorwurfsvollen Ton an. Die Schule für höhere Töchter, auf die sie mich unbedingt schicken wollte, hatte aus mir nicht wie erhofft eine angehende heiratsfähige junge Hausfrau gemacht. Und als ich dann auch noch einen Beruf anstrebte, der in ihren Augen »unschicklich« war, obwohl das Theater in Wien ein hohes Ansehen genoss, beschloss sie, mein gesamtes Verhalten mit diesem Prädikat zu versehen. Und ich gebe zu, manchmal tat ich ihr den Gefallen und gestattete dem einen oder anderen Verehrer, sich mir zu nähern. Ob es nun der adlige Ritter Franz von Hochstetten war oder das vielversprechende neue Schauspieltalent und mein Filmpartner in Ekstase, Aribert Mog – gewissen Herren erlaubte ich in einem Akt purer Rebellion, mich überall da zu berühren, wo Mama fürchtete, dass sie mich berührten. Warum nicht?, fragte ich mich. Sie hielt mich ja ohnehin für liederlich. Und ich labte mich an der Erkenntnis, dass ich über diese Männer genauso eine Macht hatte wie über das Publikum – ich schlug sie alle in meinen Bann.
»Nichts, Mama. Ich bin diesem Mann noch nie begegnet.«
»Warum sollte ein Mann dir all diese Rosen schenken, wenn du ihm nicht bereits einen gewissen Gefallen erwiesen hättest? Wenn du ihn nicht einmal kennst? Hat dieser Mann dich in dem skandalösen Streifen gesehen und daraus geschlossen, dass du ein leichtes Mädchen bist?«
Papa ging reichlich scharf dazwischen. »Das reicht, Trude.« Mamas richtiger Name war Gertrude, und Papa rief sie nur dann bei ihrem Kosenamen, wenn er sie besänftigen wollte. »Vielleicht war es einfach nur ihre wunderbare schauspielerische Leistung in Sissy, die ihn zu den Blumen veranlasst hat.«
Mama steckte eine lose schwarze Strähne zurück in die perfekte Frisur und erhob sich. Sie wirkte viel größer als ein Meter fünfzig, als sie auf ihren Schreibtisch zuschritt. Sie nahm den mit den Blumen gelieferten Umschlag zur Hand und schlitzte ihn mit ihrem silbernen Brieföffner auf.
Sie hielt die mir bereits vertraute cremefarbene und goldumrahmte Karte ins Licht und las vor:
An Herrn und Frau Kiesler
Ich hatte das große Glück, Ihre Tochter letzte Woche vier Mal in der Rolle der späteren Kaiserin Elisabeth zu sehen, und beglückwünsche Sie zu deren großem Talent. Ich möchte mich Ihnen gerne persönlich vorstellen und um Ihre Erlaubnis bitten, Ihre Tochter auszuführen. Wenn es Ihnen recht ist, suche ich Sie am Sonntagabend um sechs Uhr auf, dem einzigen Zeitpunkt, zu dem das Theater dunkel ist.
Mit freundlichen Grüßen
Friedrich Mandl
Herr Mandl machte Druck.
Und meine Eltern schwiegen beredt, was mich einigermaßen überraschte. Ich dachte, meine Mutter würde diese Selbsteinladung kühn und unpassend schimpfen oder mir Vorhaltungen machen, ich hätte Herrn Mandls Aufmerksamkeit absichtlich auf mich gezogen. Und ich nahm an, mein Vater – der stets besonnen war, außer wenn es um mich ging – würde sich über das Ansinnen eines Mannes aufregen, der uns weder über Freunde noch über Verwandte verbunden war. Doch die schöne Uhr auf dem Kaminsims tickte fast eine ganze Minute laut vor sich hin, während keiner von beiden einen Ton sagte.
»Was ist los?«, fragte ich.
Papa seufzte, wie er es in den letzten Monaten immer öfter getan hatte. »Wir müssen vorsichtig sein, Hedy.«
»Warum?«
Mama leerte ihr Glas und fragte: »Weißt du irgendetwas über diesen Herrn Mandl, Hedy?«
»Ein bisschen. Ich habe mich umgehört, als er mir das erste Mal Blumen in die Garderobe schickte. Soweit ich weiß, gehört ihm ein Waffengeschäft.«
»Er hat dir schon mal Blumen geschickt?« Papa klang alarmiert.
»Ja«, sagte ich leise. »Seit der Premiere jeden Abend.«
Meine Eltern wechselten geheimnisvolle Blicke. Papa antwortete für beide. »Ich werde Herrn Mandl antworten. Wir werden ihn für morgen um sechs auf einen Cocktail empfangen, und anschließend wirst du mit ihm zu Abend essen, Hedy.«
Ich war entsetzt. Meine Mutter hatte nie einen Hehl aus ihrem Wunsch gemacht, ich möge einen netten jungen Herrn aus Döbling heiraten, und ich war stets davon ausgegangen, dass mein Vater, der sich dazu nie geäußert hatte, ähnlich dachte. Insgesamt hatten meine Eltern sich bislang nie über die Maßen in mein Privatleben eingemischt. Nicht einmal, als ich mich weigerte, den Heiratsantrag des jungen Herrn von Hochstetten, Sohn einer höchst angesehenen deutschen Familie, anzunehmen und dafür meine Schauspielkarriere aufzugeben. Insbesondere hatten sie nie geradezu von mir verlangt, mit einem bestimmten Verehrer auszugehen. Also warum jetzt? »Habe ich auch ein Mitspracherecht?«
»Es tut mir leid, Hedy, aber du musst. Wir dürfen nicht riskieren, diesen Mann zu brüskieren«, erklärte Papa traurigen Blickes.
Mir war klar, dass ich nicht darum herumkommen würde, Herrn Mandl persönlich kennenzulernen, aber ich wollte mich trotzdem wehren. Doch dann hielt mich der gequälte Ausdruck im Gesicht meines Vaters zurück. Irgendetwas, irgendjemand setzte ihn unter Druck. »Warum, Papa?«
»Du wurdest nach dem Krieg geboren, Hedy. Du verstehst nicht, dass Politik eine zerstörerische Kraft sein kann.« Er schüttelte den Kopf und seufzte.
Doch mehr sagte er dazu nicht. Seit wann hielt Papa mir Informationen vor und traute mir nicht zu, komplizierte Sachverhalte zu verstehen? Er hatte mich immer darin bestärkt, dass ich zu allem in der Lage sei, und ich hatte ihm geglaubt. Genau diese Art der elterlichen Unterstützung hatte mich dazu beflügelt, es mit der Schauspielerei zu versuchen.
Ich versuchte, nicht zu zornig und enttäuscht zu klingen. »Nur weil ich beschlossen habe, Schauspielerin zu werden, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht in der Lage wäre, Angelegenheiten außerhalb der Theaterwelt zu verstehen, Papa. Gerade du müsstest das doch wissen.«
Seine herablassende Art ärgerte mich – hatte er mich nicht die ganzen Jahre als intellektuell ebenbürtig behandelt? Wie oft hatten wir sonntags nach dem gemeinsamen Abendessen vor dem Kamin gesessen und besprochen, was in der Zeitung stand? Seit ich ein kleines Mädchen gewesen war, hatte er mir in allen Einzelheiten die Schlagzeilen erklärt, bis er das Gefühl hatte, ich würde nicht nur die nationale und internationale Politik in allen Nuancen verstehen, sondern auch die wirtschaftlichen Entwicklungen. Mama saß stets daneben, nippte an ihrem Sherry, schüttelte missbilligend den Kopf und murmelte »Was für eine Zeitverschwendung« vor sich hin. Warum dachte Papa jetzt anders von mir, nur weil ich nun die Abende im Theater verbrachte statt vor dem Kamin?
Er lächelte schwach und sagte: »Das ist wohl wahr, meine kleine Prinzessin. Dann weißt du ja sicher, dass Kanzler Dollfuß vor nur zwei Monaten, im März, eine Unregelmäßigkeit bei einem parlamentarischen Wahlvorgang nutzte, um an die Macht zu kommen und das Parlament aufzulösen.«
»Selbstverständlich weiß ich das, Papa. Das stand ja in allen Zeitungen. Ich lese nicht nur den Kulturteil. Und ich habe den Stacheldraht rund um das Parlamentsgebäude gesehen.«
»Dann verstehst du sicher auch, dass Österreich seit diesem Staatsstreich de facto eine Diktatur ist – genau wie Deutschland, Italien und Spanien. Theoretisch sind wir immer noch ein Land mit einer demokratischen Verfassung und drei Parteien. Dollfuß’ konservative Christdemokraten werden vor allem von der Landbevölkerung und der Oberschicht gewählt, die opponierenden Sozialdemokraten von Arbeitern. Und dann sind da noch die Nationalisten von der Großdeutschen Volkspartei. Doch die Realität ist eine andere. Kanzler Dollfuß regiert autoritär und arbeitet daran, diese Position zu festigen und auszubauen. Gerüchten zufolge will er den Schutzbund verbieten, den militärischen Arm der sozialdemokratischen Partei.«
Mein Magen krampfte sich zusammen, als Papa Österreich in einem Atemzug mit seinen faschistischen Nachbarländern nannte und den Regierungschef in einen Topf warf mit Adolf Hitler und Benito Mussolini. »Ich glaube nicht, dass ich es bisher irgendwo in dieser Deutlichkeit gelesen habe, Papa.« Ich wusste, dass Österreich von faschistischen Diktatoren umgeben war, aber ich hatte geglaubt, unser Land sei weitestgehend frei von ähnlich denkenden Herrschern. Noch.
»Mag sein, dass du das Wort ›Diktator‹ nicht in der Zeitung lesen wirst, aber das ist genau das, was Kanzler Dollfuß jetzt ist. Zusammen mit der Heimwehr, einer, wie du weißt, paramilitärischen Organisation, die er als seine persönliche Armee aufgezogen hat, weil es Österreich seit dem Versailler Vertrag unmöglich ist, größere Truppenverbände aufzubauen. Angebliches Oberhaupt der Heimwehr ist Ernst Rüdiger von Starhemberg, aber hinter Starhemberg steht dessen enger Freund und Geschäftspartner Friedrich Mandl. Herr Mandl beliefert die Heimwehr mit allem, was sie an Waffen braucht, und ist selbstverständlich eingeweiht in ihre Strategie.«
Zuerst dachte ich, Papa wollte mir einen politischen Vortrag halten, aber jetzt verstand ich: Er erklärte mir, wer Herr Mandl war. Und ich begriff, welche Macht dieser geheimnisvolle Mann besaß. »Verstehe, Papa.«
»Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da ist noch mehr, Hedy. Ich bin sicher, du hast in der Zeitung gelesen, dass Adolf Hitler im Januar in Deutschland zum Kanzler gewählt wurde.«
»Ja«, sagte ich, als meine Mutter sich erhob, um sich einen zweiten Schnaps einzuschenken. Normalerweise nippte sie einen ganzen Abend lang nur an einem.
»Hast du auch von der antisemitischen Politik gehört, die Hitler in Deutschland verfolgt?«
Den Zeitungsartikeln zu dieser Thematik hatte ich nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, da ich dachte, wir seien davon nicht betroffen. Aber ich wollte Papa gegenüber keine Wissenslücke eingestehen, darum sagte ich: »Ja.«
»Dann weißt du auch, dass die Nationalsozialisten, kaum dass sie an der Macht waren, einen Boykott aller jüdischen Geschäfte angeordnet und alle in Justiz und Verwaltung arbeitenden Nichtarier entlassen haben. Deutsche Juden sind nicht nur Ziel gewaltsamer Angriffe geworden, es heißt, dass ihnen sogar die Bürgerrechte entzogen werden sollen – Rechte, auf die sich österreichische Juden seit den 1840er-Jahren verlassen.«
»Davon habe ich gelesen«, behauptete ich, obwohl ich diese Artikel kaum überflogen hatte.
»Dann hast du vielleicht auch die Berichte über die österreichischen Nationalsozialisten gelesen, die eine Wiedervereinigung unseres Landes mit Deutschland herbeisehnen? Und ganz gleich, wie die Menschen Dollfuß politisch bewerten, die größte Sorge aller ist, dass Reichskanzler Hitler Österreich per Staatsstreich annektieren wird. Nichts davon ist bislang öffentlich gesagt worden, aber ich habe Gerüchte gehört, dass Kanzler Dollfuß sich letzten Monat mit Mussolini getroffen haben soll und dass Mussolini zugesagt haben soll, Österreich beizustehen und das Land zu verteidigen, falls es zu einer Invasion durch die Deutschen kommt.«
»Das sind ja eigentlich erst mal gute Nachrichten, andererseits bin ich mir nicht sicher, ob Österreich ein solches Bündnis mit Italien eingehen sollte«, merkte ich an. »Ich meine, Mussolini ist auch ein Diktator, und am Ende regiert womöglich nicht Hitler über uns, sondern er.«
Papa schaltete sich ein. »Das ist richtig, Hedy, aber Mussolini verfolgt nicht dieselbe erbarmungslose antisemitische Politik wie Hitler.«
»Verstehe«, sagte ich, obwohl mir nicht klar war, worin Papas Sorge bestand. Eine solche Politik hätte doch gar keine Bedeutung für uns. »Aber was hat das alles mit Herrn Mandl zu tun?«
»Herr Mandl pflegt eine langjährige Beziehung zu Mussolini. Er versorgt ihn mit Waffen. Gerüchten zufolge hat er das Treffen zwischen Dollfuß und Mussolini arrangiert.«
Mir wurde schwindelig, als mir aufging, wie Mandl in dieses perfide Bild passte. Das war mein Verehrer?
»Herr Mandl ist der Mann hinter Kanzler Dollfuß’ Thron. Aber er könnte auch der Mann sein, der Österreich weiter die Unabhängigkeit sichert.«
Kapitel 5
28. Mai 1933
Wien
Ich hörte das Klirren der Eiswürfel in den Gläsern, bevor Papa die Drinks einschenkte. Bemühtes Gelächter und gedämpftes Geplauder. Dann erlahmte das Gespräch, und meine Mutter versuchte, mit einer Klaviersonate von Beethoven für etwas Auflockerung zu sorgen. Meine Eltern gaben sich Mühe, Friedrich Mandl zu unterhalten.
Wir hatten besprochen, dass ich oben in meinem Zimmer warten sollte, bis Papa mich rief. So konnten meine Eltern zunächst bei der Posse mitspielen, Herrn Mandl zu begutachten und zu befinden, ob er würdig sei, ihre einzige Tochter auszuführen. In Wirklichkeit hatte Papa seine Zustimmung in dem Moment gegeben, als Herr Mandl seinen Namen unter den Brief an meine Eltern setzte.
Ich hatte schweißnasse Hände, völlig unüblich für mich. Ich war früher nie wegen irgendetwas nervös gewesen, oder zumindest nicht wegen irgendwelcher Männer. Manchmal empfand ich in der Sekunde, bevor der Vorhang aufging, ein leichtes Flattern im Bauch oder auch während der langen Minuten, bevor der Regisseur bei einem Film »Klappe, die erste« sagte, aber nie, wenn es um ein Rendezvous ging. Jungs konnten mich nicht einschüchtern, bisher hatte ich in meinen Beziehungen stets die Oberhand gehabt, war Bindungen eingegangen und hatte sie mit Leichtigkeit wieder gelöst. Ich behandelte Männer wie Subjekte, an denen ich meine Wandlungsfähigkeit erproben konnte, die das Fundament meiner Schauspielkarriere war.
Ich erhob mich von der Chaiselongue und betrachtete mich zum hundertsten Mal im großen Spiegel. Mama und ich hatten lange Diskussionen darüber geführt, was ich für diese Begegnung anziehen sollte: Ich durfte mich nicht zu aufreizend kleiden, damit er keinen falschen Eindruck von mir gewann, aber auch nicht zu mädchenhaft, da er sich sonst womöglich nicht ernst genommen fühlte und beleidigt wäre. Wir hatten uns auf ein die Schultern bedeckendes smaragdgrünes Crêpe-Kleid geeinigt, mit hochgeschnittenem Kragen und einem die Knie umspielenden Rock.
Ich ging in meinem Zimmer auf und ab und versuchte immer wieder, dem Gespräch unten zu lauschen. Hin und wieder schnappte ich ein paar Fetzen auf, aber ich konnte keine Zusammenhänge herstellen. Schallendes Gelächter erklang, und dann rief Papa die Mahagonitreppe hinauf: »Hedy, du kannst gerne herunterkommen, wenn du so weit bist.«
Ein letzter Blick in den Spiegel, dann ging ich nach unten. Papa erwartete mich in der Tür zum Salon, sein Gesicht eine sorgfältig aufgesetzte Maske der Freundlichkeit. Mir war bewusst, dass er sich dahinter enorme Sorgen machte.
Ich hakte mich bei Papa unter und betrat den Salon. Mama saß auf dem Sofa Herrn Mandl gegenüber und hatte einen wachsamen Gesichtsausdruck. Von Herrn Mandl sah ich nur den Rücken und den ordentlich gekämmten Hinterkopf.
»Herr Mandl, darf ich Ihnen meine Tochter vorstellen. Fräulein Hedwig Kiesler. Sie haben sie sicher schon gesehen, aber begegnet sind Sie ihr wohl noch nie.« Papa schob mich weiter.
Mama und Herr Mandl erhoben sich gleichzeitig, und unser Gast drehte sich um. Ich hatte bereits so viele Gerüchte über Politiker und Frauen gehört, dass ich erwartet hatte, ihn widerwärtig zu finden. Genau darauf war ich vorbereitet, als er sich förmlich verneigte. Doch als er sich wieder aufrichtete und sich unsere Blicke begegneten, fand ich ihn unerwartet attraktiv. Nicht unbedingt äußerlich, obwohl er durchaus gut aussah, wenn auch ein wenig geleckt in seinem tadellosen marineblauen Anzug von Savile Row und mit den glitzernden Manschettenknöpfen. Nein, seine Attraktivität hatte mehr mit der Macht und dem Selbstbewusstsein zu tun, die er verströmte. Im Gegensatz zu all meinen bisherigen Verehrern war er kein Jüngling mehr, sondern ein gestandener Mann.
Er übernahm die Führung. »Es ist mir eine große Ehre, Fräulein Kiesler. Ich bin voller Bewunderung für Ihre Arbeit, wie Sie sicher wissen.«
Meine Wangen wurden heiß, auch das völlig unüblich für mich. »Vielen Dank für die Blumen. Sie waren wunderschön und …«, ich suchte nach einem passenden Wort, »… üppig.«
»Nur ein bescheidener Versuch, Ihnen zu zeigen, wie viel Freude Ihre Arbeit mir bereitet.« Die schmeichelnden Worte flossen ihm geschmeidig über die Lippen.
Betretenes Schweigen machte sich breit. Normalerweise hatte die gesellschaftlich so versierte Mama stets eine passende Äußerung parat, doch Herr Mandl schien alle aus dem Konzept gebracht zu haben. Es war Papa, der die Situation schließlich rettete. »Herr Mandl hat uns von seiner großen Liebe zur Kunst erzählt.«
»Ja.« Er wandte sich mir zu und sagte: »Ich hörte, dass Ihre Mutter bis zu ihrer Heirat Konzertpianistin war. Sie sagte, sie würde außer für ihre Familie überhaupt nicht mehr spielen, und ich muss gestehen, dass ich sie förmlich bedrängte, für mich eine Ausnahme zu machen. Wie sie den Beethoven gespielt hat – einfach virtuos.«
Jetzt war es Mama, die errötete. »Vielen Dank, Herr Mandl.«
Dass meine Mutter für unseren Gast gespielt hatte, verriet mir mehr über die Ängste meiner Eltern, als Papas Vorträge über Herrn Mandls politisches und militärisches Taktieren es je vermocht hätten. Vor zwanzig Jahren, als meine Eltern heirateten und Mama ihre Laufbahn als Pianistin aufgab, hatte sie geschworen, nie wieder vor jemandem zu spielen, der nicht zur Familie gehörte. Und bis heute hatte sie sich eisern an diesen Schwur gehalten.
»Ich vermute, Sie haben auch Ihrer Tochter beigebracht, so wunderbar zu spielen«, sagte er.
»Nun …« Mama zögerte.
Sie brachte es nicht über sich, etwas Gutes über mein Klavierspiel zu sagen. Sie erwartete Perfektion, und meine Leistungen am Klavier enttäuschten sie regelmäßig. Genau wie mein Aussehen, als ob sie glaubte, ich hätte es mir absichtlich so ausgesucht, weil ich ihr damit trotzen wollte.
»Haben Sie auch eins der anderen Stücke gesehen, die diesen Monat Premiere hatten, Herr Mandl?« Ich lenkte die Aufmerksamkeit von meiner sichtlich verunsicherten Mutter auf ein allgemeineres Gesprächsthema, um zu vermeiden, dass Mama unvorteilhaft über mich redete.
Aus seinen braunen Augen sah er mich ernst an. »Um ehrlich zu sein, Fräulein Kiesler, hat mich ihr Auftritt in Sissy für alles andere verdorben. Ich bin Abend für Abend immer nur im Theater an der Wien gewesen.«
Die Intensität, mit der er sprach, bereitete mir Unbehagen, und ich hätte am liebsten den Blick abgewendet. Aber ich konnte spüren, dass er nicht Unterwürfigkeit von mir wollte, sondern Stärke. Und so begegnete ich seinem Blick und sagte, was die Etikette von mir verlangte: »Sie schmeicheln mir, Herr Mandl.«
»Ich meine jedes Wort so, und Sie haben jede einzelne Rose verdient.«
Mama war wieder ganz sie selbst und platzte mit einem Satz heraus, den sie mir seit meiner Kindheit immer wieder vorgehalten hatte. Jedes Mal, wenn jemand gesagt hatte, ich sei hübsch oder ich würde gut Klavier spielen oder gut schauspielern, jedes Mal, wenn Papa mir erklärte, wie der Motor eines Automobils funktionierte oder eine Porzellanfabrik: »Das ist doch zu viel des Guten, Herr Mandl.«
Dieser Satz war nicht als die zuneigungsvolle Ermahnung gemeint, nach der er oberflächlich klang. In ihm kam Mamas Haltung zum Ausdruck, dass ich Gutes nicht verdiente, dass ich bereits viel zu viel bekommen hatte und dass ich letztendlich unwürdig war.
Würde dieser Fremde die Kritik erkennen, die hinter den Worten meiner Mutter lag?
Wenn Herr Mandl die wahre Bedeutung durchschaute, so ließ er es sich nicht anmerken. »Es wäre mir eine große Freude, Ihrer Tochter noch sehr viel mehr Gutes zu tun, Frau Kiesler«, sagte er, und dann, an Papa gerichtet: »Gestatten Sie mir, Ihre Tochter zum Essen auszuführen?«
Nach einem kurzen, entschuldigenden Blick in meine Richtung antwortete mein Vater: »Ja, Herr Mandl, ich gestatte es Ihnen.«
Kapitel 6
28. Mai 1933
Wien
In Herrn Mandls Limousine wurden wir zum Hotel Imperial gefahren, und kaum hatten wir die Lobby betreten, scharte sich das Personal um uns. Selbst der notorisch blasierte Oberkellner des legendären Hotelrestaurants eilte herbei, um Herrn Mandl seine Dienste anzubieten. Die wenigen Male, die ich bisher zu besonderen Anlässen – an Geburtstagen und zu meinem Schulabschluss – mit meinen Eltern zum Essen hier gewesen war, hatten wir förmlich um Aufmerksamkeit betteln und fast eine Stunde warten müssen, bevor wir überhaupt bestellen durften. Das für seine ausgezeichnete Küche genauso wie für sein hochmütiges Personal bekannte Restaurant kam mir an Herrn Mandls Arm wie ein völlig anderer Ort vor. Aber ich versuchte, mein Erstaunen zu kaschieren, und gab die weltgewandte Schauspielerin.
Hinter uns wurde geflüstert, während wir zu einem Tisch in der Mitte eines holzgetäfelten Raums geführt wurden. Ich hatte Papa stets für einen erfolgreichen Mann gehalten, und das war er natürlich auch, aber erst jetzt begriff ich, was Macht war. Anhand der Beflissenheit von Restaurantpersonal und der Blicke der anderen Gäste. Kurios.