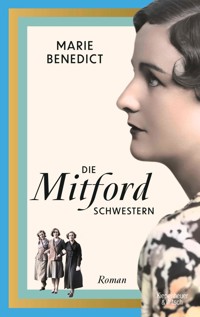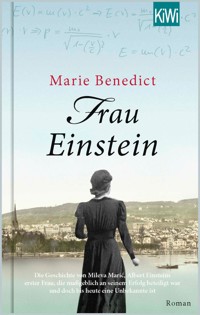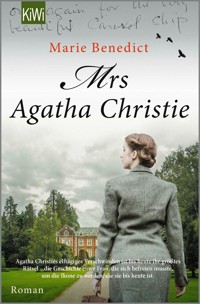
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte
- Sprache: Deutsch
Über eines der größten Geheimnisse der Literaturgeschichte: Agatha Christies elftägiges Verschwinden im Jahr 1926. Die mysteriöse Geschichte um das elftägige Verschwinden der weltberühmten Kriminalautorin bietet Benedict den Stoff für ihren besten und spannendsten Roman bisher. Ein Pageturner bis zur letzten Seite. Im Dezember 1926 wird Agatha Christie vermisst. Ermittler finden ihr leeres Auto am Rande eines tiefen, düsteren Teichs, darin ihr Pelzmantel – ungewöhnlich für eine eisige Nacht. Ihr Ehemann, ein Veteran des Ersten Weltkriegs, und ihre Tochter wissen nicht, wo sie sich aufhält, und England löst eine beispiellose Fahndung nach der Krimiautorin aus. Elf Tage später taucht sie wieder auf, genauso mysteriös, wie sie verschwunden war. Sie behauptet, an Amnesie gelitten zu haben und gibt keine Erklärung für ihre Abwesenheit ab. Bis heute weiß niemand, was damals geschah. Marie Benedict erzählt die Geschichte einer zunächst glücklichen Ehe, die jedoch mehr und mehr zerbricht, je erfolgreicher Agatha wird. Welche Rolle spielte ihr untreuer Ehemann, und was hat er den Ermittlern verschwiegen? Agatha Christies Verschwinden ist vielleicht ihr spannendster Fall. Marie Benedict liefert eine erschreckend plausible Lösung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Marie Benedict
Mrs Agatha Christie
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Marie Benedict
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Marie Benedict
Marie Benedict, geboren 1973, studierte am Boston College Geschichte und Kunstgeschichte und an der Boston University School of Law. Ihre Bücher über starke Frauen der Weltgeschichte haben Bestsellerstatus. Ihr Roman »Frau Einstein« verkaufte sich über 100.000 Mal allein in Deutschland. Sie ist Anwältin und lebt mit ihrer Familie in Pittsburgh.
Marieke Heimburger, geboren 1972, hat in Düsseldorf Literaturübersetzen für Englisch und Spanisch studiert. Seit 1998 übersetzt sie englischsprachige Literatur, u.a. Stephenie Meyer, Rowan Coleman, Kiera Cass, Sally McGrane, seit 2010 auch aus dem Dänischen, u. a. Jussi Adler-Olsen, Anna Grue, Mads Peder Nordbo.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Mrs Agatha Christie« erzählt die mysteriöse Geschichte um das elftägige Verschwinden der weltberühmten Kriminalautorin im Jahr 1926. Die zunächst glückliche Ehe der Christies zerbricht immer mehr, je erfolgreicher Agatha als Schriftstellerin wird. Welche Rolle spielte ihr untreuer Ehemann in dem Vermisstenfall, und was hat er den Ermittlern verschwiegen? Agatha Christies Verschwinden ist vielleicht ihr spannendster Fall. Ein Pageturner bis zur letzten Seite.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: The Mystery of Mrs Christie
© Marie Benedict 2021.
Die Originalausgabe ist 2021 bei Sourcebooks (Naperville, IL) erschienen
All rights reserved
Aus dem amerikanischen Englisch von Marieke Heimburger
© 2022, 2023, 2025 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Trevillion Images
ISBN978-3-462-30152-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Der Anfang
Teil 1
Kapitel 1 Das Manuskript
Kapitel 2 Tag eins nach dem Verschwinden
Kapitel 3 Das Manuskript
Kapitel 4 Tag eins nach dem Verschwinden
Kapitel 5 Das Manuskript
Kapitel 6 Tag eins nach dem Verschwinden
Kapitel 7 Das Manuskript
Kapitel 8 Tag eins nach dem Verschwinden
Kapitel 9 Das Manuskript
Kapitel 10 Tag eins nach dem Verschwinden
Kapitel 11 Das Manuskript
Kapitel 12 Tag eins nach dem Verschwinden
Kapitel 13 Das Manuskript
Kapitel 14 Tag zwei nach dem Verschwinden
Kapitel 15 Das Manuskript
Kapitel 16 Tag zwei nach dem Verschwinden
Kapitel 17 Das Manuskript
Kapitel 18 Tag drei nach dem Verschwinden
Kapitel 19 Das Manuskript
Kapitel 20 Tag drei nach dem Verschwinden
Kapitel 21 Das Manuskript
Kapitel 22 Tag drei nach dem Verschwinden
Kapitel 23 Das Manuskript
Kapitel 24 Tag vier nach dem Verschwinden
Kapitel 25 Das Manuskript
Kapitel 26 Tag fünf nach dem Verschwinden
Kapitel 27 Das Manuskript
Kapitel 28 Tag sechs nach dem Verschwinden
Kapitel 29 Das Manuskript
Kapitel 30 Tag sechs nach dem Verschwinden
Kapitel 31 Das Manuskript
Kapitel 32 Tag sechs nach dem Verschwinden
Kapitel 33 Das Manuskript
Kapitel 34 Tag sieben nach dem Verschwinden
Kapitel 35 Das Manuskript
Kapitel 36 Tag acht nach dem Verschwinden
Kapitel 37 Das Manuskript
Kapitel 38 Tag acht nach dem Verschwinden
Kapitel 39 Das Manuskript
Kapitel 40 Tag acht und neun nach dem Verschwinden
Kapitel 41 Das Manuskript
Kapitel 42 Tag zehn nach dem Verschwinden
Kapitel 43 Das Manuskript
Teil 2
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Das Ende Oder ein neuer Anfang
Anmerkung der Autorin
Danksagung
Der Anfang
Der Brief auf dem Schreibtisch erzittert im Takt der donnernden Schritte. Ihr Puls überträgt sich, und die schwarzen eckigen Worte auf dem elfenbeinfarbenen Papier erwachen zum Leben.
Wie soll diese Geschichte enden? Wenn du mich fragst, gibt es zwei Wege, die du nun einschlagen kannst. Der erste würde dich etwas sanfter zum Ziel bringen als der zweite, aber natürlich wären beide mit gewissen Blessuren für dich verbunden. Kleine Verletzungen, die eine unvermeidbare Konsequenz der gesamten Übung sind, wie du sicher inzwischen begriffen haben wirst. Oder habe ich dich überschätzt, und du bist immer noch vollkommen ahnungslos? Wie dem auch sei. Ich werde mein Ziel – das du zweifelsohne restlos inakzeptabel finden wirst – erreichen. Das erfreuliche Ergebnis deines doppelten Spiels wird sein, dass ich mich aus den Fesseln deiner ewigen Wertung und deines Fehlverhaltens befreie – auch wenn das gewiss nicht das Ergebnis ist, das dir vorschwebte. Denn du hattest stets nur eins im Blick: die Befriedigung deiner eigenen Bedürfnisse. Ich kam bei dir nie an erster Stelle, obwohl mir gesagt wurde, du müsstest bei mir stets an erster Stelle kommen.
Im Zimmer wird es der Morgenstunde zum Trotz immer düsterer. Der Wind stößt das angelehnte Fenster auf und fegt die Papiere vom Schreibtisch. Die Worte verschwinden in der Finsternis, doch als ein Blitz aufzuckt, treten sie erneut hervor. Ein Donnerkrachen. Wie ausgesprochen passend, dass sich ausgerechnet jetzt ein Gewitter zusammenbraut, denkt er.
Lies weiter und halte dich genauestens an meine Anweisungen, wenn du dich für den sicheren ersten Weg entscheidest. Es wird nicht leicht werden. Du wirst stark sein müssen, auch wenn der Weg sich als steinig erweist und dich Zweifel und Scham plagen. Nur, wenn du dich auf dieser Reise an all meine Anweisungen hältst, wird diese Geschichte für uns alle ein gutes Ende nehmen.
Teil 1
Kapitel 1Das Manuskript
12. Oktober 1912
Ugbrooke House, Devon, England
Ich hätte mir keinen perfekteren Mann ausdenken können.
»Lassen Sie Ihre Tanzkarte fallen«, raunte mir jemand zu, als ich mich durch die Menge auf die Tanzfläche zubewegte. Wer wagte es, so etwas zu sagen? Insbesondere, da ich bei Thomas Clifford untergehakt war, jenem entfernten Verwandten meiner Gastgeber Lord und Lady Clifford in Chudleigh, der auf diesem Ball in Ugbrooke House von allen noch ungebundenen Damen mit höchster Aufmerksamkeit beäugt wurde.
Impertinent, dachte ich. Geradezu unverschämt. Ich malte mir aus, wie die Szene weitergehen würde, wenn mein Tanzpartner das Zugeraunte gehört hätte. Oder noch schlimmer, wenn mein Tanzpartner mein Auserwählter – mein Schicksal, wie meine Freundinnen und ich angehende Ehemänner nannten – gewesen wäre und dadurch seine Entscheidung noch einmal überdacht hätte. Und doch durchlief mich ein leiser Schauer, und ich fragte mich, wer es wohl wagte, so dreist zu sein. Ich sah mich um, doch da erklangen die ersten Töne der 1. Sinfonie von Elgar, und mein Begleiter begann, mit mir zu tanzen.
Während wir uns zu den Walzertakten bewegten, versuchte ich, in der Menge, die die riesige Tanzfläche säumte, den Zurauner auszumachen. Mutter würde mich sofort schelten, weil ich mich nicht auf den jungen Mr Clifford konzentrierte, aber ich hatte gerüchteweise gehört, dass dieser begehrte Junggeselle mit seinen hervorragenden Verbindungen eine reiche Erbin heiraten musste und darum gar kein ernsthaftes Interesse an mir hegen konnte. Ich war gänzlich unvermögend, das Einzige, was ich zu bieten hatte, war ein zukünftiges Erbe in Form eines Anwesens namens Ashfield, das viele wohl eher als Fluch denn als Segen betrachteten, zumal ich über keinerlei Mittel verfügte, das marode Gebäude instand zu halten. Bezüglich Mr Clifford vertat ich also keine Chance. Und ich hegte keinerlei Zweifel, dass sich mir schon bald eine echte Chance bieten würde. Denn das war die Bestimmung aller jungen Frauen: von einem Mann im Sturm erobert und dann vom Schicksal mitgerissen zu werden.
Dutzende Herren in Fräcken standen in der Ecke des prächtigen Ballsaals, doch niemandem von ihnen hätte ich eine solch verwegene Äußerung zugetraut. Bis ich ihn erblickte. Blond gelockt stand er am Rand der Tanzfläche und sah unverwandt zu mir. Kein einziges Mal richtete er das Wort an einen der anderen Herren, kein einziges Mal unternahm er einen Versuch, eine der anderen Damen zur Tanzfläche zu geleiten. Als er sich schließlich doch bewegte, ging er zum Orchester und sprach mit dem Dirigenten. Dann kehrte er zurück an seinen Platz in der Ecke.
Das Orchester verstummte, und Mr Clifford führte mich zurück zu meiner Freundin Nan Watts, die reichlich außer Atem war nach einer flotten Sohle mit einem noch ganz rotgesichtigen Bekannten ihrer Eltern. Als das Orchester das nächste Stück anstimmte und der nächste eifrige junge Gentleman herbeieilte, um Nan aufs Parkett zu entführen, warf ich einen Blick in das an einem roten Seidenband von meinem Handgelenk baumelnde Tanzheft, um nachzusehen, wer mein nächster Tanzpartner war.
Da legten sich kräftige Finger um mein Handgelenk. Ich sah auf und blickte in die tiefblauen Augen des Mannes, der mich zuvor aufmerksam beobachtet hatte. Instinktiv zog ich meine Hand zurück, doch im selben Moment gelang es ihm, mir die Tanzkarte von der Hand zu streifen und seine Finger mit meinen zu verflechten.
»Vergessen Sie Ihre Tanzkarte. Nur für dieses eine Stück«, sagte er mit tiefer, kehliger Stimme – derselben Stimme, die vor wenigen Minuten so Verwegenes gefordert hatte. Ich konnte kaum glauben, was er da von mir verlangte, und war schockiert, dass er ungefragt meine Karte an sich genommen hatte. Es gehörte sich einfach nicht, mit einem anderen Mann zu tanzen als mit dem, der auf der Tanzkarte vermerkt war, selbst wenn diese Karte abhandengekommen war.
Ich glaubte, die ersten Töne eines bekannten Stückes von Irving Berlin zu hören. Es klang wie »Alexander’s Ragtime Band«, aber mir war klar, dass ich mich irren musste. Lord und Lady Clifford würden ihr Orchester niemals anweisen, etwas so Modernes zu spielen. Im Gegenteil, ich nahm an, dass sie diese Abweichung vom üblichen Protokoll erbost zur Kenntnis nehmen würden. Auf dem Programm für heute standen ausschließlich klassische symphonische Stücke und gesetzte Tänze, die nicht geeignet waren, die Leidenschaft der jungen Leute zu entfachen.
Er beobachtete mich. »Ich hoffe, Sie mögen Berlin«, sagte er und schmunzelte selbstzufrieden.
»Sie haben das angeordnet?«
Sein Lächeln wurde breiter und offenbarte seine Grübchen. »Ich hörte, wie Sie zu Ihrer Freundin sagten, dass Sie sich über etwas modernere Musik freuen würden.«
»Wie haben Sie das eingefädelt?« Ich staunte nicht nur über seine Dreistigkeit, sondern auch über seine Entschlossenheit. Ich muss gestehen, ich fühlte mich geschmeichelt. So einen Einsatz hatte noch nie jemand gezeigt, um mich zu beeindrucken. Jedenfalls kein einziger von den zweifelhaften Verehrern, mit denen meine Mutter mich vor zwei Jahren als Debütantin in Kairo verkuppeln wollte. In Kairo deshalb, weil Mutter sich die vielen Dinge, die nötig waren, um mich angemessen in die Gesellschaft einzuführen – neue Kleider, die Veranstaltung und der Besuch zahlreicher Partys und die Miete für ein Stadthaus in London für die Dauer der Ballsaison –, schlicht nicht hätte leisten können. Ja, nicht einmal der liebe Reggie, den ich schon mein ganzes Leben als den netten großen Bruder meiner lieben Freundinnen, der Lucy-Schwestern, kannte, der aber in letzter Zeit mehr als nur ein Freund der Familie geworden war, hatte sich je so für mich ins Zeug gelegt. Reggie und ich hatten uns – mit dem Wissen unserer Eltern – darauf verständigt, unser Leben und unsere Familien eines Tages durch eine Heirat zusammenzuführen. Diese zukünftige Eheschließung war noch nicht näher bestimmt, aber ein verbindlicher Plan. Neben dem stürmischen Werben dieses jungen Mannes wirkte meine Allianz mit Reggie geradezu brav.
»Tut das etwas zur Sache?«, fragte er.
Es verschlug mir die Sprache. Ich senkte den Blick, spürte, wie ich rot wurde, und schüttelte den Kopf.
»Tanzen Sie mit mir.« Seine Stimme. Leise, aber bestimmt.
Und obwohl ich gleichzeitig die Stimme meiner Mutter im Ohr hatte, wie sie mich davor warnte, mit einem Mann zu tanzen, dem ich nicht förmlich vorgestellt worden war, ganz zu schweigen davon, dass er sich seine Eintrittskarte zum Ball in Ugbrooke House womöglich erschlichen und meine Tanzkarte konfisziert hatte, sagte ich: »Ja.«
Was konnte ein einziger Tanz schon anrichten?
Kapitel 2Tag eins nach dem Verschwinden
Samstag, 4. Dezember 1926
Hurtmoore Cottage, Godalming, England
Die Präzision, mit der bei der Familie James der Frühstückstisch gedeckt wird, erfüllt ihn mit einem Gefühl der Befriedigung, wie er es seit seiner Rückkehr aus dem Krieg selten empfunden hat. Das glänzende Besteck neben dem edlen Porzellan, jedes Teil akkurat neben dem nächsten platziert. Die fein geätzten Minton-Porzellanteller – vermutlich die Grasmere-Reihe – stehen exakt zwei Zoll von der Tischkante entfernt, und die Blumen – ein dezentes, aber sehr elegantes Gesteck aus Roten Winterbeeren und Immergrün – befinden sich in der Tischmitte. Bei Gott, denkt er. Das ist die Art von Ordnung, die einem Mann innere Ruhe verschafft.
Warum sieht es bei ihm zu Hause nicht so aus? Warum muss er sich dort ständig über den Mangel an haushälterischer Disziplin ärgern sowie mit den Gefühlen und Bedürfnissen aller anderen Menschen im Haus behelligt werden? Empörung steigt in ihm auf, zu Recht, wie er findet.
»So, jetzt möchten wir einen Toast aussprechen«, sagt sein Gastgeber Sam James und nickt seiner Frau Madge zu. Die bedeutet dem Dienstmädchen, den Champagner zu bringen, der in einem kristallenen Kühler auf der Anrichte wartet.
»Eigentlich wollten wir ja gestern schon auf eure Pläne anstoßen, Archie, aber durch den überraschenden Besuch von Reverend –«, hebt Madge an zu erklären.
Auf Nancys Wangen breitet sich eine sanfte Röte aus, und obwohl ihr das ganz hervorragend steht, begreift Archie sofort, dass ihr diese Form der Aufmerksamkeit ihrer Gastgeber unangenehm ist. Die Hand hebend sagt er: »Das ist eine sehr noble Geste, liebste Madge, aber gänzlich überflüssig.«
»Bitte, Archie«, beharrt Madge. »Wir freuen uns alle so für euch. Und ihr werdet nicht viel Gelegenheit zum Feiern haben.«
»Wir bestehen darauf«, pflichtet Sam seiner Frau bei.
Jeder weitere Prostest wäre unhöflich, das ist auch Nancy klar. Dieses Gespür für Anstand ist etwas, das sie und ihn verbindet, und er liebt sie dafür. Sie muss er diesbezüglich nicht mit fester Hand anleiten, wie es ihm in anderen Lebensbereichen abverlangt wird. Bei sich zu Hause, um genau zu sein.
»Danke, Sam. Madge. Eure Unterstützung bedeutet uns sehr viel«, entgegnet er. Nancy nickt.
Das Hausmädchen macht sich daran, die kristallenen Sektflöten mit dem honigfarbenen perlenden Champagner zu befüllen. Kaum ist sie damit fertig, klopft es.
»Entschuldigen Sie die Störung, Sir«, ertönt mit schwerem ländlichen Akzent die Stimme einer Frau durch die geschlossene Speisezimmertür. »Aber der Colonel wird am Telefon verlangt.«
Er wechselt einen verwunderten Blick mit Nancy. So bald hatte er mit keinem Anruf gerechnet, eigentlich hatte er gar nicht unbedingt mit einem Anruf gerechnet, da er sich bezüglich seines Aufenthaltsortes an diesem Wochenende weitestgehend bedeckt gehalten hatte. Aus gutem Grund. Nancy stellt ihr Glas auf dem makellosen Tischtuch ab, berührt ihn behutsam am Ellbogen und signalisiert auf diese Weise schweigend, dass auch sie dieser Anruf beunruhigt.
»Entschuldigt mich bitte.« Er nickt seinen Gastgebern zu, die ihre Gläser ebenfalls wieder abstellen. Er erhebt sich, schließt sein Jackett und nickt auch Nancy zu, mit einer Zuversicht, die er nicht empfindet. Langen Schrittes verlässt er das Speisezimmer und schließt leise die Tür hinter sich.
»Hier entlang, Sir«, sagt das Dienstmädchen und führt ihn zu einem winzigen Raum unter der mit kunstvollen Schnitzereien versehenen Haupttreppe von Hurtmore Cottage – das im Übrigen viel mehr ist als ein Cottage, nämlich ein vornehmes Anwesen. In der Kammer wartet das Telefon auf ihn, der Hörer liegt neben dem Apparat.
Er nimmt Platz, drückt sich mit der einen Hand den Hörer ans Ohr und hält sich mit der anderen das Mikrofon vor den Mund. Aber er wird erst etwas sagen, wenn das Mädchen die Tür hinter sich geschlossen hat.
»Hallo?« Die Unsicherheit in seiner Stimme ärgert ihn. Nancy schätzt ihn doch vor allem für sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein.
»Entschuldigen Sie bitte die Störung, Sir. Charlotte Fisher hier.«
Was zum Teufel fällt Charlotte ein, ihn hier anzurufen? Er hatte ihr die Information, dass er das Wochenende in Hurtmore Cottage verbringen würde, unter dem Siegel der größtmöglichen Verschwiegenheit anvertraut. In den letzten Monaten hatte er sich wirklich sehr bemüht, sich bei der Privatsekretärin und Gouvernante einzuschmeicheln, um den von ihm erhofften Übergang möglichst reibungslos zu gestalten. Aber in diesem Moment lässt er alle Bemühungen, sie zu umgarnen, zur Hölle fahren und verhehlt seinen Zorn nicht. »Ich dachte, ich hätte Sie angewiesen, nur im absoluten Notfall Kontakt zu mir aufzunehmen, Charlotte.«
»Ganz richtig, Colonel«, stammelt sie. »Ich befinde mich auf Styles, im Foyer, und neben mir steht ein Constable Roberts.«
Charlotte verstummt. Glaubt sie wirklich, der Hinweis auf die Anwesenheit eines Polizeibeamten in seinem Haus sei Erklärung genug? Was soll er ihrer Meinung nach jetzt sagen? Sie wartet ab, und während keiner von ihnen spricht, wird ihm angst und bange. Er weiß nicht, was er sagen soll. Was weiß sie? Und noch viel wichtiger: Was weiß der Constable? Jedes Wort, das er jetzt sagt, könnte zur Falle werden.
»Sir«, sagt sie schließlich. »Meiner Ansicht nach handelt es sich um einen absoluten Notfall. Ihre Frau ist verschwunden.«
Kapitel 3Das Manuskript
12. Oktober 1912
Ugbrooke House, Devon, England
Durch den Ballsaal ging ein überraschtes Raunen, als immer mehr Gäste das Stück von Irving Berlin erkannten. Die älteren Tänzer wirkten unsicher, ob es sich ziemte, zu so moderner Musik zu tanzen, doch mein Partner zog mich entschlossen auf die Tanzfläche und begann mit einem Onestep. Die anderen jungen Leute taten es uns nach.
Wo sonst die komplizierten Walzerschritte automatisch für einen gewissen Abstand sorgten, hatte ich jetzt das Gefühl, meinem unbekannten Tanzpartner körperlich außerordentlich nah zu kommen. Fast wünschte ich mir, eines jener altmodischen Kleider zu tragen, in deren Korsetts man wie in einer Rüstung steckte. Im Versuch, für ein klein wenig Distanz zwischen dem Wagehals und mir zu sorgen, richtete ich den Blick starr über seine Schulter. Sein Blick dagegen ruhte unverwandt auf mir.
Normalerweise entwickelte sich zwischen meinen Tanzpartnern und mir immer eine angenehme Plauderei, aber nicht mit ihm. Was sollte ich sagen? Schließlich war er es, der das Schweigen brach. »Sie sind noch viel hübscher, als Arthur Griffiths erzählt hat.«
Ich wusste nicht, welcher Teil dieser Äußerung mich am meisten erstaunte: der Umstand, dass dieser Mann und ich einen gemeinsamen Bekannten hatten, oder dass er so verwegen war, mich als »hübsch« zu bezeichnen, obwohl wir uns noch nicht einmal offiziell vorgestellt worden waren. Schließlich galten strenge Benimmregeln, und auch wenn diese in den letzten Jahren lockerer geworden waren – eine Bemerkung zu meinem Äußeren gleich zu Anfang unserer Bekanntschaft entsprach nicht einmal den laxesten Konventionen. Offen gestanden gefiel mir seine Freimütigkeit, aber eigentlich durfte Mädchen wie mir derartige Direktheit nicht gefallen. Mir blieben zwei Möglichkeiten: Entweder ließ ich ihn als Quittung für diesen Fauxpas stehen und verließ die Tanzfläche – oder ich ignorierte, was er gesagt hatte. Da mich dieser Mann trotz seiner Regelverstöße faszinierte, entschied ich mich für Letzteres und fragte freundlich: »Sie kennen Arthur Griffiths?« Der Sohn des Pfarrers war ein Freund von uns.
»Ja, wir sind beide bei der Royal Field Artillery, und wir sind beide in Exeter stationiert. Als ihm der Dienstplan bezüglich des Balls heute Abend einen Strich durch die Rechnung machte, schlug er vor, dass ich statt seiner herkomme und nach Ihnen Ausschau halte.«
Ah. Das erklärt einiges, dachte ich. Ich begegnete seinem Blick und stellte fest, dass seine Augen von einem ganz ungewöhnlichen Blau waren. »Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?«
»Ich wusste nicht, dass das nötig war.«
Ich schluckte eine Bemerkung dazu herunter, dass jeder aus einer guten Familie stammende junge Mann wusste, wie man sich in neuen Kreisen vorstellte und dass es dabei auch dazugehörte, auf gemeinsame Bekannte zu verweisen. Stattdessen suchte ich nach einer harmlosen Antwort und sagte: »Arthur ist ein feiner Kerl.«
»Kennen Sie ihn denn gut?«
»Nicht sehr gut, nein, aber er ist ein lieber Freund. Wir lernten uns kennen, als ich die Mathews in Thorp Arch Hall in Yorkshire besuchte, und wir verstanden uns gut.«
Mein Tanzpartner, der sich mir immer noch nicht mit Namen vorgestellt hatte, entgegnete nichts. Das Schweigen irritierte mich, und so geriet ich ins Plappern. »Er ist ein guter Tänzer.«
»Das klingt, als seien Sie enttäuscht, nicht ihn hier zu sehen, sondern mich.«
Ich beschloss, zu versuchen, den jungen Mann ein wenig aufzumuntern. »Nun ja, Sir, immerhin ist das hier unser erster Tanz. Und da Sie mich von meiner Tanzkarte befreit haben, bietet sich Ihnen womöglich die Gelegenheit zu einem zweiten, bei dem Sie mir dann Ihre tänzerischen Fähigkeiten beweisen können.«
Er lachte herzlich. Er wirbelte mich über die Tanzfläche, vorbei an den vertrauten Gesichtern der Wilfreds und der Sinclairs, und ich lachte mit ihm und fühlte mich ganz anders als alle anderen um uns herum. Irgendwie freier. Lebendiger.
»Genau das habe ich vor«, sagte er.
Mutig fragte ich weiter: »Und was genau machen Sie bei der königlichen Feldartillerie in Exeter?«
»Ich fliege.«
Ich erstarrte innerlich. Fliegen war gerade in aller Munde, und nun tanzte ich mit einem Piloten! Wie aufregend! »Sie fliegen?«
Selbst in dem gedämpften Licht des Ballsaals war zu erkennen, dass mein Tanzpartner rot anlief. »Also, im Moment werde ich als Kanonier eingesetzt, obwohl ich der 245. approbierte Flugzeugführer Großbritanniens bin. Aber es dauert nicht mehr lange, dann werde ich Teil des neu gegründeten Royal Flying Corps.« Seine ohnehin breite Brust schwoll bei diesen Worten ein wenig an.
»Wie ist es da oben? Am Himmel?«
Zum ersten Mal löste er den Blick von mir und sah zu den Fresken über uns, als könne er dort, am kunstvoll dargestellten Firmament mit den vielen Engeln, die Antwort finden. »Berauschend und seltsam, den Wolken so nah zu sein und die Welt da unten so klein zu sehen. Aber auch ganz schön beängstigend.«
Ich kicherte. »Mir fehlt dazu die Vorstellungskraft, aber ich würde es gerne einmal erleben.«
Ein Schatten legte sich über seine blauen Augen, und er stimmte einen ernsthafteren Ton an. »Ich fliege nicht, weil ich es aufregend finde, Miss Miller. Wenn es zu einem Krieg kommt – und ich glaube, das wird über kurz oder lang der Fall sein –, werden Flugzeuge darin eine wichtige Rolle spielen. Ich möchte entscheidend zu den Kriegshandlungen beitragen, ich möchte im riesigen Getriebe der Kriegsmaschinerie ein maßgebliches Rädchen sein. Natürlich, um England zu helfen, aber auch, um später in meiner Laufbahn davon zu profitieren. Denn Flugzeuge werden in unserem Land zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor werden.«
Seine Ernsthaftigkeit und sein Mut beeindruckten mich. Er war ganz anders als alle anderen Männer, die ich bis dahin zu Hause in Devon und selbst in Ägypten kennengelernt hatte. Ich war außer Atem, und das nicht nur von dem flotten Onestep.
»Alexander’s Ragtime Band« klang aus, und ich blieb stehen und löste mich aus der Tanzhaltung. Mein Partner ergriff meine Hand. »Bleiben Sie hier bei mir. Wie Sie selbst sagten, Sie haben keine Tanzkarte mehr. Sie sind frei.«
Ich zögerte. Nichts wünschte ich mir mehr, als noch einmal mit ihm zu tanzen und endlich das Rätsel um die Identität dieses ungewöhnlichen Mannes zu lösen. Aber wieder hörte ich meine Mutter, wie sie mir Vorhaltungen machte: Eine junge Frau sendet unpassende Signale aus, wenn sie zweimal hintereinander mit demselben Herrn tanzt – zumal, wenn sie bereits einem anderen versprochen ist. Ich wollte eine Gegenleistung.
»Unter einer Bedingung«, sagte ich.
»Gerne, Miss Miller. Ihr Wunsch ist mir Befehl.«
»Sie verraten mir, wie Sie heißen.«
Wieder errötete er, als ihm aufging, dass er vor lauter Beherztheit das Einmaleins des guten Tons vergessen hatte. Er verneigte sich tief und sagte dann: »Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Miller. Mein Name ist Lieutenant Archibald Christie.«
Kapitel 4Tag eins nach dem Verschwinden
Samstag, 4. Dezember 1926
Hurtmoore Cottage, Godalming, England, sowie Styles, Sunningdale, England
»Alles in Ordnung?«, fragt Sam, als Archie in das Speisezimmer zurückkehrt.
Er hat sich längst eine Antwort auf die unvermeidliche Frage zurechtgelegt, doch als er sie ausspricht, stammelt er dennoch. Lügen ist ihm noch nie leichtgefallen, auch wenn die Umstände in der letzten Zeit ihm reichlich Gelegenheit gaben, sich darin zu üben. »Es, äh, es geht um meine Mutter. Sie … Es geht ihr nicht gut. Leider.« Bevor er mehr erläutern kann, holt Madge bereits erschrocken Luft. Er hebt die Hand und versichert ihr: »Nichts Ernstes, sagt der Arzt. Aber sie hat nach mir verlangt, und selbstverständlich muss ich ihrer Bitte nachkommen.«
Sam nickt. »Man muss seine Pflicht erkennen und tun.«
»Aber wenn die Lage nicht allzu ernst ist, dann kannst du Nancy doch sicher bis einschließlich morgen Mittag entbehren?« Madge hatte sich rasch von ihrer Sorge um Archies Mutter erholt und warf einen kecken Blick auf ihre Freundin. »Sam und ich würden sie liebend gerne für ein paar Runden Whist als Geisel hierbehalten.«
»Ich wüsste nicht, was dagegenspräche«, sagte Archie und bedachte erst Madge und dann Nancy mit einem abgerungenen Lächeln. Nancy, so lieblich und anspruchslos und hübsch in ihrem zartblauen Kleid, hatte sich einen fröhlichen, sorglosen Nachmittag mit ihrer Freundin verdient.
»Wirst du zum Abendessen zurück sein?«, fragt Sam, und Archie spürt, wie enttäuscht die James sind. Sie waren so freundlich gewesen, dieses Wochenende zu planen, und jetzt sabotierte er ihre freundliche Geste. Eine Geste, die vermutlich niemand anders gezeigt hätte.
»Ich rufe an, sobald ich Näheres weiß. Sollte es nicht möglich sein –« Archie unterbricht sich selbst, er weiß nicht, was er sagen soll. Er weiß nicht, was ihn auf Styles erwartet, er weiß nicht, was die Polizei weiß, und er kann nicht für sämtliche Eventualitäten planen.
Sam springt ihm bei. »Keine Sorge, alter Freund. Wenn du es nicht schaffst, zum Abendessen wieder hier zu sein, bringen wir Nancy nach Hause.«
Er empfindet große Dankbarkeit und schreitet um den Tisch, um seinem Freund die Hand zu schütteln. Da klopft es abermals an der Tür.
»Schon wieder? Dieses verdammte Stubenmädchen«, brummt Sam irritiert, bevor er ruft: »Was ist denn jetzt?«
»Da steht ein Polizist vor der Tür, Sir«, sagt das Mädchen durch den Türspalt.
Archie wird übel. Er weiß – oder er glaubt zu wissen –, warum die Polizei bei den James vor der Haustür steht.
»Was?« Sam hätte kaum perplexer aussehen können, wenn das Mädchen ihm mitgeteilt hätte, sein geliebter Foxhound habe sich spontan in einen Pudel verwandelt. Polizisten waren dazu da, sich um Streitigkeiten unter armen Arbeitern zu kümmern, nicht, um an die Portale herrschaftlicher Landsitze zu klopfen.
»Ja, Sir, ein Polizist, Sir. Er möchte mit dem Colonel sprechen.«
»Aber worüber denn nur?«
»Das will er nicht sagen. Er sagt nur, dass er mit dem Colonel sprechen will.«
Von einem Polizisten zu einer Befragung abgeholt zu werden, ist – zumal nach der Lüge bezüglich des Gesundheitszustands seiner Mutter – eine Erniedrigung, die fast schwerer wiegt als Archies Sorge um die Natur dieser Befragung. Was Madge und Sam jetzt wohl von ihm denken? Wie soll er ihnen das erklären? Und wie erst Nancy?
Fast gerät er mit seinem Delage ins Schlingern und verliert so um ein Haar den Polizeiwagen aus den Augen, dem er folgen soll. Ihm kommt ein leichtsinniger Gedanke: Was, wenn er einfach davonführe und sich der Situation auf Styles entzöge? Wäre der Polizeiwagen in der Lage, ihn einzuholen?
Nein, er wird sich seiner Strafe stellen wie ein Mann. Ganz gleich, wie sein Handeln beurteilt werden wird, Archie möchte nicht, dass ihm nachgesagt wird, er sei pflichtscheu und würde vor seinen Fehlern davonlaufen.
Er folgt dem Polizeiwagen über die ihm so wohlbekannte Straße zu seinem Haus. Der Staub, den das Beamtenfahrzeug aufwirbelt, verschleiert eine Weile die Sicht, doch als er sich wieder legt, tauchen die Tudor-Türme von Styles vor Archie auf, fast genauso beeindruckend wie bei seinem ersten Besuch hier. Wie viel sich doch seither verändert hat, denkt er und verdrängt jede Erinnerung an jenen Tag.
Archie ist klar, dass er irgendwie die Oberhand gewinnen muss. Vielleicht, indem er als Hausherr auf Styles den Ton angibt? Er wartet nicht, bis der Polizist ausgestiegen ist, sondern marschiert an den anderen bereits vor dem Anwesen aufgereihtenPolizeiwagen vorbei direkt auf die angelehnte Haustür zu. Er stößt sie auf und staunt, dass kein einziger der schwarz uniformierten Beamten, die sich wie ein Schwarm tödlicher Bienen um ihre Königin in der Küche versammelt haben, von ihm Notiz nimmt. Archie wird bewusst, dass dies die Gelegenheit ist, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen, bevor er irgendetwas sagt.
Er wirft einen prüfenden Blick auf den Mahagonitisch im Foyer. Ob auf dem Silbertablett dort wohl irgendwelche Visitenkarten liegen? Nein. Aber Archie fällt etwas Ungewöhnliches auf: Unter dem Tablett lugt die Ecke eines Umschlags hervor, der zum elfenbeinfarbenen Briefpapier seiner Frau gehören muss.
Während die Polizisten gebannt der lauten und doch seltsam gedämpften Stimme eines Mannes lauschen, den Archie nicht sehen kann – sicherlich handelt es sich um ihren Vorgesetzten –, zieht er den Umschlag unter dem Tablett hervor und bewegt sich auf leisen Sohlen in sein Arbeitszimmer, dessen Tür er geräuschlos hinter sich schließt.
Mit seinem Brieföffner aus Elfenbein schlitzt er den Umschlag auf. Die ausladende, eckige Handschrift seiner Frau starrt ihm von dem Briefbogen entgegen. Archie steht unter Zeitdruck, aber er braucht nur wenige Sekunden, um ihre Worte zu überfliegen. Am Ende angelangt, sieht er auf und hat das Gefühl, aus einem tiefen Schlaf erwacht zu sein und sich in einem Albtraum wiederzufinden. Wann um alles in der Welt kann sie die Zeit gehabt haben – nein, die Voraussicht, den Scharfsinn, die berechnende Geduld –, diese Zeilen zu schreiben? Hat er seine Frau je wirklich gekannt?
Die engen Wände seines Arbeitszimmers scheinen noch näher zu rücken, Archie bekommt kaum noch Luft. Aber er weiß, dass er handeln muss. Der Brief hat ihm klargemacht, dass er nicht länger der Vollstrecker eines Plans ist, sondern lediglich eine Spielfigur – und zwar eine, die in einem Labyrinth gefangen ist. Er muss einen Ausweg finden. Er schleudert den Brief auf den Schreibtisch und beginnt, auf und ab zu gehen, während es im Arbeitszimmer aufgrund des aufziehenden Gewitters immer dunkler wird. Was in Gottes Namen soll er tun?
Er weiß nur eins: Er ist bereit, seine Strafe anzunehmen, aber er hat nicht vor, dem Kerkermeister die Schlüssel zu überreichen. Niemand darf dieses Dokument je zu Gesicht bekommen. Mit wenigen Schritten ist Archie beim Kamin, lässt den Brief samt Umschlag ins Feuer fallen und sieht dabei zu, wie Agathas Worte in Flammen aufgehen.
Kapitel 5Das Manuskript
19. Oktober 1912
Villa Ashfield, Torquay, England
Ich eilte über die Straße vom Anwesen der Mellors zurück nach Hause. Ich hatte mit meinem Freund Max Mellor Badminton gespielt, als sein Dienstmädchen mich ans Telefon gerufen hatte. Meine reichlich aufgebrachte Mutter war am anderen Ende der Leitung und zitierte mich nach Hause, weil dort ein ihr unbekannter junger Mann »höchst ungeduldig« auf mich wartete. Sie hatte ihm gesagt, sie erwarte mich binnen einer Viertelstunde zurück, und als ich nicht auftauchte – und die Minuten verstrichen und er keine Anstalten machte, wieder zu gehen –, hatte sie zum Telefon gegriffen. Der arme Kerl, wer auch immer er war, hatte offenbar sämtliche Signale meiner Mutter, sich doch bitte zu absentieren, ignoriert.
Hätte meine Mutter nicht angerufen und mich bedrängt, wäre ich gerne noch länger bei den Mellors geblieben, Max und ich verstanden uns prächtig. Das Leben in Torquay war einfach herrlich: tagsüber spontane Picknicks, Segeltörns, Sportveranstaltungen, Ausritte und Musiknachmittage, abends sorgfältig geplante Gartenpartys, Tanztees und private Feiern. Die Wochen und Monate zogen vorbei wie ein angenehmer, sorgenfreier Traum – dessen einziges Ziel für junge Frauen war, sich einen Ehemann zu angeln –, und ich wollte nicht daraus erwachen.
Ich vermutete, dass der Besucher der langweilige Marineoffizier war, den ich am Vorabend bei einer Dinnerparty kennengelernt hatte. Er hatte mich gebeten, den anderen Gästen seine unbeholfenen Gedichte vorzulesen. Ich hegte keinerlei Interesse daran, diese wenig inspirierende Bekanntschaft zu vertiefen, aber ich wollte auch nicht, dass er Mutter zu lange enervierte. Zwar war sie ein äußerst geduldiger und gutmütiger Mensch, insbesondere mir gegenüber, aber wenn sie es mit Langweilern zu tun bekam oder von jemandem aus dem Konzept gebracht wurde, konnte sie ziemlich mürrisch werden. Seit dem Tod meines Vaters vor fast zehn Jahren stand ich bei meiner Mutter im Mittelpunkt und leistete ihr Gesellschaft – insbesondere, da meine große Schwester Madge und mein großer Bruder Monty längst ihr eigenes Leben lebten. Mir gefiel das gut. Mummy und ich hatten eine ganz wunderbare Beziehung, es gab auf der ganzen Welt niemanden, der mich besser verstand als sie, und obwohl sie viel stärker war, als man auf den ersten Blick annehmen mochte, wollte ich sie immer gerne beschützen. Der Schock über den Tod meines Vaters und die daraus resultierenden finanziellen Schwierigkeiten hatten uns eng zusammengeschweißt. Wir beide gegen den Rest der Welt.
Von dem raschen Lauf über die Straße waren meine Wangen erhitzt. Ich zog meinen Cardigan aus und reichte ihn Jane, unserem Hausmädchen. Bevor ich den Salon betrat, prüfte ich im Spiegel, ob ich präsentabel war. Mein braunes Haar, von der Sonne in ein schimmerndes Dunkelblond verwandelt, sah ganz reizend aus, und das obwohl – oder gerade weil – sich ein paar Strähnen aus dem Zopf gelöst hatten. Ich beschloss, sie nicht zurück unter die Haarnadeln zu schieben, strich mir die Haare aber wenigstens glatt. Es war mir mehr oder weniger egal, was der Gast, den ich im Salon erwartete, von mir denken würde, aber ich erfüllte immer noch gerne Mutters Erwartung an mich als ein »hübsches Mädchen«.
Ich betrat den Salon, wo meine Mutter an ihrem üblichen Platz in einem Sessel neben dem Kamin saß und stickte. Sie sah auf, legte die Handarbeit beiseite und erhob sich, um den Raum bei der ersten sich bietenden Gelegenheit verlassen zu können. Auch ihr Gegenüber erhob sich. Ich sah ihn lediglich von hinten und fand, dass sein blondes Haar heller wirkte als das des Marineoffiziers gestern Abend.
Ich ging auf die beiden zu und nickte, statt einen Knicks zu machen. Als ich wieder aufsah, wanderte mein Blick erst zu Mutter und dann zu dem Besucher, der zu meiner Überraschung nicht der von mir erwartete Marineoffizier war, sondern der Mann von dem Ball bei den Chudleighs: Archibald Christie.
Mir verschlug es zunächst die Sprache. Seit dem Ball vor einer Woche hatte ich nichts von ihm gehört, und inzwischen hatte ich auch nicht mehr daran geglaubt, je wieder von ihm zu hören. Die meisten anderen Herren bekundeten ihr Interesse an einem Mädchen spätestens zwei Tage nach einem Ball – keinesfalls erst nach sieben.
Mutter räusperte sich und sagte: »Agatha, dieser junge Mann – Lieutenant Christie, wenn ich mich nicht irre – sagt, ihr kennt euch aus Chudleigh.«
Ich sammelte mich und antwortete: »Ganz richtig, Mummy. Das ist Lieutenant Christie, Mitglied der Royal Field Artillery. Er ist in Exeter stationiert, und ich habe ihn bei dem Ball der Cliffords in Chudleigh kennengelernt.«
Sie beäugte ihn vom Scheitel bis zur Sohle. »Exeter ist ganz schön weit weg von hier, Lieutenant Christie.«
»Richtig, Madam. Ich fuhr zufällig mit dem Motorrad durch Torquay, und da fiel mir wieder ein, dass Miss Miller hier lebt. Ich erkundigte mich bei jemandem auf der Straße, wo genau, und jetzt bin ich hier.«
»Jetzt sind Sie hier.« Sie seufzte. »Was für ein außerordentlicher Zufall, dass Sie ausgerechnet in Torquay unterwegs waren.«
Der Sarkasmus und der Unglaube in ihrer Stimme waren nicht zu überhören, und ich staunte, dass meine so sanftmütige Mutter einem Fremden gegenüber so scharfzüngig war. Was hatte er ihr in der guten Viertelstunde, die sie unter vier Augen verbrachten, getan, das sie zu dieser ungewöhnlichen Reaktion veranlasste? Lag es einfach nur daran, dass er nicht Reggie war? Ich sah zu Lieutenant Christie, dessen Wangen rot leuchteten. Er tat mir leid, und ich unternahm einen Rettungsversuch.
»Auf dem Ball bei den Cliffords hatten Sie erwähnt, dass Sie womöglich demnächst in Torquay zu tun haben würden, Lieutenant Christie, ich erinnere mich. Irgendetwas Dienstliches.«
Die Erleichterung war ihm anzusehen, und sofort stürzte er sich auf den von mir gelieferten Vorwand. »Ganz richtig, Miss Miller. Und Sie hatten mich freundlicherweise eingeladen vorbeizuschauen, wenn ich in der Nähe bin.«
Mutter ließ sich von diesem Geplänkel nicht blenden, aber wenigstens verhalf es Lieutenant Christie zu einem Quäntchen Würde. Und es lieferte Mutter einen Grund, sich aus dem Salon zurückzuziehen. Anders als auf dem Kontinent war es in England durchaus üblich, dass unverheiratete Männer und Frauen allein gelassen wurden, solange sich Anstandsdamen in der Nähe aufhielten oder das unverheiratete Paar tanzte. »Ich muss mit Mary über das Abendessen sprechen. Hat mich sehr gefreut, Lieutenant –« Sie gab vor, sich nicht an seinen Namen zu erinnern, womit sie einiges darüber sagte, was sie von diesem jungen Mann hielt.
»Christie, Madam.«
»Lieutenant Christie«, sagte sie und verschwand.
Wir atmeten gleichzeitig aus. Um die Stimmung ein wenig aufzuhellen, sagte ich: »Wie wäre es mit einem Spaziergang durch unsere Gärten? Es ist zwar ein bisschen kühl, aber unsere Anlagen sind durchaus interessant. Und ich würde so gerne Ihr Motorrad sehen.«
»Sehr gerne, Miss Miller.«
Das Hausmädchen half uns in unsere Mäntel – für einen längeren Spaziergang war ein Cardigan nicht warm genug –, dann begaben wir uns nach draußen. Auf der Höhe des Küchengartens erklärte ich Lieutenant Christie, dass wir uns nicht hinter die hohe Mauer begeben würden, weil der einzige Charme des Küchengartens in unfassbaren Mengen reifer Himbeeren und Äpfel bestand. Stattdessen führte ich ihn zum richtigen Garten.
Der prüfende Blick meiner Mutter hatte Lieutenant Christie eingeschüchtert, und das wiederum spornte mich an. Breit lächelnd zog ich ihn auf: »Kann ich Ihnen die Geheimnisse meines Gartens anvertrauen?«
Er erwiderte mein Lächeln nicht. Stattdessen sah er mir tief in die Augen und sagte: »Wenn es nach mir ginge, könnten Sie mir alle Ihre Geheimnisse anvertrauen.«
Die Ernsthaftigkeit, mit der er das sagte, verwirrte mich ein wenig, doch nachdem ich ihm den Ilex, die Zedern und die Riesenmammutbäume gezeigt hatte sowie die beiden Tannen, von denen Madge und Monty behaupteten, sie gehörten ihnen, kam ich wieder zur Ruhe. »Die Buche hier ist mein Lieblingsbaum. Sie ist der größte Baum im ganzen Garten, und als ich klein war, habe ich mich immer mit ihren Bucheckern vollgestopft.« Ich strich mit der Hand über ihren Stamm und dachte zurück an die vielen Tage, die ich als Mädchen auf ihren Ästen verbracht hatte. Das war lange her.
»Jetzt verstehe ich, wieso der Garten Ihnen so viel bedeutet. Er ist wunderschön.« Er zeigte auf ein Wäldchen in einiger Entfernung. »Gehört das auch Ihnen?«
Seine Augen leuchteten ehrfürchtig. Vermutlich hielt er uns für reich; die Villa und die Gärten machten in der Tat einiges her, wenn man ein Auge zudrückte und über den punktuellen Verfall und die abblätternde Farbe hinwegsah. In meiner frühen Kindheit waren wir wohlhabend gewesen, doch Geldsorgen stellten sich ein, als ich ungefähr fünf war. Mein Vater, der als Sohn eines reichen Amerikaners in seinem Leben keinen einzigen Tag gearbeitet und stets angenommen hatte, ihm würde immer weiter Geld zufließen, hatte plötzlich Mühe, seine Familie zu ernähren. Von seinem Einkommen mietete er die Villa Ashfield, und da es sich in England etwas günstiger lebte als in Amerika, konnten wir auf diese Weise unseren Lebensstandard einigermaßen aufrechterhalten. Die existenziellen Sorgen hatten jedoch Auswirkungen auf die Gesundheit meines armen, lieben Papas, er wurde zusehends schwächer und starb dann. Das ist zehn Jahre her. Mutter und ich schlugen uns mithilfe einiger mildtätiger Freunde mehr schlecht als recht durch. Das kleine Einkommen, das uns bisher die Existenz gesichert hatte, hatte sich vor nicht allzu langer Zeit empfindlich reduziert, nachdem die Wertpapierfirma, von der wir einen Teil unserer mageren Alimentierung bezogen, liquidiert worden war.
»Ja«, sagte ich und führte ihn auf den Weg durch die Eschen hindurch. »Aber die Bäume dort sind nichts Besonderes, als kleines Mädchen fand ich sie längst nicht so faszinierend. Ganz zu schweigen von dem Weg, der zu den Tennis- und Krocketplätzen führt, den mochte ich nie recht leiden.«
»Und warum nicht?«
»Als Kind lebte ich wohl mehr in einer Fantasiewelt als in der Welt des Sports«, sagte ich, doch Lieutenant Christie antwortete nicht, während er interessiert und zufrieden die Krocket- und Tennisplätze beäugte. Er konnte nicht ahnen, wie unfassbar unsportlich ich mich dort trotz tapferer Versuche zeigte. Einzig ein schlichtes Badminton-Spiel bescherte mir winzige Erfolgserlebnisse. Nachdem meine mich immer so liebevoll unterstützende und fördernde Mutter Zeugin meiner wiederholten Enttäuschungen geworden war, hatte sie dafür gesorgt, mein Interesse stattdessen auf Musik, Theater und Literatur zu lenken. Auf diesem Gebiet blühte ich förmlich auf, insbesondere während meiner Unterrichtsjahre in Frankreich. Den Gedanken an eine professionelle Laufbahn als Pianistin oder Sängerin hatte ich erst vor Kurzem auf Anraten des geschätzten Pianisten Charles Furster und meiner Londoner Gesangslehrer aufgegeben, aber das Schreiben hatte sich zu einer Leidenschaft entwickelt, die ich pflegte wie meine Freundinnen das Sticken oder die Malerei. Dabei war mir stets bewusst, dass mein Schreiben immer ein reiner Zeitvertreib bleiben würde und dass mein Schicksal ganz und gar in den Händen meines Ehemannes liegen würde. Wer auch immer das sein mochte. Wann auch immer er in mein Leben treten würde.
Während Lieutenant Christie schweigend die Sportanlagen betrachtete, fragte ich: »Hatten Sie als Kind auch einen besonderen Ort?«
Er runzelte die Stirn, sein Blick verfinsterte sich. »Als Kind lebte ich in Indien, wo mein Vater als Richter bei den indischen Behörden diente. Kaum kehrte unsere Familie nach England zurück, starb er bei einem Reitunfall. Wir lebten dann so lange bei der Familie meiner Mutter im südlichen Irland, bis meine Mutter erneut heiratete, einen Lehrer namens William Hemsley, und wir nach Clifton zogen. Ich bin also ziemlich herumgekommen und kann nicht sagen, dass ich als Kind einen besonderen Ort gehabt hätte. Ich hatte nicht einmal einen eigenen Ort.«
»Wie traurig, Lieutenant Christie. Wenn Sie möchten, dürfen Sie die Gärten von Ashfield sehr gerne mit mir teilen. Kommen Sie jederzeit her und besuchen Sie sie, wenn Sie wieder in Torquay sind.«
Wieder richtete er seine blauen Augen auf mich, als wollte er mich mit ihnen fangen. »Das wäre mir eine große Ehre, Miss Miller, wenn Sie das ernst meinen.«
Ich wollte diesen ungewöhnlichen Mann wiedersehen. Natürlich beschlich mich leise der Gedanke an meine Vereinbarung mit Reggie und damit ein schlechtes Gewissen, aber ich hielt an dem Gesagten fest: »Nichts würde mich mehr freuen, Lieutenant Christie.«
Kapitel 6Tag eins nach dem Verschwinden
Samstag, 4. Dezember 1926
Styles, Sunningdale, England
Archie eilt aus seinem Arbeitszimmer und stößt dabei fast mit dem behelmten jungen Polizisten zusammen, der ihn am Hurtmore Cottage abgeholt hat. Er bedenkt den Mann mit einem abschätzigen Blick und stürmt Richtung Küche, wo sich eine ganze Schar Polizisten versammelt hat. Archie betet, dass sein Auftritt als besorgter, aufgebrachter Ehemann die richtige Strategie ist.
»Was soll das? Warum tummeln Sie sich alle in meiner Küche, statt die Gegend zu durchkämmen?«, blafft Archie die Männer an und klingt dabei viel wütender, als er tatsächlich ist.
Einer der Beamten, ein jüngerer Bursche mit erstaunlich sanften Gesichtszügen, lässt sich von Archies Gezeter nicht beeindrucken und sagt: »Sir, ich bin sicher, dass das nicht leicht für Sie ist und dass Sie sich große Sorgen machen.«
»Sie untertreiben.« Archie richtet sich zu seiner vollen beeindruckenden Größe auf in der Hoffnung, so mehr Autorität auszustrahlen. »Ich möchte mit dem Einsatzleiter sprechen.«
Der junge Polizist wieselt los in Richtung Beamtenschar und holt einen Mann mittleren Alters daraus hervor, der in einem zerknitterten Mantel sowie einem schlecht sitzenden grauen Anzug steckt. Archie betrachtet den breitschultrigen Officer mit Hängebacken, in dessen blondem Schnauzbart Krümel hängen und der freundlich-verhalten lächelnd mit ausgestreckter Hand auf ihn zukommt. Mit diesem Lächeln will er sowohl Mitgefühl als auch Herzenswärme signalisieren, sicher hat er es schon unzählige Male aufgesetzt, vielleicht macht man das so als Landpolizist. Es wirkt falsch, und im aufmerksamen Blick des Beamten meint Archie auch unterschwelliges Misstrauen sowie verborgene Schläue zu bemerken. Er wird auf der Hut sein müssen.
»Mr Christie, ich möchte Ihnen Deputy Chief Constable Kenward vorstellen«, sagt der junge Polizist und deutet eine Verbeugung in Richtung Kenward an. Wie schafft der Mann es, mit einer solch ungepflegten Erscheinung derartige Achtung bei seinen Untergebenen zu genießen?, fragt Archie sich, doch dann begreift er, was die vielen Titel bedeuten, und zuckt innerlich zusammen. Warum wird ein so hochrangiger Kommissar mit diesem Fall betraut?