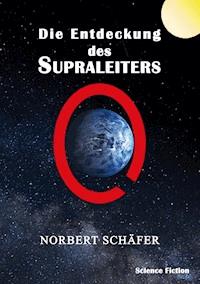
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe, die über dreißig Jahre andauert, eine Liebe, die durch Sehnsucht geprägt ist, Menschen, die lieber ihren beruflichen Werdegang als sich selbst in den Vordergrund stellen. Forschung in einem Space-Labor, Weltraumschrott und Überlebenswille, eine zufällige Entdeckung, die die Welt revolutionieren könnte, ein Terrorist, der die Weltherrschaft sucht. Das alles in einer Geschichte, die in einer Studentenkneipe in Köln beginnt ... Ein Supraleiter ist ein Material, das dem elektrischen Strom keinen Widerstand entgegensetzt. Strom kann damit verlustfrei übertragen werden. Würde es ein Material geben, das bei Umgebungstemperatur supraleitend wäre, würde das die Energieversorgung revolutionieren und die Ressourcen über viele Jahrzehnte schonen. Von dem Abenteuer, ein solches Material zu entdecken, handelt diese Geschichte, von den Menschen, die unmittelbar damit zu tun haben: Carmen, Günther und Christopher, deren Lebenswege in Köln beginnen und unterschiedlicher nicht sein können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Prolog: Studentenkneipe in Köln
Kapitel 1: Günther Flossdorf
Kapitel 2: Carmen
Kapitel 3: Weltraumlabor
Kapitel 4: Christopher Morgenstern
Kapitel 5: Schlechte Nachrichten
Kapitel 6: Carmen Schneider
Kapitel 7: Weltraumschrott
Kapitel 8: Rätsel
Kapitel 9: Der Aufprall
Kapitel 10: Christopher Morgenstern
Kapitel 11: Labor
Kapitel 12: Aufräumen
Kapitel 13: Zurück zur Erde
Kapitel 14: Die Pressekonferenz
Kapitel 15: Fragen
Kapitel 16: Die Entdeckung
Kapitel 17: Christopher Morgenstern
Kapitel 18: Versuche
Kapitel 19: Das Patent
Kapitel 20: Flucht
Kapitel 21: Zusammenarbeit
Kapitel 22: Jetzt wird’s ernst
Kapitel 23: Produktion im All
Kapitel 24: Der erste Transport
Kapitel 25: Unruhige Zeiten
Kapitel 26: Bedrohung
Kapitel 27: Produktion auf der Erde
Kapitel 28: Carmen
Kapitel 29: Für die Zukunft
Kapitel 30: Verhaftung
Epilog
Carmen
Günther
Anhang
Supraleitung − was ist das?
Rückblende in das Jahr 2016
Bild: Space-Labor
PROLOG
Studentenkneipe in Köln
2056
„Auf uns, auf dass wir uns nie aus den Augen verlieren, und wenn doch, immer wiederfinden.“
Mit einem 0,4er-Kölsch-Glas prostete Christopher Morgenstern seinen Freunden zu. Sie feierten, sie feierten das Ende der Studienzeit und den Beginn der „Nie-mehr-kein-Geld-Zeit“ in einer kleinen Studentenpinte in der Kyffhäuser Straße in Köln mit dem Namen „Zopf“. Der „Zopf“ war unter den Studenten sehr beliebt und galt in der Szene als Heiratsvermittlungsinstitut.
Ein unscheinbares Gebäude, direkt hinter einer alten schweren Eingangstür aus Holz versperrte ein dicker Filzvorhang die Blicke nach innen, aber auch von draußen der frischen Luft den Weg ins Innere. Ein schmaler Gang führte an der Theke vorbei zur Tanzfläche. Man bestellte sein Kölsch und rief dem Wirt zu, wo man hin wollte: „Zwei Kölsch, ich bin hinten durch.“ Der Wirt grüßte zurück und zapfte einfach weiter. Er wusste, seine Kellnerin würde das Zeug schon unter die Leute bringen, ob bei ihm bestellt wurde oder nicht.
Die drei Freunde saßen diesmal an der Theke. Christopher kannte den Wirt, er war schon viele Male der Letzte gewesen und so lernte man sich kennen und schätzen.
Christopher studierte Elektrotechnik an der Kölner Technischen Hochschule und war seit zwei Monaten mit dem Studium fertig. Er jobbte über eine Zeitarbeitsfirma bei den verschiedensten Unternehmen. Er meinte, das wäre zwar Ausbeute, aber so könne er schnell in viele Unternehmen reinschnuppern und Erfahrungen sammeln, vielleicht dann auch bei der einen oder anderen Firma hängen bleiben.
Carmen Schreiner erhob ihr Glas und prostete zurück. Dabei überschlug sich ihre Stimme ein wenig. Sie hatte für Alkohol nichts übrig, aber wollte nicht der Spielverderber sein.
Carmen studierte nicht, sie hatte nach dem dritten Semester ihr Elektrotechnik-Studium hingeworfen und war mit dreiundzwanzig Jahren zur Bundespolizei gegangen. Zurzeit befand sie sich in der Ausbildung zu einer Sondereinheit, einer Splittergruppe der GSG9. Sie war mit Günther Flossdorf befreundet, ja, sie waren, wenn man es richtig nahm, ein Paar, obwohl sie eigentlich nur befreundet sein wollten.
Günther Flossdorf wollte nicht mehr trinken, da er regelmäßig von Christopher unter den Tisch gesoffen wurde. So prostete er mit seinem halbvollen Kölsch den beiden verhalten zu.
„Was ist los, Günni, machst du schlapp?“
Günther hasste es, wenn Christopher ‚Günni‘ sagte.
„Ja, ich hab genug und Carmen auch. Lass uns Schluss machen, wir haben schon halb eins und die letzten Bahnen fahren in einer halben Stunde.“
„Du lahmer Sack. Das ist unser letzter gemeinsamer Abend und du machst schlapp?“
„Ja, ich kann doch eh nicht mit dir mithalten und Carmen noch weniger. Schau, sie legt den Kopf schon an meine Schulter und macht die Augen zu. Lass uns Schluss machen.“
Günther war nicht danach, am kommenden Tag Kopfschmerzen bis unter die Schädeldecke zu haben, auch wenn zwei Aspirin da weiterhelfen würden, hatte er keine Lust dazu.
Er studierte Maschinenbau mit Schwerpunkt Werkstofftechnik und war vor drei Wochen mit seiner Masterarbeit fertig geworden und vor einigen Tagen mit seinem Kolloquium. Jetzt bestand eine Aussicht auf eine Stelle im „Deutschen Institut für Luft und Raumfahrt“ in Köln-Porz. Daher kannten sich die drei, sie hatten im selben Labor als Aushilfen und studentische Hilfskraft gearbeitet.
Langsam und zärtlich hob Günther Carmens Kopf ein wenig an und ging mit seinem Mund ganz nah an ihr Ohr, er wollte nicht gegen die laute Musik anschreien. Doch Carmen hörte nicht, wurde aber doch allmählich wach.
„Lass uns tanzen, mein Schatz!“
„Nein, jetzt nicht mehr.“
„Nndoch, lassunstansen.“
„Nein ...“ In diesem Augenblick rutschte Carmen von ihrem Barhocker und saß auf dessen Fußstütze. „Da, schau, mein Schatz, du kannst doch nicht mehr stehen.“
Sichtlich amüsiert beobachtete Christopher seine Freunde, die nach seiner Meinung viel zu wenig vertrugen und sich in diesem Augenblick total lächerlich machten.
„Na, wenn ihr unbedingt wollt, dann geht. Ich bleibe noch, bis Jupp mich wieder rauswirft.“ Er stützte sich auf die Bar und gab dem Barkeeper „High Five“.
Günther stützte Carmen.
„Okay, Christopher, es ist spät und wir haben wie immer super gefeiert. Carmen und ich gehen jetzt.“ Er gab Christopher die Hand und verabschiedete sich so gut es bei dieser Lautstärke ging, dabei entschuldigte er sich für Carmen, die zwischenzeitlich nicht mitzubekommen schien, was vor sich ging.
Vor dem „Zopf“ zog er ihr die Jacke über, die herbstliche Nacht atmete einen kühlen Wind aus. Nach vielleicht zweihundert Schritten und der frischen Abendluft kam Carmen wieder zu sich.
„Ach, sind wir schon auf dem Nachhauseweg? Ich hab gar nicht gemerkt, wie wir uns verabschiedet haben. War Christopher sauer?“
„Schatz, du weißt doch, er kennt kein Maß und kein Ziel, er ist da geblieben und wollte unbedingt wieder als Letzter den Laden verlassen.“
„Wir kennen Christopher jetzt schon so lange und ich kann mich immer noch nicht an ihn gewöhnen.“
„Ich glaube, der braucht ständig jemanden, den er fertig machen kann, damit er oben auf ist. Ich wollte mich eigentlich nicht mit ihm treffen, aber er drängte so sehr, dass ich nachgegeben habe.“
„Na ja, wir werden uns sicherlich in diesem Leben so schnell nicht mehr wiedersehen.“
„Wenn ich mich an die Zeit in 2056 zurückerinnere, wie alles begann, würde ich vieles anders machen. Also mit dem Wissen von heute. Aber es ist müßig, darüber nachzudenken. Schauen wir in die Zukunft.“
KAPITEL 1
Günther Flossdorf
2060
Die Erde sieht von hier so schön aus. Bis vor einigen Jahren konnten sich nur wenige Menschen diesen Blick leisten. Jetzt, da die Raumfahrt mehr und mehr privatisiert ist, können sich auch Normalsterbliche an diesem Anblick erfreuen, dachte Günther Flossdorf.
Er gehörte zu diesen wenigen Menschen − ein junger Wissenschaftler, der sich einen Traum erfüllt hatte und diesen Anblick endlich am 18. April 2060 an dem kleinen Bullauge der Raumstation genießen konnte. Nachdem ihn die Gespräche mit seinen Kollegen nervten und er diesen entfliehen musste, fand Günther endlich einmal Ruhe dazu. Bereits seit acht Monaten arbeitete, schlief und langweilte er sich mit seinen Kollegen. Er kannte nahezu jede Minute im Leben seiner Kollegen und konnte diese Geschichten, die das Leben schrieb, einfach nicht mehr hören.
Günther Flossdorf saß vor einem kleinen runden Fenster im Aufenthaltsraum einer privat betriebenen Raumstation. Der Weltall-Boom hatte in den letzten zehn Jahren im All so etwas wie Komfort entstehen lassen, man wollte es den zahlenden Gästen etwas bequemer machen. Die teils unwürdigen Zustände auf den Raumstationen aus dem zwanzigsten Jahrhundert waren untragbar geworden. Kommerz gleich Komfort, hieß es plötzlich.
Die Station umkreiste die Erde und dieses Bullauge zeigte immer in ihre Richtung. Für einige Kollegen wurde der Aufenthaltsraum dadurch zu einer Art Therapieraum.
Günther und sieben weitere Wissenschaftsastronauten zählten zur Besatzung dieser von einer privaten Organisation ins Leben gerufenen Raumstation. Die Branche boomte. Unternehmen, die unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit wissenschaftliche Versuche durchführen wollten, konnten sich hier einmieten. Mit der privaten Raumfahrt hatten solche Versuche einen wahren „Run“ erfahren. Besonders die Pharma-Industrie erhoffte sich neue Erkenntnisse, aber auch Unternehmen der Freizeit-Branche versuchten, Fuß zu fassen und testeten Freizeit-Simulationen unter Extrembedingungen. Einigen Visionären schwebte ein Freizeitpark im All vor. So wurden in einem Labortrakt die Auswirkungen von Achterbahnen unter Schwerelosigkeit auf den menschlichen Organismus erprobt. Die Durchlaufzeit der Probanden wurde auf einen Monat begrenzt. Man stellte fest, dass bei den ersten Versuchsdurchläufen das Verdauungssystem diese Belastungen nur sehr begrenzt verkraften konnte. Nach etwa einem Jahr hatte man so viele Erkenntnisse gewonnen, dass die Probanden durch computergesteuerte Dummys ersetzt wurden, was die Kosten der Versuche erheblich reduzierte.
Wenn Günther im All mal Freizeit hatte, sah er gern bei diesen Versuchen zu. Einmal konnte er an einer Versuchsfahrt teilnehmen, daraufhin fiel er zwei Wochen aus. Sein Arbeitgeber erwog, ob er Günther feuern oder sich über den gerechten Denkzettel freuen sollte. Letztendlich fiel die Strafe eher mild aus und man gönnte ihm die beiden Wochen krankfeiern als unbezahlten Urlaub. Diese Zeit brauchte Günther aber auch, um wieder zu Kräften zu kommen.
Außer diesen doch recht abwechslungsreichen Beobachtungen war das Leben auf der Labor-Raumstation langweilig und eintönig. Das Abenteuer, das er sich in seiner Kindheit immer vorgestellt hatte, konnte er hier an keiner Stelle, bei keinem Versuchsablauf erkennen. Ab und zu einmal ein Gespräch mit der Bodenstation konnte die Langeweile nicht wirklich vertreiben. Die Fernsehprogramme, die die Station empfang, schienen einen kleinen Grauschleier zu haben. Das Programm wurde mit Livestream-Aufzeichnungen den Astronauten mit einem Versatz von einem Monat zur Verfügung gestellt, das war billiger, denn eine Echtzeitübertragung konnte sich keine auf wissenschaftliche Arbeit ausgerichtete Firma leisten.
Anfangs vergingen die langen Tage mit Versuchen und Gesprächen, die mit der Zeit immer weniger wurden. Das Erlebte auf der Erde war erzählt, die Worte waren aufgebraucht. Niemand wollte immer wieder das Gleiche erzählen, so ließen sie es ganz. Schweigen war auch gut. Ab und zu wurden die monatlichen Berichte von der Bodenstation spontan unterbrochen. So versuchte man, Abwechslung zu erzwingen, indem sich irgendein Familienangehöriger kurzfristig zu Wort meldete. Es kam regelmäßig Hektik auf, da man nie wusste, wer sich ansagte. Das geschah einmal im Monat, meist am ersten Mittwoch, die jeweiligen Firmen konnten sich mehr nicht leisten. Ich glaube eher, man will uns nicht zu sehr zeigen, wie weit wir von der Erde entfernt sind, dachte Günther. Und das stimmte. Viele seiner Kollegen hatten nach den Gesprächen mit ihren Lieben mehrere Tage lang Heimweh, sie litten und konnten nicht hundertprozentig für die Laborarbeit eingesetzt werden. Neuen Kollegen machte das am meisten zu schaffen und sie versuchten oft schon nach der vierten Begegnung, diese Sprechzeiten zu umgehen.
Häufig konnten diese Termine von den Wissenschaftlern nicht wahrgenommen werden, da es die Arbeit nicht zuließ. Manchmal musste ein Versuch beobachtet werden oder genau in diesem Moment war ein Problem aufgetreten, das schleunigst beseitigt werden musste. Das spannte natürlich die auf der Erde gebliebenen Familienangehörigen mächtig auf die Folter. So manch eine Ehe kriselte, nachdem die Wissenschaftler aus dem All zurückkehrten.
Günther hatte seinen Geschwistern und Eltern untersagt, sich zu melden, nur im äußersten Notfall. Außerdem könne man ja mit der Familie mailen, das war erlaubt, so viel und so oft es die wenige Freizeit zuließ. Seine Freundin Carmen jedoch durfte, ja musste sich melden. Bei ihr machte Günther eine Ausnahme. Weil er sie liebte und weil er Angst hatte, sie zu verlieren. Er liebte auch seine Familie, aber das war etwas anderes. Eine Trennung über eine Entfernung von vierhunderttausend Metern war schon eine besondere Belastung für eine Liebe. Eine Fernbeziehung belastet, aber das traf es eigentlich nicht. Welche Fernbeziehung auf der Erde kennt diese Entfernung? Lächerlich. So hatten sie vereinbart, sich alle zwei Monate zu sehen, im Space-Treff sozusagen. Dann hatten sie zwei Stunden nur für sich.
Er liebte sie, besonders ihren Geruch, auch ihr Parfüm, aber ihren Geruch besonders. Vor allem dann, wenn sie miteinander sprachen. Er liebte die Gespräche mit ihr, die langen Spaziergänge am Rhein, abends, wenn alle Lichter funkelten und die Rheinbrücken beleuchtet wurden. Er liebte ihre Haut, sie zu streicheln, mit ihr zu schlafen. Sie hatte einen schönen durchtrainierten Körper. Sie befand sich in der Ausbildung irgendeiner militärischen Eliteeinheit, sie sprach nicht darüber. Carmen war knapp ein Jahr jünger als er. Sie arbeitete in einer Männerdomäne als sehr attraktive Frau und in einem Alter, das sich viele männliche Exemplare für einen heimischen Schoß vorstellten. Günther war eifersüchtig, klar war er das. Er ließ es sich in keinem ihrer Space-Treffen anmerken, unterließ es aber nicht, ihr in einer dezenten Bemerkung seine Eifersucht zu zeigen. Nur kurz, kaum der Rede wert, doch sie sollte spüren, dass alles nicht so einfach an ihm vorüberging. Er dachte an ihr schönes blondes Haar, ihre wunderschönen graugrünen Augen. Günther liebte diese Frau und sie liebte ihn − eine besondere Verbindung, eine besondere Liebe. Sie waren zwar zu jung, um von einer Lebensliebe zu sprechen, aber sie könnte es sein.
Obwohl diese Space-Treffen in ihm einen immer größeren Schmerz auslösten, konnte er sie nicht missen, denn der Schmerz ohne sie würde ihn zerreißen. Was sollte er tun? Er konnte sich nur zwischen dem großen Schmerz und dem ganz großen Schmerz entscheiden.
„Hi Günther, mein Schatz, ich vermisse dich. Wie läuft’s denn da oben?“
Die Sprechkabinen der Raumstation waren eine komische Einrichtung. Es gab drei davon nebeneinander, schalldicht. Man saß in einem Sessel und konnte zwischen Bildtelefon oder nur dem Ton wählen. Der Sessel war sehr bequem, mit Fußstütze. Bei der Verbindung per Bildtelefon war zu sehen, dass der Raum auf der Erde ebenso aufgebaut war. Jedoch stand dort zusätzlich in Griffnähe eine Kommode mit vier Schubladen. Günther hatte sich schon oft gefragt, was da wohl drin sein könnte. Auf der Kommode standen ein kleiner Karton mit Kosmetiktüchern und ein Raumspray mit Tannennadelduft.
„Eintönig, immer dasselbe, aber manchmal entstehen interessante Dinge bei den Versuchen. Ich kann mich dann etwas intensiver mit den Experimenten auseinandersetzen und die Langeweile verschwindet ein wenig.“
„Und wie kommst du mit den Leuten klar?“
Günther machte es sich in seinem Sessel noch etwas bequemer und hörte sich nur Carmens Stimme an. Manchmal vereinbarten sie, den Bildschirm nicht einzuschalten.
„Ja, ganz gut.“
„Du, Günther, ich werde versetzt.“
„Wohin?“
„Nach Südafrika, ein Jahr lang. Es ist eine Spezialausbildung, die man mir angeboten hat, um weiterzukommen. Wenn ich diese Ausbildung hinter mir habe, kann ich alleine Spezial-Operationen durchführen. Sie haben es mir vorgeschlagen, weil ich bisher ganz gut abgeschnitten habe.“
„Und wir, wir können uns dann ein Jahr lang nicht mehr sehen?“
„Ach Günther, was ist das denn für ein Leben. Wir sehen uns alle zwei Monate über Space, dann kann ich auch gleich auswandern.“
„Schatz, du hast ja recht, aber was wird aus uns?“
Günther schaltete den Bildschirm ein, Carmen hatte ihren schon längst eingeschaltet. Jetzt sahen sie sich an.
„Günther, ich gehe für ein Jahr nach Afrika und in einem Jahr bist du auch wieder auf der Erde, dann fangen wir von vorne an.“
Günther legte seine Hand auf den Bildschirm vor sich, sie tat es ihm auf der Erde gleich. Sofort liefen ihr kleine Tränen über die Wangen, er konnte es nicht erkennen, ahnte es nur.
Carmen schickte ihm einen Kuss und schaltete die Verbindung unvermittelt ab.
Das war solch eine Situation, vor der er die anderen immer warnte. Jetzt steckte er mitten drin, im Liebeskummer, vierhundert Kilometer über der Erde. Der Liebeskummer wich einem Heimweh, einer Sehnsucht nach Erde. Rasch zog er sich in seine Schlafkammer zurück. Er wollte nichts mehr sehen oder hören und schickte seinem Stellvertreter eine Nachricht, dass er die Leitung übernehmen solle.
Sein Stellvertreter David ahnte, was geschehen war, ein Problem mit der Freundin. Er verstand und übernahm Günthers Job.
Das Gespräch hatte angestrengt, er fühlte sich gerädert und krank. Erst weit nach Mitternacht schlief er ein.
Günther schaute auf die Uhr, Zeit war nicht mehr wichtig, Zeitabstände umso mehr. Er hatte sechs Stunden geschlafen. Ob sie schon auf dem Weg nach Afrika ist?
Es brachte nichts, darüber nachzudenken, er war hier und sie vierhundert Kilometer unter ihm.
Günther schob sich ein Fertiggericht in die Mikrowelle. Fertiggerichte wurden meist nur zu besonderen Anlässen verzehrt, sonst gab es immer nur die nahrhafte Astronautenpaste. Heute war kein Feiertag, aber doch ein besonderer Tag. Er wollte sich etwas gönnen, um sich abzulenken. Er brauchte etwas Ablenkung und die einzige und beste Ablenkung hier im All war gutes Essen. In Ruhe essen. Nach einigen Minuten saß Günther alleine am Esstisch und stocherte in seiner Pizza herum. Hunger verspürte er zwar, aber keinen Appetit.
Eine Stunde später war die mittlerweile kalte Pizza verputzt und er fühlte sich ein wenig besser. Das gute Essen tröstete.
Was soll‘s, ich kann mich nicht hängen lassen, ich darf mich nicht hängen lassen. Die Arbeit wird guttun, dachte Günther, räumte den Teller in die Spülmaschine und wischte den Tisch ab. Mit vollem Magen und voller Tatendrang stürzte sich Günther wieder in die Arbeit.
„Du kannst gehen, ich übernehme wieder.“
„Bist du sicher? Du kannst die Schicht ausfallen lassen, ich bin ja da.“
„Nein, nein, ich mach schon, ich brauche jetzt Ablenkung.“
Unschlüssig nahm David seine Jacke, drehte sich an der Tür noch einmal um, schaute Günther an, nickte kurz und verließ das Labor.
KAPITEL 2
Carmen
„Bitte schreiben Sie mit. Ich erkläre Ihnen nachfolgend an einem Beispiel den Algorithmus: 9. Schaltvorgänge, 9.1 Zustandsgleichungen. Die Zustandsgleichungen eines Netzwerkes sind ein System von gewöhnlichen Differenzialgleichungen erster Ordnung. Die Variablen in den Differenzialgleichungen (Zustandsvariablen) sind die Ströme durch die Induktivitäten und Spannungen an den Kapazitäten des Netzwerkes. Es gibt so viele Zustandsgleichungen, wie das Netzwerk unabhängige Energiespeicher (L, C) enthält. 9.1.a Algorithmus zur Ableitung der Zustandsgleichungen aus dem Netzwerk ...“
Was war das jetzt, was hat der gesagt? Oh Mann, warum habe ich bloß Elektrotechnik gewählt? Das ist so gar nicht mein Ding. Wie komme ich bloß aus dieser Nummer wieder raus?
Während der Professor weiter seinen Kreis zog, stützte Carmen sich auf dem Schreibpult ab und ließ die Worte an sich abprallen.
Carmen drückte eine Patrone in das Magazin ihrer halbautomatischen Handfeuerwaffe. Das war die offizielle Bezeichnung für dieses Teil, mit dem man nicht nur Menschen über den Haufen schießen, sondern auch Bierflaschen öffnen konnte. Dazu brauchte man nur das Magazin herauszunehmen und wie mit einem Feuerzeug über den Daumenknochen den Deckel abzuheben.
Nun ja, Carmen trank eigentlich kein Bier, aber ihre Kameraden hatten keine Lust, das Magazin herauszunehmen. Sie meinten, bei den Übungen sei sie immer die Beste und Schnellste von allen, dann könne sie auch die Flaschen öffnen. Carmen spielte manchmal das Spiel mit, wenn im Gegenzug die Kameraden gefrustet aufgaben, sie auf den Arm zu nehmen.
Rund fünfzig Rekruten befanden sich in dem Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Oerlenbach, acht von ihnen Frauen, die sich aus unterschiedlichen Beweggründen zum Polizeidienst gemeldet hatten. Carmen konnte letztendlich nicht sagen, warum, aber es war besser als Elektrotechnik, das stand fest.
Sie übten gerade, wie diese Waffe zerlegt und gereinigt wurde. Magazin herausnehmen, Patronen entnehmen, Pistole zerlegen und Einzelteile auf ein Tuch legen. Prüfer kontrollieren lassen, dann nach Anweisung alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
„Und los!“, brüllte der Ausbilder.
Mit eingeübter Geschwindigkeit setzte Carmen die Waffe wieder zusammen. Beide Hände flach auf den Tisch, die Waffe geladen und gesichert dazwischen. Erster, dachte sie. Und Erster war sie, mit 30 Sekunden und mehr schnitten ihre Kameraden erbärmlich ab.
„Blödmann“, hörte sie ihren Nachbarn ihr zuraunen.
„Und los!“
Das Zeichen, um die Waffe wieder in ihre Einzelteile zu zerlegen.
Wofür in Gottes Namen muss man diese Waffe in Sekunden wieder zusammenbauen? Wenn die mal verschmutzt ist oder klemmt und in einem Kampfeinsatz ist, dann nutzt diese Zeitschinderei nichts. Man ist tot, bevor auch nur der Schlitten abmontiert ist. Aber Ausbildung ist Ausbildung, da muss man durch.
Immer dann, wenn sie solche stupide Tätigkeit in ihrer Ausbildung ausführen musste, reisten ihre Gedanken zu Günther, zu der Zeit im Studium, als alles angefangen hatte.
Sie hatte sich in ihrem Studium etwas Geld dazuverdient, meist als Kellnerin in der Kneipe um die Ecke gejobbt. Eines Tages meldete sich eine Zeitarbeitsfirma bei ihr. Verblüfft hörte sie der Stimme am Telefon zu, da ihre Bewerbung bei dieser Firma ziemlich lange her sein musste. Um genau zu sein, rund ein Jahr, denn zwischenzeitlich studierte sie im zweiten Semester Elektrotechnik an der Fakultät für Technik in Köln oder, wie sie heute immer noch genannt wird, der Technischen Hochschule.
Diese Zeitarbeitsfirma konnte nun also einen Studenten im zweiten Semester vermitteln. Man bot ihr einen Job beim DLR in Köln-Porz an. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt sowie Energietechnik, Verkehr und Sicherheit im Bereich der angewandten und Grundlagenforschung. Nichts großes, eine teils überwachende Tätigkeit. Sie musste Messgeräte an Solarkollektoren montieren und die Messdaten protokollieren, die sich ergaben, wenn diese mit einem definierten Licht einer Tageslichtlampe beleuchtet wurden. Bei dieser Beschäftigung lernte sie Günther kennen − ein festangestellter Student. Er kannte jemanden, der jemanden aus einem anderen Bereich kannte, und so hatte er den Job bekommen. Die erste Zeit mit Günther war sehr anstrengend. Da er aus dem Maschinenbau kam, fragte er ihr Löcher in den Bauch. Irgendwann hörte die Fragerei auf und es begann eine wirklich schöne Zeit. Die stupide Arbeit strengte nicht mehr an, die Messergebnisse wichen nur selten und dann nur sehr wenig voneinander ab, immer das gleiche Bild. Sie begannen, sich intensiver zu unterhalten, erst allgemeiner Art, nach kurzer Zeit wurden die Gespräche persönlicher und sie lachten viel miteinander.
Als sie einmal an der gleichen Paneele beschäftigt waren, konnte Günther ihr Parfüm einatmen. Er kam ihr öfter verdächtig nahe, obwohl es die Arbeit nicht erforderte. Carmen bemerkte dies, was ihr nicht unangenehm war.
Von da an arbeiteten sie immer gemeinsam an einem Paneel. Carmen gefiel das. Wenn sie nebeneinander an einem Tisch arbeiteten, berührten sich wie zufällig ihre Beine, saßen sie sich gegenüber, ihre Knie, wie zufällig.
Irgendwann, auf dem Weg zur Kantine, nahm er ihre Hand, sie ließ es gewähren. Es begann eine schöne Zeit, mit Verabredungen, nächtlichen Spaziergängen am Rhein, Umarmungen und dem ersten Kuss, im Auto vor ihrer Haustür.
Eines Tages, wieder auf dem Weg zur Kantine, gaben sie sich einen Kuss und wurden von einem Typen angemacht, der ihnen noch nie aufgefallen war.
„Na, ihr Turteltäubchen, ich beobachte euch schon lange und hab mit meinen Kumpels Wetten abgeschlossen, wann ihr euch endlich zusammentut.“
Carmen und Günther ließen überrascht voneinander ab. Ein junger Mann, etwa in ihrem Alter, drängte sich zwischen sie und hakte sich bei beiden ein.
„Hab ich’s doch gesagt, die Wette ist mir.“
„Was willst du von uns, hau ab!“, gab Günther zurück.
„Na, na, wer wird denn so grob sein. Immerhin kenne ich euch schon eine ganze Weile.“
„Wir dich nicht und dabei soll’s auch bleiben!“ Carmen versuchte, sich aus seinem Griff zu winden.
„Das ist doch jetzt ein Scherz, ihr kennt mich nicht? Ich bin derjenige, der die Paneelen ins Labor transportiert hat und anschließend auf den Prüfstand baute.“
Carmen und Günther dämmerte es. Er war ihnen nie aufgefallen, aber es stimmte, er war der Paneelen-Typ.
„Hört zu, ich sehe ein, dass das Scheiße von mir war, echt, gebe ich zu. Die 150 € Gewinn war’s zwar wert, aber dafür lade ich euch in der Kantine zu einem Stück Kuchen und Kaffee ein.“ Er drängte noch eine Weile länger auf sie ein, bis sie schließlich nachgaben.
Seither trafen sie sich immer in der Kantine und aßen gemeinsam zu Mittag. Nach dem Job beim DLR trafen sie sich mittags in der Hochschule. Es entstand so etwas wie eine Freundschaft zwischen den beiden und dem Typ mit Namen Christopher Morgenstern.
Als Carmen ihr Studium dann hingeworfen hatte und zur Bundespolizei gegangen war, hatten sich Carmen und Günther nur noch selten mit Christopher getroffen und irgendwann hatten sie aufgehört. Die seltenen Treffen, die ihre Ausbildung zuließen, hatten sie nicht mit Leuten wie Christopher vergeuden wollen.
Nach einem anstrengenden Ausbildungstag freute sich Carmen auf ihre Stube und aufs Bett. Am Abend, die Rekruten wollten gerade zu Bett gehen, brüllte der Ausbilder mit sich fast überschlagender Stimme durch die Lautsprecheranlage:
„Die gesamte Mannschaft raus! Raus mit euch lahmem Pack, na wird’s bald!“
Ohne die Lautsprecher verstand man in den Stuben auch so jedes Wort, da der Ausbilder in das Mikrofon schrie, was am Anfang des Flures vor den Stuben an der Wand hing.
Carmen lag bereits im Bett. Sie hörte zwar im ersten Augenblick die Worte, träumte aber noch, wie sie während der Durchsage neben dem Ausbilder stand und grüßte. Dieser Mann brüllte mit aufgerissenen Nasenlöchern ins Mikrofon, dabei quollen ihm die Augäpfel eineinhalb Zentimeter aus dem Schädel: „Carmen, los, raus!“
Carmen schreckte hoch, benommen von dem Traum und der beginnenden Schlafphase.
Ihre Stube teilte sie mit vier weiteren Frauen in ihrem Alter. Die fünf Frauen hielten so gut es ging zusammen. So halfen sie sich gegenseitig, die Uniformen anzuziehen.
Akribisch hielten sie ihre Stube sauber, die Spinde akkurat aufgeräumt, Frauen halt. Sie fürchteten keinen Stubenappell. Die Männer sahen das anders. Ordnung wurde gemacht, wenn es sein musste. Daher wurde der Frauenstube regelmäßig eine Belobigung ausgesprochen, worauf die Männer stinksauer reagierten, da ihnen oft Sonderaufgaben zugewiesen wurden, nicht als Strafe, mehr als Erziehungsmaßnahme. Klar, dass Carmen und ihre Mitbewohnerinnen nicht gern gelitten wurden.
„Sammeln, in fünf Minuten steht die gesamte Kompanie angezogen auf dem Exerzierplatz!“
„Der Idiot, der hat doch ’nen Knall.“
„Wir sind hier bei der Bundespolizei, nicht beim Militär. Der Sammelplatz ist einfach zu eng für alle.“
„Der Idiot, ich habe keine Lust, ich schlag dem gleich seine Visage ein.“
„Ach, was soll’s, gehen wir raus, es bringt ja nichts.“
Der Lautsprecher verstummte urplötzlich. Da wussten alle, es wurde Zeit, raus auf den Exerzierplatz.
„Kameraden, Kommandant Seher hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, morgen um sechs marschbereit, wir marschieren von St. Augustin zum Truppenübungsplatz im Königsforst. Noch Fragen? Nein. Abmarsch, zehn Uhr ist Nachtruhe!“
„War das alles? Schikane, reine Schikane, das hätte der Kommandant auch durch die Lautsprecher durchgeben können.“
Aber Carmen holte tief Luft, schluckte den Ärger runter und meinte zu sich: Ich habe mir den Job selbst ausgesucht.
Doch es kam alles anders.
Um 13 Uhr am kommenden Tag stieg die gesamte Mannschaft in Bergen in der Lüneburger Heide aus einem Zug. Während der Fahrt war Zeit genug gewesen, sich darüber aufzuregen, wie dämlich dieser Ausbildungsoffizier sie „verarscht“ hatte. Sie waren nicht zum Truppenübungsplatz marschiert, sondern zum nächstgelegenen Bahnhof. Irgendwann hatte der Ausbilder gebrüllt, der Plan hätte sich geändert. In Bergen sammelte sich die Mannschaft auf dem weitverzweigten Truppenübungsplatz, der nicht weit vom Bahnhof entfernt lag. Es sickerte durch, dass der Ausbilder gestern schon mitteilen sollte, wo es hinging. Doch er meinte, es wäre doch viel schöner, auch mal verarscht zu werden.
Wieder etwas, über das man sich aufregen konnte, aber es sein lassen sollte, weil es nichts brachte.
Auf dem Truppenübungsplatz erklärte der Ausbilder die Übung und definierte die zu erfüllende Aufgabe.
Die Aufgabe bestand darin, eine oder mehrere vermisste Personen in einem unübersichtlichen Waldgelände aufzuspüren. Während der Übung stellte sich heraus, dass die Geiselnehmer ihre Opfer in einer Jagdhütte festhielten. Es führte lediglich ein schmaler Trampelpfad zur Hütte, die auf einer gut zu überblickenden Lichtung stand. Die Geiselnehmer sollten zwecks späterer Vernehmung gefangen genommen werden. Die Aufgabe schien lösbar, zumal auf der Lichtung von einer Seite flaches dichtes Buschwerk bis zur Jagdhütte reichte. Die Einheit erhielt Paintball-Waffen und jeder einen Schutzanzug, der die Uniformen vor der Farbe schützen sollte.
Zu einfach, wie sich später herausstellte, als der erste Vorstoßtrupp an einer Sprengfalle hängen blieb. Die Sprengfalle bestand aus einem mit Farbe gefüllten, unter Druck stehenden Ballon, der die Polizisten der ersten Einheit in einen Farbnebel tauchte. Später auf der Heimreise konnten sich die Kameraden das Gespött anhören. Auch Carmen hatte was abgekriegt, obwohl sie nicht dem Spähtrupp angehörte.
Ein anderer Trupp wurde aus dem Hinterhalt angegriffen und aufgerieben. Carmens Trupp kam bis zur Hütte durch, tappte jedoch in eine Falle, die den Entführern ihr Kommen signalisierte und es zu einem heftigen Schusswechsel mit ihnen kam. Dabei wurden fünf Rekruten getroffen und zwei der acht Entführer. Daraufhin stürmte der Trupp die Hütte und eliminierte die restlichen Entführer, die bis zum Schluss erbittert Widerstand leisteten.
In dem darauffolgenden Analysegespräch im naheliegenden Hauptgebäude des Truppenübungsplatzes rastete der Ausbilder förmlich aus. Die geforderte Aufgabe war in ganzer Breite gescheitert. Die Geiselnehmer hatten ihre Geisel erschossen, bevor die Einsatztruppe das Haus stürmen konnte. Siebzig Prozent der Rekruten wären getötet oder verwundet worden. Ein Reinfall in vollem Umfang.
An diesem Abend im Zeltlager neben dem Hauptgebäude dauerte die Körperreinigung länger als sonst. Die Farbe löste sich nur langsam von der Haut ab, in den Haaren blieben Reste übrig. Während der Übung hatte Carmen einen Brief vom Oberkommando aus Bremen erhalten. Da sie vor lauter Frust und Farbe auf den Brief, der bestimmt nichts Gutes bedeutete, keine Lust hatte, machte sie nach dem Duschen erst ihren Kampfanzug so sauber, dass sie ihn in die Truppenreinigung geben konnte, ohne Ärger zu bekommen.
Gegen elf setzte sie sich auf ihr Bett und öffnete den Brief.
„Aufgrund besonderer Verdienste und Ihres hervorragenden Abschneidens bei den schriftlichen und mündlichen Prüfungen sowie bei allen sportlichen Disziplinen beabsichtigen wir Sie, Carmen Schreiner, zur Spezialeinheit für Auslandsterrorfälle, einer Untergruppe der GSG9 abzukommandieren. Sie haben zwölf Stunden Bedenkzeit. Sollten Sie sich für diesen Weg entscheiden, geben Sie diesen Brief Ihrem Oberkommandanten.“
KAPITEL 3
Weltraumlabor
2061
Das Weltraumlabor entstand aus einer Weiterentwicklung der ISS, wirkte größer und stabiler.
Um 2025 hatten sich die USA, Kanada, die europäischen Staaten der ESA, der europäischen Weltraumorganisation sowie Indien, Japan und China zusammengeschlossen und in gemeinsamer Arbeit die in den 1990er-Jahren geschaffene und in der ersten Dekade 2000 weiterentwickelte Raumstation zu dem jetzigen Labor ausgebaut. Dafür gründeten die Regierungen eine unabhängige Betreibergesellschaft, die dieses Space-Labor vermarkten sollte. Im Jahr 2028 konnten die ersten Laborbauteile in den Himmel katapultiert werden. Da 2011 der Shuttle-Dienst eingestellt wurde, mussten die einzelnen Module mit Ariane-Raketen transportiert werden. Die Ariane 15 konnte zwölf Tonnen zuladen. Die Raketen wurden in den letzten dreißig Jahren nicht mehr vergrößert, vielmehr versuchte man, die Startenergie zu optimieren. Neue Treibstoffe mussten entwickelt werden, doch als günstigster Krafstoff blieb letztendlich der Wasserstoff. Es dauerte ganze fünf Jahre, bis Mitte 2033 das Space-Labor fertiggestellt war. Das Labor wurde für insgesamt dreißig Personen ausgelegt. Die Stammbesatzung bestand aus sechs Astronauten, die ebenfalls mit wissenschaftlichen Untersuchungen beschäftigt wurden. Die Astronauten blieben ein oder eineinhalb Jahre an Bord, um dann auf der Erde ein Reha-Programm zu durchlaufen. Das war notwendig, denn trotz des ausgeklügelten Sportplanes litt die Muskelmasse der Astronauten erheblich. Dieses Verfahren wurde eingeführt, nachdem das Space-Labor für den kommerziellen Betrieb freigegeben wurde, oder besser: Nur so konnte die kommerzielle Raumfahrt erst begonnen werden. Damit brachte die kommerzielle Raumfahrt auch etwas Gutes für die Astronauten. Die Reha machte die Gäste wieder fit fürs Leben auf der Erde und die Astronauten für den nächsten Einsatz.
Der Shuttle-Dienst, wie ihn um die Jahrtausendwende die Columbia und Co. verrichtete, wurde auf der Basis eines neu entwickelten Space-Gleiters wieder ins Leben gerufen. Lange Jahre arbeiteten die Nationen an einem Raumgleiter, der normal starten und landen konnte. Pünktlich zum Start der kommerziellen Raumfahrt im Jahr 2032 war es dann so weit: Es gab einen Prototyp, der in einer ersten Testphase vielversprechend erschien. Anfang 2034 ging auch hier ein serienreifer Gleiter an den Start. Mit diesem Gleiter wäre der Bau der Station sicherlich von fünf auf drei Jahre verkürzt worden.
Das Space-Labor setzte sich aus einzelnen Modulen zusammen, Zwischengänge in Form von Röhren verbanden diese miteinander. Die einzelnen Module konstruierte man so, dass jeder Zentimeter in einer Ariane-Rakete genutzt wurde.
Die Raumfahrt kostete immense Summen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Raumfahrtbranche neue Geldquellen ausfindig machen musste. Was lag da näher, als die staatliche Abhängigkeit zu reduzieren und weite Teile dieser Branche zu privatisieren. Mit der Privatisierung kamen andere Geldgeber, solche, die schon immer mal ins All wollten und sich das leisten konnten. Um diesen zahlenden Gästen den Aufenthalt im All zu verschönern, ließ man sich einiges einfallen. Damit war nach und nach die herkömmliche Robustheit der Geräte und Ausstattung verschwunden und Teile des Versorgungstraktes des Space-Labors waren entsprechend großzügig konstruiert worden.
Die Energieversorgung und die komplette Schalt- und Leittechnik umfasste vier Stockwerke, jedes einzelne fünf Meter hoch, vierzig Meter lang und fünfundzwanzig Meter breit. Direkt angrenzend befand sich der Wohn- und Schlafbereich, nur getrennt durch ein sechs Meter breites Treppenhaus mit einer Stahlkonstruktionstreppe und einem Schnellaufzug für maximal zwei Personen. Dieser Trakt unterteilte sich in sechs Stockwerke von je drei Metern Höhe und ebenfalls einer Länge von vierzig Metern. Die Zugangsröhren endeten in Flurbereichen, von denen aus Lastenaufzüge durch den jeweiligen Trakt führten.
In der untersten Ebene des Wohntraktes befand sich der Aufenthaltsbereich mit einer Gemeinschaftsküche und den angrenzenden Sprechkabinen für private Gespräche zur Erde sowie einem kleinen Kino für fünfzehn Zuschauer. Weiterhin befanden sich auf dieser Ebene der Sportbereich und ein Spa-Bereich mit einem Whirlpool und einer Sauna. In den obersten Stockwerken konnte der VIP-Gast in einfachen Appartements oder Suiten mit mehreren Zimmern und separater Küche den Aufenthalt im All genießen. Auf dieser Ebene war auch eine Krankenstation eingerichtet worden, in der Astronauten mit Sanitäter-Ausbildung leichte Verletzungen und langwierige Erkältungen in einer Art Quarantäne behandelten. Selbst für kleine chirurgische Eingriffe stand ein Operationssaal mit einer kleinen angrenzenden Intensivstation zur Verfügung. Ein autark arbeitendes Reinluftsystem hielt diese Räume ständig in Bereitschaft. Der diensthabende Sanitäter musste im Abstand von vier Wochen in einem Reinraumanzug die Funktion der Geräte prüfen. Sollte der relativ unwahrscheinliche Fall eintreten und es könnte jemand nicht mehr zur Erde transportiert werden, müsste ein OP-Team zur Station gebracht werden.
Günther machte gerade Mittagspause und musste in fünf Minuten seine Arbeit wieder aufnehmen. Er befand sich im Essbereich und nahm die letzten Bissen seines Fertig-Gerichtes zu sich.
Mittags aß er gern alleine. Da sich die Gespräche sowieso immer wiederholten und niemand mehr so richtig Lust auf Konversation hatte, versuchten einige der wissenschaftlichen Mitarbeiter, ihre Mittagspause so zu legen, dass sie niemanden antrafen. So auch Günther. Bei dieser Gelegenheit schaute er durch das Bullauge auf die Erde und stellte sich Carmen vor, wie sie gerade in Südafrika irgendwelche Heldentaten vollbrachte.
Er stellte sein Geschirr in eine Öffnung in der Wand. Sofort verschwanden Teller, Messer und Gabel im Inneren einer Maschine. Das war der Vorteil von Fertig-Gerichten, es musste in der Küche nicht viel gereinigt werden.
Um die Hygiene auf der Station aufrechtzuerhalten, musste jeder Anwesende nach einem strengen Reinigungsplan Küche und Wohnbereich sauber halten. Für die eigenen Wohnräume war jeder selbst verantwortlich. Auf Sauberkeit wurde penibel geachtet, eine Erkrankung aufgrund mangelnder Hygiene konnte sich niemand leisten.
Zu seiner derzeitigen Arbeitsstelle im Labor musste Günther ungefähr vierhundertfünfzig Meter gehen. Dabei durchquerte er zwei Treppenhäuser.
In dem größten Treppenhaus, das den Trakt der Energieversorgung und den des Wohnbereiches voneinander trennte, befand sich über sechs Stockwerke eine Treppe aus einer Stahlkonstruktion. Stufen und Podeste bestanden aus einem Gitterrost, das mit zunehmender Höhe größere Öffnungen zu bekommen schien. Regelmäßig machte Günther drei Etagen lang die Augen zu und zog sich nur entlang des Treppengeländers. Einmal kamen im drei Kollegen entgegen. Da sie alle Filzschuhe trugen, hörten sie sich jedoch nicht. Per Zufall öffnete Günther seine Augen und sah, dass die Kollegen ebenfalls ihre Augen geschlossen hatten. Er musste lachen und verschluckte sich dabei. Die Kollegen fuhren zusammen und hielten sich nach einer Schrecksekunde den Bauch vor Lachen. Eine kleine Abwechslung, denn sonst hielt sich eine gedämpfte Langeweile unter den Kollegen und Astronauten.
Auf seinem Weg zum Labor musste Günther einige Schleusen und Verbindungstüren passieren. Dabei musste er regelmäßig schmunzeln, hier im Space-Labor öffneten sich die Türen wie im Raumschiff Enterprise. Diese Serie stammte aus dem zwanzigsten Jahrhundert und lief anscheinend in einer Endlosschleife, ab und zu aber auch in einer schlecht gemachten Neuauflage. Er hielt seine Hand jeweils vor eine kleine milchige Glasscheibe an der Wand, daraufhin öffnete sich daneben eine Tür, indem eine Metallplatte mit einem leisen Zischen zur Seite schwebte.
DieVerbindungsgängezudenLabormodulenbestandenausRöhren mit einem etwa drei Meter breiten und hohen Durchgang. Die seitlichen Wände nahmen die Form der Röhre an, der Fußboden und die Decke grenzten die darüber und darunter liegenden Versorgungsleitungen ab. Alle zehn Meter erkannte man an den Zeichen an den Wänden, an der Decke und am Boden, dass dort Revisionsklappen vorhanden waren. Die Zeichen zeigten auf die Öffnungen und warnten vor einem Druckabfall in der Durchgangsröhre. „Bedienung nur von autorisierten Mitarbeitern dieser Laboreinheit“, stand in roter Schrift auf einem grün umrandeten Schild. An verschiedenen Stellen warnten Schilder davor, dass diese Klappen aufschlagen könnten und man sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten solle. In die Decke eingelassene Glasstreifen beleuchteten die Gänge mit einem milchigen Licht. Bei einem Stromausfall leuchteten kleine rote Streifen auf dem Boden, um den Fluchtweg zu markieren. Die durchgängige Beleuchtung in den Glasstreifen wurde dann durch punktuelle Lichtkegel im Abstand von etwa drei Metern ersetzt.
Vom Treppenhaus konnte man auf der Höhe der zweiten Ebene des Energieversorgungstraktes in den etwa dreißig Meter langen Verbindungsgang einsteigen.
Günther begegnete niemandem. Es war kurz vor Schichtwechsel, also arbeiteten alle noch. Mit dem ersten Schritt in diese Verbindungsröhre spürte er die Schwerelosigkeit wieder und erinnerte sich daran, dass auch um ihn herum Schwerelosigkeit herrschte. Der Versorgungstrakt mit dem Wohn- und Schlaftrakt verfügte über eine Gravitationsmaschine. Diese Erfindung aus dem Jahr 2028 hatte den Bau von Raumstationen und des Space-Labors revolutioniert. Nachdem die Konstrukteure anfänglich von einer Röhrenform der Station ausgegangen waren, war 2028 der untere Teil der Röhre abgeschnitten und ein weiteres Technikgeschoss angebunden worden. Mit dem Aufbau der VIP-Bereiche und der Krankenstation entwickelte sich eine elliptische Form. In dieser untersten Ebene befanden sich mehrere solcher Gravitationsmaschinen.
Eine Gravitationsmaschine bestand, einfach umschrieben, aus zwei übereinander angeordneten Schwungrädern, die aufgrund ihrer gegenläufigen Drehbewegung ein stabiles Gravitationsfeld erzeugten. An sich nichts Weltbewegendes, aber das Material machte es aus. Im Jahr 2028 hatten verschiedene Wissenschaftler unabhängig voneinander eine Legierung entdeckt, die das zehnfache Gewicht der Summe der Einzelkomponenten annahm. Das bedeutete, dass die Masse auf der Erde einer erheblich größeren Wirkung der Anziehungskraft ausgesetzt war als jeder andere Körper auf der Erde. Messungen belegten, dass in direkter Nähe dieser Legierung eine sogenannte Gravitationssenke entstand. Somit hatte das Material kein größeres Gewicht als die Summe der Einzelkomponenten, vielmehr gab es kein Messgerät, das dieses Gewicht erfassen konnte. Als ein findiger Wissenschaftler auf die Idee kam, aus diesem Material ein Rad zu bauen und dieses dann drehte, erkannte er, dass sich die Gravitation in der Nähe des Rades nahezu aufhob und so das Gewicht der Legierung als Teil dieses Schwungrades ermittelt werden konnte.
Die Gravitationsmaschine war geboren, dann ging alles sehr schnell und nun drehte sich dieses Schwungrad unter dem Space-Labor.
Zur gleichmäßigen Verteilung der Gravitationskraft wurden unter dem Wohntrakt mehrere Gravitationsmaschinen angebracht. Ebenfalls unter den Labortrakten, die jedoch für die Versuche ausgeschaltet wurden.
Jedes der drei übereinander angeordneten Labormodule war zweimal so groß wie der Versorgungs- und Wohntrakt zusammen. Hier konnten sich Firmen einmieten und ihre Experimente durchführen. Derzeit waren etwa zwei Drittel der Labormodule vermietet.
Da für die Unternehmen das Personal im All einen immensen Kostenanteil bedeutete, wurden die Versuchsanlagen bereits auf der Erde optimiert und programmiert, sodass sie weitgehend alleine abliefen. Die Überwachung der Versuche erfolgte von der Erde aus. Die Wissenschaftler prüften diese Selbstläufer lediglich, ob sie sich selbst abschalteten, und starteten diese dann neu. Nur etwa zehn Prozent der Versuche mussten durch die Wissenschaftsastronauten begleitet oder durchgeführt werden.
Derzeit begleitete Günther eine Versuchseinheit, die Materialien erforschte, von denen man sich erhoffte, dass sie supraleitend sein könnten.
In seinem Labormodul angekommen, war sein Kollege David bereits fertig umgezogen, um Feierabend zu machen.
„Hi Günther, wieder alles klar?“
„Ja, geht schon. Wie weit bist du?“
„Ich habe die Schmelze auf 1.300 °C erhitzt und das Silizium, das Yttrium und das Barium hineingegeben. Was jetzt noch fehlt, ist das Eisen, das müssen wir mit dem Beschleuniger in die Masse schießen. Das kannst du ja jetzt vorbereiten. Wir haben den Versuch jetzt schon hundertmal gemacht. Wir sollten die Zusammensetzung noch einmal prüfen und verändern. Irgendwie scheint da noch was zu fehlen.“
Günther orientierte sich in dem Labor und räumte erst einmal auf. David war ein sehr guter Versuchsingenieur, sehr innovativ, aber er hatte keinen Sinn für Ordnung. Er beobachtete die Bildschirme, die die Temperatur der Schmelze anzeigte. 1.300 °C, eine Temperatur, die für das Universum kalt ist, allein die Sonne hat eine Temperatur von 15.000.000 °C in ihrem Inneren. Was waren dagegen schon diese lächerlichen 1.300 °C. Die Schmelze dampfte leicht. Der Beschleuniger bestand aus einer etwa vier Meter langen Spule, die alle fünf Zentimeter entgegengesetzt gewickelt wurde. Schob man einen leicht magnetischen Eisenkern in die Spule, schwebte dieser in der Mitte der Röhre. Um den Eisenkern zu beschleunigen, musste er nur kurz angetippt werden. Durch die Spulen wurde das Eisenstück derart beschleunigt, dass er auf vier Metern die Geschwindigkeit einer Gewehrkugel erreichte.
Mit dieser Geschwindigkeit traf der Eisenkern in die Schmelze und verdampfte unmittelbar nach dem Eintauchen. So entstand eine homogene Masse, deren kristalliner Aufbau zu hundert Prozent homogen war. Diese Versuche konnten bisher nie unter Schwerelosigkeit durchgeführt werden, sodass man sich nun neue Erkenntnisse erhoffte. Das entstandene Material war bei minus 196 °C supraleitend. Durch diese Versuche erhoffte man sich weitere Erkenntnisse hin zur Supraleitung bei Umgebungstemperatur.
KAPITEL 4
Christopher Morgenstern
Christopher verspürte oft den Drang, mit seinen Mitmenschen zu spielen, ihnen das Gefühl der Gleichwertigkeit zu geben, um sie dann nach ein paar Tagen fallen zu lassen und sich eine andere Zerstreuung zu suchen. Die beiden Turteltauben Carmen und Günther waren ihm gerade recht gekommen. Außerdem hatte er sich über Günther geärgert, der geschafft hatte, was er nicht hinbekam. Carmen wollte nichts von ihm wissen.
Während der Zeit beim DLR aßen sie oft gemeinsam zu Mittag, später trafen sie sich in der Mensa der Hochschule. Christopher gefiel nach einiger Zeit Günthers ehrliche Art, ein wenig naiv zwar, aber ehrlich. Carmen merkte er an, dass sie ihn nicht leiden konnte, aber da Günther mit Christopher wider Erwarten gut auskam, hielt sie sich zurück.
Irgendwann im dritten Semester luden ihn Carmen und Günther zum Essen ein. Sie fühlte sich nicht wohl dabei, aber sie tat es Günther zu Gefallen. Nach einem üblich lockeren Gespräch lenkte Carmen das Thema auf sich:
„Christopher, ich muss dir was sagen und glaub mir, es ist mir nicht leicht gefallen.“ Wenn er nicht genau wüsste, dass sie mit Günther zusammen war, würde er jetzt auf Gedanken kommen, die ihm gefielen. „Ich hab’s mit Günther besprochen und er unterstützt mich in meiner Entscheidung. Ich schmeiß’ das Studium hin.“
Dieses Geständnis kam für Christopher nicht überraschend, er hatte ihr von Anfang an keine Chancen eingeräumt, so heuchelte er:
„Das tut mir leid, Carmen, ehrlich. Du weißt, der Elektrotechnik gehört die Zukunft. Steht dein Entschluss wirklich fest? Ich kann dir doch helfen, wir können zusammen üben.“
Christopher war klar, dass sie das Angebot nie im Leben annehmen würde, es hörte sich aber gut an. Nach einigen weiteren Heucheleien wollte Christopher wissen, wie Carmen sich ihre Zukunft vorstellte, bestimmt als Hausfrau und Mutter von Günthers Kindern. Wie langweilig, dachte er nur.
„Ich hab vor, zur Polizei zu gehen.“
Christopher verschluckte sich und bekam kaum noch Luft. Erst als er von der Toilette zurückkehrte, konnte er wieder einigermaßen reden.
„Zur Polizei? Du?“
„Genauer gesagt, zur Bundespolizei.“
„Bundespolizei, ha, und als was, als Mutter der Kompanie?“ Ihm lag Nutte auf der Zunge, konnte aber gerade noch in Mutter umschwenken.
„Nein, ich mache die Grundausbildung in Oerlenbach. Das ist eine Bundespolizeischule. Ich will dann später Mitglied einer Spezialeinheit zur Drogenbekämpfung oder so werden.“
„Ich glaub es nicht, Bundespolizei, du und Bundespolizei. Du weißt aber, dass die alle unterbezahlt sind?“
„Es geht nicht immer um Bezahlung, manchmal braucht man auch mal eine gehörige Portion Idealismus.“
Carmen ärgerte sich, Christopher ihre Entscheidung mitgeteilt zu haben. Sie wusste, er machte sich nichts daraus und nahm sie sowieso nicht für voll. Sie drängte Günther, zu gehen, und verabschiedeten sich bald darauf mit den üblichen Floskeln. Christopher hatte bereits so viel getrunken, dass es ihm egal war, mit wem er den Abend verbrachte. Für ihn endete der Abend wie immer mit viel Gelächter und seinem obligatorischen Absacker im Szenelokal „Zopf“.
Christopher brachte sein Studium mit guten durchschnittlichen Noten zu Ende und bekam im Herbst 2057 eine Stelle bei einem Hersteller für Steuerungen von Großmaschinen. Sein erster Einsatz führte ihn in den Tagebau Hambach nahe Köln. Hier würde noch die nächsten sechzig Jahre Kohle abgebaut, hatte man ihm gesagt. In der Energiezentrale eines der kleineren Bagger war ein Fehler in der Steuerung aufgetreten, den bisher niemand finden konnte. Es mussten alle Stromlaufpläne kontrolliert werden und alle SPS-Regelanlagen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe.
Drei junge Ingenieure versuchten ihr Glück und prüften jeden erdenklichen Plan. Sie konnten jedoch nichts Unnormales finden, dann hatte Christopher eine Idee. Er kontrollierte die Leitungswiderstände der Hauptzuleitungen zu jeder Unterregeleinheit und den des Versorgungskabels. Er stellte fest, dass die Zuleitungen zu den Unterregeleinheiten zwar zu achtzig Prozent ausgereizt waren, aber die Hauptzuleitung war definitiv zu klein dimensioniert. Daher kam es zu Spannungsschwankungen und diesem Fehler in der Regelung des Baggers.
Dies wollte der Tagebaubetreiber nicht hören und zwang die Firma, bei der Christopher angestellt war, ihn zu feuern. Niemand konnte diese Reaktion verstehen, doch um die Firma nicht zu gefährden, ging sein Chef auf die Forderung ein.
Christopher erhielt eine Abfindung von fünf Monatsgehältern und stand auf der Straße.
Zwei Wochen später erhielt Christopher einen Anruf aus der Zentrale von RWE Power. Man bot ihm eine Anstellung an, man hätte von dem Vorfall bei einem Vorlieferanten gehört und wolle der Firma, bei der er gearbeitet hatte, einen Gefallen tun. Letztendlich bekam Christopher einen Job bei einem Tochterunternehmen von RWE Power, einem Planungsbüro für Facility Management. Dort wurden unter anderem Planungen für RWE Power durchgeführt. Christopher war überzeugt davon, dass er etwas herausgefunden hatte, das einem der Vorstände nicht gefiel, deshalb musste er gehen. Dann war dem Vorstand klargeworden, dass er einen Fehler gemacht hatte, und man versuchte, ihn wiedergutzumachen. Warum er aber bei seiner ersten Firma gekündigt wurde, bekam er nie heraus.
Nach drei Monaten, die Probezeit lief noch, schickte ihn sein Unternehmen in die Sahara. Dort sollte das größte Solarkraftwerk der Erdeentstehen.ChristopherplanteundentwickeltedieEnergiesteuerung zur Fortleitung des erzeugten Stroms.
Im Oktober 2059 wurde er aus der Sahara abberufen und musste ohne Zwischenstopp in Deutschland nach China. In China hatte der Umdenkprozess im Jahr 2014 begonnen, die Luft sollte sauberer werden. 2059 wurde die Umrüstung der letzten fünfzig Kohlekraftwerke in Angriff genommen.
Im Juli 2061 war auch in China nichts mehr zu tun, die Chinesen konnten sich jetzt selbst weiterhelfen und Christopher wurde nach Kurdistan an die irakische Grenze geschickt. Dort überwachte er die Teilsanierung und den Bau eines Gaskraftwerks.
In Baidschi befand sich neben der größten irakischen Ölraffinerie auch ein strategisch bedeutendes Gaskraftwerk, von dem aus die 200 Kilometer südlich liegende Stadt Bagdad mit Strom versorgt wurde.
Christopher lernte in dieser Zeit nicht nur die Landessprache, sondern auch, wie man sich durchsetzt. Verschiedene kriminelle Vereinigungen unter der Leitung von korrupten Stammesfürsten versuchten, den Bau der weiteren Kraftwerke zu sabotieren. Christopher verhandelte mit den Stammesführern, die sichtlich beeindruckt von dem weißen Mann waren. So konnte der Bau mit einer landestypischen Verspätung von eineinhalb Jahren endlich abgeschlossen werden.
Nach drei langen Jahren konnte Christopher wieder nach Deutschland zurückkehren. Er hatte genug von Auslandsreisen und kündigte zwei Wochen später.
Wieder kam ihm der Zufall zu Hilfe. In einer überregionalen Tageszeitung suchte ein Unternehmen aus der Windenergiebranche einen Geschäftsführer.
Im August 2061 wurde er bei WEnvion, einem deutschen Windenergieanlagenhersteller, als Geschäftsführer eingestellt.
KAPITEL 5
Schlechte Nachrichten
2062
Der abgedunkelte Raum wurde nur von den flimmerfreien Bildschirmen erhellt. Sie wirkten, im Halbkreis angeordnet, wie Fenster nach außen ins Weltall. Die Illusion wäre perfekt, würden nicht auf den unteren Bildschirmen hunderte von Messergebnissen dargestellt. Die Ergebnisse konnten bei Bedarf über die gesamte Bildschirmwand verteilt werden. Abwechselnd führten die Besatzungsmitglieder Kontrollgänge durch.
Günther meldete sich freiwillig zu solchen Kontrollen, zum einen, um die Zeit abwechslungsreicher zu gestalten, zum anderen konnten die Astronauten der Stammbesatzung auch einmal länger ausspannen. Die Astronauten arbeiteten in Zwölf-Stunden-Schichten, der Kontrollgang wurde zu Beginn der Schicht durchgeführt. Günther übernahm seinen Kontrollgang nach einem ausgeklügelten Plan, sodass sich die Astronauten reihum etwas länger ausruhen konnten. So lernte Günther immer mehr von der Technik dieser Station kennen. Wenn er bei seinen Kontrollgängen den Kontrollraum betrat, machte es ihn immer ein wenig demütig, denn das Leben aller Insassen war abhängig von diesem Kontrollzentrum, hier musste alles reibungsfrei funktionieren.
Die Astronauten wiesen ihn an, worauf er bei dem Rundgang achten müsse, doch ihn interessierte weniger die Funktion der einzelnen Maschinen, wie das Gravitationssystem, vielmehr schaute er auf Sauerstoffgehalt, Luftfeuchte, Wasser- und Abwassersysteme − das waren die eigentlichen lebenswichtigen Funktionen. Bevor er den Kontrollraum wieder verließ, setzte er sich in einen der beiden Cockpit-Sessel und schaltete die Panoramakameras ein. Sofort erschien eine Außenaufnahme, die sich über die gesamte Bildschirmwand erstreckte. Günther liebte diesen Anblick. Mit einem Joystick konnte er das Panoramabild um die Station herumlaufen lassen. Dabei schaltete das System nacheinander die Außenkameras zu und ab, ohne dass ein Übergang erkennbar war.
Günther passte seinen Kontrollgang durch die Versorgungsstation und den Kontrollraum immer so ab, dass er diesen Anblick eine kurze Zeit genießen konnte, bis der obligatorische Kontrollanruf aus Köln kam.
Die Schichten der Wissenschaftler dauerten zehn Stunden, wobei sie die Pausen untereinander abstimmten. Man hatte eine Stunde Pause und konnte diese über die Zehn-Stunden-Schicht verteilen. Die Schichten begannen jeweils morgens um acht Uhr Erdenzeit. Somit konnte Günther in seiner Freischicht morgens den Rundgang machen und den Kontrollanruf abwarten.
Pünktlich um acht Uhr zwanzig leuchtete die Kontrollleuchte der Kommunikationseinheit und kündigte ein Signal von der Erde an, das drei Sekunden benötigte, um sich vollständig aufzubauen. Diese Zeit nutzte Günther, um das Panoramabild abzuschalten. Direkt vor ihm schaltete sich ein Bildschirm ein und zeigte eine Frequenzlinie einer Stimme, die jetzt auch im Lautsprecher zu hören war.
„Hallo Günther, hallo Günther, bitte melden. Hast du heute den Rundgang gemacht?“
„Ja, hallo Karl, hab ich. Hast du heute Dienst?“
„Ja, meine Frau ist schwanger und sie nervt, hat mich rausgeworfen. Sie hat ab und zu Wehen und wirft mir nun vor, ich wäre schuld, dass sie diese Schmerzen hat.“
„Oh, das ist aber doof.“
„Nein, nein, ich hab ja ein Handy und ihr gesagt, sie könne mich jederzeit erreichen, ich komme dann sofort. Ich hab das hier abgeklärt, die sind damit einverstanden. Ist schon ein toller Arbeitgeber, diese Raumfahrtbehörde.“
„Gut, dann kann ja nichts schiefgehen.“
„Nee, eigentlich nicht, aber jetzt zu dir. Habe gehört, dir ging’s nicht gut? Wieder besser?“
„Ja, wieder besser.“
„Okay, gut, dann zum Protokoll. Wie sieht es aus?“
„Also, hier der Bericht der letzten vierundzwanzig Stunden ...“
Diese Kontrollanrufe verliefen seit Jahren gleich, so war eine kleine persönliche Note immer ein willkommener Anlass, um die menschliche Verbindung zur Erde auch in dieser stupiden Arbeitswelt aufrechtzuerhalten.
„Okay, Günther, Download läuft. Dann alles Gute, bis morgen um dieselbe Zeit?“
„Ja, morgen mach ich wieder den Kontrollgang und den Rest der Woche nicht mehr. Bis morgen, Karl, und alles Gute für deine Frau und dich und das Kind.“
„Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Danke, grüß deine Kollegen.“
Das tat er natürlich nicht, anfangs hatte er es gemacht und nach drei Wochen waren alle genervt gewesen. So ließ er die Floskel im Raum stehen.
Seit mehr als fünfzig Jahren war der Dreh- und Angelpunkt der Luft- und Raumfahrttechnik in Köln, genauer in Porz, neben dem Köln-Bonn-Flughafen. So hatte sich die deutsche Sprache nach und nach in der Raumfahrt durchgesetzt. Heute sprach kaum noch jemand Englisch im Orbit. Mit dem Einzug der deutschen Sprache im Weltall wurde die kommerzielle Raumfahrt in Europa und speziell in Deutschland zur Goldgrube. Viele Firmen bauten rund um Köln und in Nordrhein-Westfalen ihre Niederlassungen, jede Firma in der Welt, die was auf sich hielt, kam nach Köln.
Das war damals auch Günthers Chance. Er bewarb sich bei einer dieser Firmen und nach drei Monaten schickte man ihn auf seine erste Weltraum-Mission. Nach einem Jahr nannte er sich Weltraum-Versuchsingenieur für Materialkunde. Allmählich hatte er sich zum alten Hasen entwickelt und seine fünfzehnte Mission hatte angestanden.
Doch diese Mission unterschied sich von allen anderen, er sollte eineinhalb Jahre oben bleiben. Das war hart, sehr hart, aber es brachte viel Geld. Günther wollte sich mit fünfzig zur Ruhe setzen und dieser gut bezahlte Job konnte gute Dienste dazu leisten.
„... und jetzt müssen wir den Metallkern wieder beschleunigen und in die Schmelze jagen.“
Immer den gleichen Versuch mit einer Schmelze, die immer ein klein wenig anders zusammengesetzt ist, der Beschuss und dann Daten sammeln, aufbereiten und sichern.
Die Arbeit war anspruchsvoll, aber nach dem zweihundertsten Versuch stupide. Er gähnte und ließ sich in einen Tagtraum fallen.
Wo sie jetzt sein mag, in Südafrika? Südafrika ist so weit weg. Na ja, dieses Space-Labor ist weit weg.
Ihr letzter gemeinsamer Urlaub hatte sie an den Atlantik geführt, zur französischen Atlantikküste. Sie liebten beide das Meer, den Ozean, die Wellen, das Wetter. Vor Jahren besuchten sie gemeinsam eine Surf-Schule und waren mehrere Jahre hintereinander an den Atlantik gefahren.
Biarritz, da wollten sie immer hin, viele berichteten von den schönsten Wellen der französischen Atlantikküste. Stundenlang lagen sie in ihren Neoprenanzügen auf ihren Brettern und warteten und surften und warteten und surften. Sicherlich, es war anstrengend, aber das Wasser, die Sonne, die Luft, alles dies führte trotz der Anstrengungen unweigerlich zur Erholung. Bei ihrem letzten Urlaub versprachen sie sich gegenseitig, sich niemals zu trennen, immer zusammenzubleiben, immer und ewig. Sie kauften sich als Symbol ihrer Liebe zwei Ringe und steckten sich diese gegenseitig auf die Ringfinger. Am nächsten Tag fuhren sie mit ihren Surfbrettern aufs Meer hinaus und küssten sich. Sie setzten sich gemeinsam auf ein Brett und rückten immer näher zusammen, sie küssten sich, fühlten sich und zogen ihre Neoprenanzüge aus, was zu zweit auf einem Brett auf hoher See nicht einfach war. Sie saßen sich eng gegenüber, da zog sich Carmen an ihm ein wenig hoch und ließ ihn in sich hineingleiten. Die leichten Wellenbewegungen stimulierten sie zusätzlich, ohne sich anzustrengen. Nach einer Viertelstunde und zwei Orgasmen legten sie sich aufs Brett und ließen sich durch die Zeit treiben.
Carmen hatte den Ring von ihrem und Günthers Finger gezogen und gemeint, um ihre ewige Verbundenheit zu besiegeln, wolle sie die Ringe ins Meer werfen. Sollte einer von ihnen irgendwann einmal den anderen verlassen wollen, dann möge das Meer ihre Liebe rächen. Günther hatte ihre verspielten Gedanken belächelt und ihr sein Wort gegeben.
Er schüttelte sich, ihm lief ein kalter Schauer über den Rücken, vor seinen Augen erschien wieder die Versuchsstrecke. Labor, Orbit, tausende Kilometer entfernt. Einmal tief durchatmen.
14.02.2062
Günther verbrachte seine Mittagspause heute wieder einmal im Kontrollraum. Seine Anwesenheit war bei den Versuchen nicht notwendig, alles lief im Automatikbetrieb und die Erdstation übernahm die Kontrolle. So störte er niemanden und ihm gefiel es, über die Bildschirmwand ins All zu schauen.
Als er sich dem Monitor rechts von ihm nochmals zuwandte, schrillte ein Alarmsignal aus dem Lautsprecher.
„Wer ist da, wer hatgerade Dienst?“, krächzte es von der Bodenstation.
„Ich, Günther, Günther Flossdorf.“
„Gut, Günther, hier ist Karl. Hör zu, wir haben nicht viel Zeit, es gibt ein Problem.“
„Welches Problem?“
„Schalte auf den Kontrollraummonitor, da ist die Verbindung besser.“
Günther schaute verwundert auf die Uhr über den Bildschirmen: 14:20 Uhr. Nicht die Zeit für einen Kontrollanruf, wahrscheinlich war irgendetwas nicht in Ordnung. Er schaltete den Anruf auf einen Monitor.
„Hier unten hat irgendein Idiot einen Rechenfehler gemacht und eure Umlaufbahn falsch berechnet.“
„Ja und?“
„Jetzt wissen wir nicht, auf welcher Umlaufbahn ihr euch genau befindet, wir rechnen noch.“
„Ja und, was soll ich mit dieser Information?“
„Na ja, wenn wir nicht wissen, wo ihr seid, wissen wir auch nicht, ob andere Satelliten in eurer Nähe sind.“
„Was willst du damit sagen?“
„Ich will damit sagen, dass ihr ab und zu auf eure Bildschirme schauen sollt, ob ein Echo zu sehen ist. Die hier unten sagen, es wäre besser, ihr wüsstet von nichts, das würde euch nur unnötig nervös machen. Ich finde aber, ihr solltet Ausschau halten.“
„Karl, du klingst nervös, sagst mir, ich solle Ausschau halten. Das kann ich gern tun, aber wonach und wie lange und wieso? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man unsere Umlaufbahn nicht kennt. Ich glaube, Karl, du verschweigst mir was.“
Karl druckste herum.
„Die wollen nichts sagen und alles einfach laufen lassen.“
„Karl, was?“
„Das mit eurer Umlaufbahn, das wollen die laufen lassen, einfach so.“
„Jetzt bin ich es aber satt, du sprichst in Rätseln und langsam beginne ich, mir Sorgen um dich zu machen. Karl, ist dir was passiert? Ist mit dem Kind was passiert?“
„Nein, alles gut, alles klar, dem Kind geht es hervorragend, der Mutter auch.“
„Ja, was ist denn dann los? Ich verstehe dich nicht, das hört sich jetzt an, als wären wir in Gefahr.“
„Nun ja, nicht ganz.“
„Was? Nicht ganz? Jetzt werd’ ich gleich verrückt!“ Günther schrie in das Mikrofon und setzte sich. „So, Karl, ich sitze, jetzt raus mit der Sprache.“
„Verdammt, scheiße, sie haben beschlossen, euch nichts zu sagen, und was ich hier mache, kann mich den Job kosten. Ich hab selbst die Bandaufzeichnung abgeschaltet.“
An Karls Stimme merkte Günther, dass er mächtig durch den Wind war und gleich mit der Sprache rauskam, er musste nur noch einen Augenblick warten.
„Ich sollte es nicht sagen, es steht ja auch noch gar nicht fest.“
„Karl – was?“
„Ja gut, also das mit der Umlaufbahn, die falsch berechnet wurde, das stimmt, aber – es ist nicht eure Umlaufbahn. Von euch wissen wir hundert Prozent, wo ihr seid.“
„Konnte ich mir auch nicht anders vorstellen.“
„Nur, was wir nicht genau wissen, ist die Umlaufbahn von so einem Schrottteil.“
„Schrottteil? Du meinst Weltraumschrott?“
„Ja. Und das Schlimmste ist, wir kennen nicht nur die Umlaufbahn, wir wissen auch nicht, wie groß es ist.“
„Na klasse.“
„Wir haben aber Glück.“
„Glück, hast du sie noch alle! Was ist das für ein Glück, im All mit Schrott zusammenzuknallen!“
„Wir haben Glück, weil der Schrott in die gleiche Richtung fliegt wie ihr, ist dafür aber zweieinhalb Mal so schnell als ihr.“
„Wie lange?“
„Sechs Stunden mindestens.“
Günther fiel sein Herz in die Hose, sie hatten noch sechs Stunden. Was sollte er tun, Alarm schlagen? Was würde hier los sein?
„Was machen Sie da, Karl?“ Eine sehr energische Stimme krachte im Hintergrund aus dem Lautsprecher.
„Ich mache das einzig Richtige, ich warne die da oben, damit sie sich in Sicherheit bringen können.“
„So ein Quatsch. Wie sollen die sich denn in Sicherheit bringen? Die Raumstation ist ihre einzige Chance. Haben Sie jetzt alles erzählt?“
„Ja.“
„Wem?“
„Günther.“
„Günther wer?“
„Günther Flossdorf.“
„Ah gut, der ist auch der Einzige, der diese Situation meistern kann. Ist der noch am Mikro?“
„Ja, die ganze Zeit.“
„Gut, Karl, dich kann man wirklich gebrauchen. Du bist beurlaubt, bis auf Weiteres, du hörst von mir, und jetzt raus!“
Günther hörte mit Erstaunen zu. Rainer Schmidt-Krämer war der Niederlassungsleiter des Labors der Firma Metall-Zircul und kam nur selten im Mietlaborbereich des DLR in Köln-Porz vorbei. Wenn der auf der Bildfläche erschien, war meist eine Katastrophe im Anmarsch. Karl hatte er wohl eben entlassen.
Rainer Schmidt-Krämer war ein groß gewachsener hagerer Mann mit grauen wuscheligen Haaren, etwa Mitte fünfzig und mit einem Respekt einflößenden Auftreten. Erschien er, war in jeder Besprechung Ruhe. So auch jetzt.
Günther traute sich nicht, etwas zu sagen.
„Herr Flossdorf, sind Sie noch da?“
„Ja. Hier.“
Dämlich, wo soll ich auch sonst sein? Kann doch hier nicht weg, blöde Frage, für einen Mann, der hier über Gelingen oder Nicht-Gelingen entscheidet. Er schaute auf die Uhr. Seine Schicht hatte vor fast fünf Stunden begonnen, er hatte ungefähr zwanzig Minuten mit Karl gesprochen, es war jetzt 14:50 Uhr. Sechs Stunden weiter hätten sie neun Uhr abends. Dann knallt es.
„Kann ich Günther zu Ihnen sagen?“
„Klar.“
Oh, jetzt kommt diese Tour, er macht einen auf ‚gut Freund‘ und versucht, sich bei mir einzuschleimen. Mir, dem Todgeweihten, dachte Günther.
„Gut, Günther, wir haben da ein Problem, Karl hat’s Ihnen schon gesagt. Ich hatte ihm Anweisung gegeben, keine Informationen durch-zustellen, bis wir eine Lösung erarbeitet haben, aber was macht er, er rennt hier hin und reißt ein Loch in Ihr Nervenkostüm.“
„Stimmt, da ist jetzt ein Loch drin, die Nerven sind gerissen.“
„Sehen Sie und deshalb meinte ich, er solle nichts sagen. Aber gut, dass er es Ihnen





























