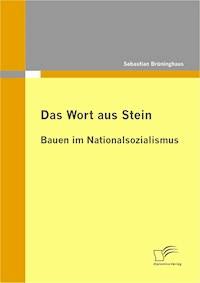18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - 1848, Kaiserreich, Imperialismus, Note: Noch gut (2,3), FernUniversität Hagen (Historisches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: Kaum einer in Deutschland weiß heute, dass die Stadt Tsingtau deutsche Wurzeln hat. Die Umgebung der Kiautschou-Bucht wurde 1897 mit einem militärischen Handstreich in deutschen Besitz gebracht. Dieser Handstreich wurde nachträglich mit einem Pachtvertrag besiegelt, um ihm den Anschein von Legalität zu geben. In dem nun deutschen Gebiet sollte ein Militär- und Wirtschaftsstandort entstehen. Ebenso plötzlich und relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit, wie es begann, endete 1914 dieses Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in China mit der Eroberung und Besetzung des Pachtgebietes Kiautschou und der Stadt Tsingtau durch Japan. 17 Jahre war also ein kleiner Landstrich an der ostchinesischen Küste unter deutscher Herrschaft. In dieser Hausarbeit zeige ich auf, wie die Stadt Tsingtau im Lauf dieser Jahre entstand, quasi aus dem Boden gestampft wurde und wie sie sich entwickelte. Ich verdeutliche die Bedeutung der Stadt als Wohnort für Chinesen und Europäer, als Wirtschafts- und als Militärstandort und ich stelle die Verwaltung und die Infrastruktur der Stadt dar. Letztere war besonders wichtig, war sie doch Vorraussetzung für einen florierenden Handel. Tsingtau war keine gewachsene Stadt, die sich aus einer kleinen Ansiedlung entwickelte. Die Stadt wurde von Grund auf geplant, auf das, wozu sie dienen sollte, zugeschnitten, wobei die zur damaligen Zeit modernsten Erkenntnisse aus Technik, Hygiene und Gesundheit beachtet wurden. Bei der Planung der Stadt spielten aber auch die 1897 herrschenden Vorstellungen der Deutschen von Chinesen, dem Zusammenleben mit diesen und dem Umgang mit einem kolonisierten Volk eine Rolle. Ich gehe in der Hausarbeit darauf ein, wie sich diese Vorstellungen der Deutschen von Chinesen in der Planung der Stadt und im täglichen Leben in ihr äußerten. Ein Blick ist darauf gerichtet, inwieweit bei der Entwicklung Tsingtaus und deren Einfluss auf die Umgebung von Urbanisierung gesprochen werden kann. Dafür stelle ich in einem gesonderten Kapitel den Urbanisierungsbegriff so dar, wie ihn die Stadtgeographie kennt. Bei allen chinesischen Ortsangaben benutze ich, soweit vorhanden, die deutsche Schreibweise, so wie sie von 1897 bis 1914 im Pachtgebiet benutzt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Urbanisierung
3 Geschichte Tsingtaus und des deutschen Pachtgebietes Kiautschou
3.1 Das Gebiet Tsingtaus vor der deutschen Inbesitznahme
3.2 Besetzung und Pacht Kiautschous
3.3 Tsingtau nach der deutschen Kapitulation von 1914
4 Entwicklung der Stadt Tsingtau
4.1 „Bauboom“ in Tsingtau
4.1.1 Entwicklung der Infrastruktur
4.1.2 Die „Europäerstadt“
4.1.3 Die „Chinesenstadt“
4.2 Die Verwaltung Kiautschous
4.2.1 Der Gouverneur
4.2.2 Die Bürgerschaftsvertreter
4.2.3 Die Bauverwaltung
4.2.4 Die Landordnung
4.3 Tsingtau als Wirtschaftszentrum
4.4 Tsingtau als Militärstützpunkt
4.5 Tsingtau als Verbindungspunkt zwischen deutscher und chinesischer Kultur
4.5.1 Chinesen in Tsingtau
4.5.2 Deutsche/Europäer in Tsingtau
5 Bewertung der Stadtentwicklung Tsingtaus
6 Zusammenfassung/Schluss
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Nachdem nunmehr die Vorfälle bei der Mission in der Präfektur Caozhoufu in Schantung ihre Erledigung gefunden haben, hält es die Kaiserliche Chinesische Regierung für angezeigt, ihre dankbare Anerkennung für die ihr seither in Deutschland bewiesene Freundschaft noch besonders zu betätigen. Es haben daher die Kaiserlich Deutsche und die Kaiserlich Chinesische Regierung, durchdrungen von dem gleichmäßigen und gegenseitigen Wunsche, die freundschaftlichen Bande beider Länder zu kräftigen und die wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen der Untertanen beider Staaten miteinander weiterzuentwickeln, nachstehende Separat-Konvention abgeschlossen:[1]
Mit diesen Worten, die, kennt man nicht ihren Kontext, nicht vermuten lassen, dass hinter ihnen keine freundschaftliche Gesinnung steckt, sondern ein von einer Seite diktierter Vertrag, beginnt der deutsch-chinesische Pachtvertrag für das Kiautschou-Pachtgebiet. Mit ihm nahm auch die Geschichte der Stadt Tsingtau ihren Anfang.
Kaum einer in Deutschland weiß heute, dass die Stadt Tsingtau deutsche Wurzeln hat. Die Umgebung der Kiautschou-Bucht wurde 1897 mit einem militärischen Handstreich in deutschen Besitz gebracht. Dieser Handstreich wurde nachträglich mit einem Pachtvertrag besiegelt, um ihm den Anschein von Legalität zu geben. In dem nun deutschen Gebiet sollte ein Militär- und Wirtschaftsstandort entstehen. Ebenso plötzlich und relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit, wie es begann, endete 1914 dieses Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in China mit der Eroberung und Besetzung des Pachtgebietes Kiautschou und der Stadt Tsingtau durch Japan. 17 Jahre war also ein kleiner Landstrich an der ostchinesischen Küste unter deutscher Herrschaft.
In dieser Hausarbeit zeige ich auf, wie die Stadt Tsingtau im Lauf dieser Jahre entstand, quasi aus dem Boden gestampft wurde und wie sie sich entwickelte.
Ich verdeutliche die Bedeutung der Stadt als Wohnort für Chinesen und Europäer, als Wirtschafts- und als Militärstandort und ich stelle die Verwaltung und die Infrastruktur der Stadt dar. Letztere war besonders wichtig, war sie doch Vorraussetzung für einen florierenden Handel. Tsingtau war keine gewachsene Stadt, die sich aus einer kleinen Ansiedlung entwickelte. Die Stadt wurde von Grund auf geplant, auf das, wozu sie dienen sollte, zugeschnitten, wobei die zur damaligen Zeit modernsten Erkenntnisse aus Technik, Hygiene und Gesundheit beachtet wurden. Bei der Planung der Stadt spielten aber auch die 1897 herrschenden Vorstellungen der Deutschen von Chinesen, dem Zusammenleben mit diesen und dem Umgang mit einem kolonisierten Volk eine Rolle. Ich gehe in der Hausarbeit darauf ein, wie sich diese Vorstellungen der Deutschen von Chinesen in der Planung der Stadt und im täglichen Leben in ihr äußerten.
Ein Blick ist darauf gerichtet, inwieweit bei der Entwicklung Tsingtaus und deren Einfluss auf die Umgebung von Urbanisierung gesprochen werden kann. Dafür stelle ich in einem gesonderten Kapitel den Urbanisierungsbegriff so dar, wie ihn die Stadtgeographie kennt.
Bei allen chinesischen Ortsangaben benutze ich, soweit vorhanden, die deutsche Schreibweise, so wie sie von 1897 bis 1914 im Pachtgebiet benutzt wurde.
2 Urbanisierung
Der Begriff der Urbanisierung ist ein Begriff, der sehr viele Aspekte bezeichnet. Ihn allein mit dem qualitativen Begriff der Verstädterung zu übersetzen, also der Vergrößerung und Vermehrung einer Stadt in Bezug auf Fläche, Einwohner und Anzahl, füllt ihn nicht vollständig. Urbanisierung bezeichnet auch den qualitativen Aspekt der Verbreitung städtischer Lebensformen. Quantitative Verstädterung teilt sich in vier Ebenen: den Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung, die Zunahme der Stadtbevölkerung, die Zunahme der Anzahl von Städten und die Umverteilung der Bevölkerung vom Land in die Stadt, jeweils in einem definierten Gebiet. Qualitative Verstädterung kann man trennen in einen funktionalen Teil, der Funktionsänderungen wie die Ansiedlung von Arbeitersiedlungen beinhaltet, und in einen sozialen Teil, der Sozial-, Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsformen beinhaltet.[2]
Um Urbanisierung festzustellen, muss aber erst der Begriff der Stadt definiert werden. Wie grenzt sich eine Stadt von Dorf ab, was ist ländlich, was ist städtisch? Ein offensichtlicher Aspekt, der eine Ansiedlung als Stadt oder Dorf kennzeichnet, ist die Einwohnerzahl. Allein eine hohe Bevölkerungsdichte macht aber noch keine Stadt aus.
Im 19. Jahrhundert gab es Veränderungen in den bis dahin geltenden Kriterien zur Unterscheidung zwischen Stadt und Dorf. Seit dem Mittelalter diente der Definition von Stadt die Existenz eines legalen Marktes. Dörfer wiederum verstand man als Siedlungen mit landwirtschaftlich geprägter Bevölkerung. Die im Laufe der industriellen Revolution entstandenen Siedlungen waren aber nach diesen Definitionen weder Dorf noch Stadt. Das Vorhandensein eines Marktes, gibt der Stadt eine weitere Rolle, nämlich einer Funktion für das Hinterland. Die Stadt mit ihrem Markt wird zum Umschlagplatz von Waren aus dem der Stadt zugeordneten Hinterland, was wiederum auch das Vorhandensein von weiteren Einrichtungen wie Banken, Büros und Geschäften verlangt. Wenn es auch in Dörfern kleine Läden gibt, macht das das Dorf noch nicht zur Stadt, die Ballung solcher Einrichtungen macht den Unterschied aus. Die Stadt dient außerdem nicht nur als Umschlagplatz von Waren, sondern durch ihre Bevölkerung auch selbst als Abnehmer.[3]
Aus historischer Sicht spielt für die Definition von Stadt neben den quantitativen Merkmalen auch durch das Vorhandensein einer Rechtsordnung eine Rolle.[4]
Während der Industriellen Revolution strömten immer mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit in die industriellen Ballungszentren. Verstädterung fand statt, aber nicht überall Urbanisierung; soziale Komponenten, wie z.B. Alphabetisierung, fehlten oft.[5] Urbanisierung ist also ein Phänomen der Neuzeit, das erst seit der industriellen Revolution existiert. Um 1900 lag der Anteil der Stadtbevölkerung an der Weltbevölkerung bei 14 %, erst seit der letzten Jahrtausendwende sind die Anteile von Stadt- und Landbevölkerung in etwa gleich groß.[6]
Es gibt verschiedene Theorien, wie es zu einer Urbanisierung kommen kann. Für viele ehemalige Kolonialstädte und ihre Umgebung trifft die Export-Base-Theorie zu. Viele Kolonialstädte wurden allein als Handelsstädte gegründet. Erst mit der Zeit entwickelten sich um den Handel Industrie und der Dienstleistungssektor. Schließlich wird die Stadt zur regionalen Metropole.[7]
In China gab es schon vor Beginn der Industrialisierung viele große Städte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts allein sieben mit mehr als 300000 Einwohnern, 1600 Verwaltungs- und 30000 Marktstädte, in denen insgesamt über 20 Millionen Menschen lebten. Dennoch war und ist die Urbanisierungsrate eher gering. In China liegt der Anteil der Stadtbevölkerung an der Gesamtbevölkerung bei nur 26%.[8]