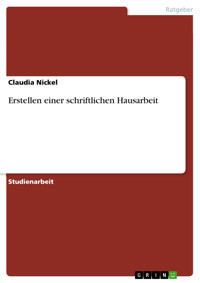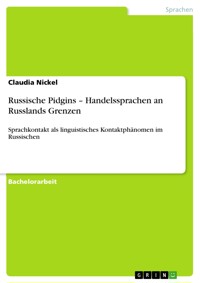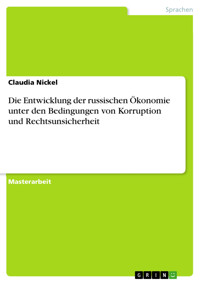
Die Entwicklung der russischen Ökonomie unter den Bedingungen von Korruption und Rechtsunsicherheit E-Book
Claudia Nickel
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Russistik / Slavistik, Note: 1,1, Justus-Liebig-Universität Gießen (Institut für Slavistik), Sprache: Deutsch, Abstract: Seit sich Osteuropa mit Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts im Umbruch befindet, sind die damit verbundenen Auswirkungen nicht nur positiver Natur. In den Transitionsgesellschaften erreichen Korruption und organisierte Kriminalität als unmittelbare Folge der sich verbreitenden Armut ein extrem hohes Niveau. Aus dem alten kommunistischen System Russlands haben sich alte Seilschaften in den Kapitalismus herübergerettet und erzielen beachtliche Profite auf Kosten der Allgemeinheit. Drogen- und Waffenschmuggel, Menschenhandel, Schlepperunwesen und Prostitution werden zu einem weitverbreiteten Phänomen des Alltags. Als politische Folge gewinnen in dieser Phase autoritäre Parteien und Politiker wie Vladimir Putin, die eine „Diktatur des Gesetzes“ versprechen, die desillusionierte Bevölkerung für sich. Die russische Ökonomie erleidet jedes Jahr beträchtliche volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe durch Normenverstöße von Unternehmen, privaten Haushalten und dem Staat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Phänomen Korruption: Erklärungen und Ursachen
2.1 Definition und Dimensionen eines vielschichtigen Begriffes
2.2 Korruptionsarten
2.3 Ursachen von Korruption – der Mensch als Faktor
2.3.1 Intelligenz
2.3.2 Psychopathie
2.3.3 Organisationaler Zynismus
2.4 Ursachen von Korruption – Situationen als Faktor
2.4.1 Die klassische ökonomische Kriminalitätstheorie: Rational Choice
2.4.2 Sozial-psychologische Theorie: Kognitive Dissonanz
3 Das postsowjetische Erbe
3.1 Entwicklungen in der Sozialpolitik
3.1.1 Die Transformation als Wandel der Gesellschaft
3.1.2 Postsowjetische soziale Stratifikation
4 Korruption in der russischen Wirtschaft
4.1 Beziehungsnetzwerke in Russland
4.1.1 Blat: Transaktionen über Beziehungsnetzwerke
4.1.2 Kryši: Transaktionen und ihre private Durchsetzung
4.1.3 Entwicklung kollektiver Korruption
4.2 Korruption als Phänomen des Wandels
4.2.1 Schlupflöcher durch unterentwickelte Gesetzgebung
4.3 Rechtsunsicherheit in der russischen Rechtskultur
4.3.1 Russische Gerichtsbarkeit
4.3.2 Die Schwäche der russischen Judikative
4.4 Der Rat zur Korruptionsbekämpfung
4.4.1 Medienreaktion auf die Gründung des Anti-Korruptionsrates
5 Korruption im gesellschaftlichen Diskurs
5.1 Soziologische Analyse zur Korruption in Russland
5.1.1 Soziodemografische Angaben
5.2 Involvierungstypologien der Korruption
5.3 Bewusstsein und Gewohnheit als Korruptionskonzept
5.3.1 Nicht korruptes Verhalten in Bestechungssituationen
5.3.2 Kultur der Bestechung
5.4 Korruption im Gesundheits- und Bildungswesen
5.4.1 Bildungsqualität durch korrekte Wahl der Mittel
5.4.2 Gesellschaftliches Ansehen durch höhere Bildung
5.4.3 „Ware“ Gesundheit gegen gute Bezahlung
5.4.4 Korruption als Normalität des täglichen Lebens
6 Ausblick und Fazit
7 Quellenverzeichnis
8 Anhang: Fragebogen der INDEM-Umfrage
1 Einleitung
„Die Korruption ist unter den Straftaten ein scheues Wesen. Sie kleidet sich in feines Tuch, trägt keine Waffen, vergießt selten Blut. Noch nicht einmal die Opfer des Deliktes sind auf Anhieb auszumachen.“[1]
Diese Aussage wirft zunächst die Frage auf, wie es möglich sein kann, bei einer Straftat nicht das klassische Opfer auszumachen. Das gemeinsame Geheimhaltungsinteresse beider beteiligter Seiten der Korruption, nämlich Korruptionsgeber und Korruptionsnehmer, ist eine plausible Erklärung hierfür. Oft genug entzieht sich das Problem der Korruption dadurch einer Aufklärung durch die Strafverfolgungsbehörden.[2] Das Thema Korruption hat im Verlauf einer relativ kurzen Zeit auf dem internationalen Parkett stark an Bedeutung gewonnen, was dessen Vordringen in das allgemeine Bewusstsein und somit auch in die öffentliche Diskussion bewirkt hat.[3]
Seit sich Osteuropa mit Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts im Umbruch befindet, sind die damit verbundenen Auswirkungen nicht nur positiver Natur. In den Transitionsgesellschaften erreichen Korruption und organisierte Kriminalität als unmittelbare Folge der sich verbreitenden Armut ein extrem hohes Niveau. Aus dem alten kommunistischen System Russlands haben sich alte Seilschaften in den Kapitalismus herübergerettet und erzielen beachtliche Profite auf Kosten der Allgemeinheit. Drogen- und Waffenschmuggel, Menschenhandel, Schlepperunwesen und Prostitution werden zu einem weitverbreiteten Phänomen des Alltags. Als politische Folge gewinnen in dieser Phase autoritäre Parteien und Politiker wie Vladimir Putin, die eine „Diktatur des Gesetzes“ versprechen, die desillusionierte Bevölkerung für sich.
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Die russische Ökonomie erleidet jedes Jahr beträchtliche volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe durch Normenverstöße von Unternehmen, privaten Haushalten und dem Staat. Der jährliche Korruptionsumfang belief sich im Jahr 2006 laut dem damaligen Vizegeneralstaatsanwalt Aleksandr Buksman[4]auf 240 Milliarden US-Dollar, eine Summe, die mit dem Staatshaushalt der Russischen Föderation vergleichbar ist und welche russische Bürger und Unternehmen jährlich für Bestechungen im Alltag (Bildung, Gesundheit, Justiz etc.) ausgeben. Im Vergleich mit der Europäischen Union lässt sich das Bestechungsvolumen noch eindrucksvoller darstellen: Nach aktuellen Zahlen verlieren die EU-Staaten jährlich 162 Milliarden US-Dollar durch Korruption, dies stellt weniger als 1 % des EU Bruttoinlandsproduktes dar. Russlands Nationales Anti-Korruptions-Komitee schätzt nach den neuesten Zahlen den jährlichen Verlust durch Korruption in Russland auf 300 Milliarden US-Dollar – eine Summe, die 15 % des Bruttoinlandsproduktes entspricht.[5]Am häufigsten findet sich Korruption im Gesundheitssystem und im Hochschulwesen, daher erfahren diese beiden Sphären später noch eine intensivere Beachtung. Ziel dieser Arbeit ist es, anhand bekannter Faktoren und Forschungsergebnisse die Ursachen der Korruption herauszustellen, im Fokus soll der Faktor Mensch stehen. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Menschen in Russland hat die Korruption verinnerlicht, da sie in ihrer Wahrnehmung als unumgänglich erscheint, was in der vorliegenden Arbeit analysiert werden soll. Die zu belegende These lautet wie folgt: Ohne Korruption ist das tägliche Leben für die Menschen in Russland undenkbar, da eine Vielzahl an Problemen nicht ohne sie gelöst werden kann. Aufgrund fehlender Ernsthaftigkeit in Bezug auf die Korruptionsbekämpfung bleibt sie auch in Zukunft ein Bestandteil der russischen Kultur. Dem ärmsten Teil der Bevölkerung werden dadurch jedoch notwendige und kostenlose Leistungen mangels Mittel vorenthalten.
1.2 Aufbau der Arbeit
Diese Arbeit befasst sich zunächst mit der allgemeinen Definition von Korruption und ihren verschiedenen Arten, ferner soll beleuchtet werden, welche Faktoren Korruption begünstigen. Im Anschluss daran findet die Bedeutung des postsowjetischen Erbes Beachtung, da ohne das Verständnis für diese Entwicklungen in jener Zeit die heutige Korruption in Russland nur schwer nachvollziehbar ist. Nachfolgend nehmen in dieser Arbeit Transaktionen und Beziehungsnetzwerke in der russischen Wirtschaft einen gewichtigen Teil ein, gefolgt von der Entwicklung der russischen Ökonomie unter Korruption und unsicherer Gerichtsbarkeit. Als Auswirkung der zunehmenden Korruption wurde durch Vladimir Putin im Jahr 2003 der Rat zur Korruptionsbekämpfung ins Leben gerufen, mit diesem und den Reaktionen der Medien hierauf beschäftigt sich die vorliegende Arbeit im Weiteren.
Korruption im gesellschaftlichen Diskurs stellt einen essentiellen Teil dieser Arbeit dar, in dem eine groß angelegte Umfrage als ausgeschriebene Studie der Weltbank zum Thema Korruption analysiert wird. Russlands Bürger kommen hier im Rahmen der Beantwortung eines umfangreichen Fragenkataloges mit insgesamt 77 Fragen zu Wort und geben einen Einblick in ihr eigenes Korruptionsverhalten. Da es aufgrund des Umfangs dieser Arbeit unmöglich ist, auf sämtliche Fragen einzugehen, wird sich auf die für das Thema relevanten Fragen beschränkt. In diesem Zusammenhang finden, wie bereits kurz erwähnt, die Bereiche des Gesundheits- und Bildungswesens besondere Beachtung, zwei sehr stark von Korruption betroffene Sphären.
Eine technische Anmerkung gilt der Transliteration russischer Eigennamen, diese folgt der wissenschaftlichen Transliteration. Ausgenommen hiervon sind nur geografische und Personennamen, für die geläufige deutsche Bezeichnungen existieren (z. B. Jelzin, Gorbatschow, Moskau). Abkürzungen werden ebenfalls transliteriert.
2 Phänomen Korruption: Erklärungen und Ursachen
Öffentliche Entrüstung über den Skandal Korruption entlädt sich in schöner Regelmäßigkeit unbeschadet der kollektiven Erkenntnis, dass es „so etwas“ schon immer gegeben hat. Aber welche Vorgänge, Zustände oder Verhaltensweisen sind „so etwas“, wenn von Korruption die Rede ist?[6] Es sind die dunkleren Seiten menschlicher Betätigung, nämlich die (aktive) Bestechung und die (passive) Bestechlichkeit, wodurch Korruption vornehmlich verurteilt wird. Bei genauerem Hinsehen schwindet jedoch die Sicherheit des Urteils, da es Fälle von Korruption gibt, welche Verständnis finden und sogar als unvermeidlich angesehen werden. Nimmt man beispielsweise das Zahlen von Trinkgeldern, so ist sicher noch nicht von Korruption zu sprechen, weit entfernt ist sie aber nicht. Anhand dieses Beispiels lässt sich erkennen, dass bei der Korruption wie auch bei ähnlichen Aktivitäten (z. B. Schwarzarbeit) eine Grauzone besteht.[7]
2.1 Definition und Dimensionen eines vielschichtigen Begriffes
Neben der Wirtschaftswissenschaft beschäftigt das Phänomen Korruption die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen wie Verwaltungswissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie, Kriminologie, Psychologie, Theologie, Biologie und Geschichtswissenschaft. Das Problem der Begriffsbestimmung taucht in allen wissenschaftlichen Abhandlungen auf und hat in den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen keinen einheitlichen Korruptionsbegriff vorzuweisen. Daher finden bei der Definition des Korruptionsbegriffes einzelne Wissenschaftsbereiche Beachtung, um die unterschiedlichen Definitionen zu verdeutlichen.[8]Etymologisch lässt sich korrupt mit bestechlich, verderbt oder verdorben übersetzen, abgeleitet aus dem lat. corrumpere,[9]welches das Verb „rumpere“ beinhaltet. In diesem Verb kommt der Vorgang des Brechens zum Ausdruck, welcher in der Wortverbindung „cor-rumpere“ schließlich das Zusammenbrechen benennt – brechen und zusammenbrechen kann nur dort etwas, wo es zuvor heil bzw. ganz war.[10]Umgangssprachlich wird der Begriff oft mit „Bestechung“ assoziiert. Dadurch bedingt und aufgrund teilweise bestehender Informationsdefizite resultiert das mangelnde Unrechtsbewusstsein für Straftaten, wie z. B. Vorteilsannahme oder Vorteilsgewährung.[11]Im Lexikon der Wirtschaftsethik[12]wird der Terminus Korruption als normwidriges Verhalten eines Funktionsträgers beschrieben. Aus der Sichtweise der Wirtschaftswissenschaft handelt es sich um einen nicht legalen Tausch[13]zwischen dem Agenten und dem Klienten[14], bei dem der Agent durch Missbrauch der Vertrauensstellung zwischen ihm und dem Klienten eine nicht erlaubte Handlung als Leistung erbringt. Hierdurch entsteht dem Wettbewerber ein Schaden. Der Begriff Korruption ist kein juristischer Fachbegriff und nur ein ausgewählter Teil menschlicher Verhaltensweisen wird erfasst, welchen man einem weiten Definitionsbereich der Korruption zuordnen könnte. Stierle unterteilt in seinem Buch die politische Korruption in drei wesentliche Aspekte:
„Amt und Mandat als politische Ressource zur privaten Interessendurchsetzung
Tauschcharakter politischer und ökonomischer Ressourcen
Konflikt zwischen privaten und öffentlichen Interessen.“[15]
Aus Sicht der Biologie wird das menschliche Korruptionsverhalten als eine Verletzung von „Standards“, die durch eigenen Willensentschluss herbeigeführt wird, definiert. Das Handeln zum eigenen Vorteil und das Verbergen[16]des erlangten Vorteils vor Mitbewerbern sind weitere Merkmale des menschlichen Korruptionsverhaltens.
Im Bereich der Verhaltensforschung setzt der Begriff der Korruption eine gewisse Abhängigkeit von der jeweiligen Phase des kulturellen Niveaus voraus und bedeutet sowohl in historischer als auch in soziokultureller Hinsicht nicht zu allen Zeiten und überall dasselbe. Jedoch umfasst hierbei die Korruption nicht jede Verletzung von Standards, sondern vor allem die Beanspruchung von Vorrechten und Ausnahmeregelungen durch die Einzelnen gegenüber der Gruppennorm. Somit ist unter Korruption das eigenwillige Außerkraftsetzen oder Nichtberücksichtigen des für eine bestimmte Gemeinschaft gültigen Standards (der Gruppennorm) zu verstehen.[17]
Um das begriffliche Spektrum interdisziplinär und in groben Zügen zu umreißen, können drei Klassen eines möglichen Begriffsverständnisses unterschieden werden:
1. Korruption als symbolische Verdichtung des Unmoralischen. Streisslers Defini-
tion[18]„unter Korruption wird ganz allgemein die moralische Minderwertigkeit von Personen, gemessen an einem Maßstab durchschnittlicher Redlichkeit oder einem bestimmten, in heiligen Schriften gebotenen Verhalten, verstanden“ deckt sich im Wesentlichen mit der allgemeineren, bereits vorstehend erläuterten Bedeutung des lateinischen corruptio, als ein (physisches oder moralisches) Verderben. Folgt man diesem Begriffsverständnis, so steht Korruption für eine nicht näher spezifizierte Amoralität in Form von moralischer Minderwertigkeit von Personen, Enttäuschung von Moralerwartungen oder als Kennzeichen sozialer Prozesse und Strukturen. Der Korruptionsbegriff gerät auf dieser normativ diffusen Ebene leicht zum pauschalisierend-umfassenden Synonym für die Schlechtigkeit der Welt, was die Metaphorik von Korruptionsdiskursen (Sumpf, Pest, Seuche, Krake, Krebsgeschwür etc.) eindrucksvoll demonstriert. Des Weiteren eignet sich der Korruptionsbegriff für undifferenzierte populistische Herrschaftskritik („die da oben sind doch alle korrupt“) ebenso wie zur denunziatorischen Instrumentalisierung im politischen Machtkampf.[19]
2. Korruption als qualifizierter Normverstoß. Wird das diffus Unmoralische des
Phänomens Korruption enger eingegrenzt, dann rückt der individuelle Normverstoß – also Korruption als normative Qualität von Handlungen – in den Mittelpunkt der Betrachtung. Korruption meint auf dieser Ebene im weitesten Sinne die Verletzung einer mehr oder weniger sorgsam gezogenen Trennlinie zwischen den gesellschaftlichen Sphären des „Öffentlichen“ und des „Privaten“. Die Soziologen Lüdtke und Schweitzer kennzeichnen Korruption als „Akt des Tausches von als wertvoll geschätzten Gütern zwischen mindestens zwei Akteuren in Verfolgung des Interesses an Nutzenoptimierung; [...] wobei mindestens eine Partei in ein Dilemma der Befolgung allgemeiner, universalistischer Normen oder Standards versus spezieller, privater, partikularistischer Normen oder Standards gerät, das zugunsten der letzteren entschieden wird; [...] wobei die Akteure negative Sanktionen aus der Umwelt (bei Aufdecken der Handlung) erwarten, gegenüber der sie in Bezug auf universalistische Orientierungen verpflichtet sind“[20]. Als partikularistischer Standard wird das private Interesse selbst zu einer normativen Kategorie, die mit dem universalistischen Standard spezifischer Rollenerwartungen kollidiert. Das korrupte Handeln wird auf seine interaktive Variante – den Akt des Tausches – beschränkt. Nicht jede Missachtung einer Priorität universalistischer Normen soll also mit Korruption gemeint sein, sondern nur diejenige, die auf einer Transaktion zwischen Akteuren beruht. Dieser unmoralische Tausch, bei dem für etwas gezahlt wird, was eigentlich nicht käuflich sein sollte, bildet den Kern eines engeren Korruptionsbegriffes, der – wiederum auf den lateinische Wortstamm zurückgehend – als Synonym für der Vorgang der Bestechung aufgefasst werden kann. Hiermit ist der durch einen Tausch abgewickelte heimliche Normenverstoß zum Zweck gegenseitiger privater Bevorteilung zulasten der Allgemeinheit gemeint und noch keine strafrechtliche Kategorie.[21]
3. Korruption als Kriminalität ist die dritte Klasse, welche der Vollständigkeit hal-
ber aufgeführt wird, jedoch lediglich rudimentär Beachtung findet. An dieser Stelle wären tiefere strafrechtliche Kenntnisse vonnöten. Erwähnenswert ist jedoch die Tatsache, dass nicht alles, was als moralisch verwerflich oder sozialschädlich angesehen wird, sich zugleich strafrechtlich normiert findet. So bestimmt sich Korruption als soziale Beziehung nicht über die Strafbarkeit.[22]
Abschließend soll an dieser Stelle die Anti-Korruptionsorganisation Transparency International zitiert werden, welche Korruption „als Missbrauch öffentlicher Macht zum privaten Nutzen“[23]definiert. Bei Korruptionsverflechtungen wie bei einer strukturellen oder systemischen Korruption sind Korruptionsgeber und Korruptionsnehmer nur schwierig zu identifizieren. Daher sollen im folgenden Kapitel verschiedene Formen von Korruption gegeneinander abgegrenzt werden.[24]
2.2 Korruptionsarten
Häufig wird zwischen drei Korruptionsausprägungen unterschieden: der situativen, der strukturellen und der systemischen Korruption. Bei einer situativen Korruption geht einer Korruptionshandlung keine gezielte Planung oder Vorbereitung voraus. Zu einem dann stattfindenden einmaligen illegalen Handeln führt vielmehr ein spontaner Willensentschluss. Bei der strukturellen Korruption hingegen wird eine bewusst geplante Tat vorausgesetzt, welche auf länger andauernden Korruptionsbeziehungen basiert[25] und nicht auf Spontanität angelegten Handlungen, welche hohe Intensitäten aufweisen. Eine hohe Intensität äußert sich durch eine hohe Forderung des Agenten bzw. eine hohe Bestechungsleistung des Klienten. Zudem ist bei struktureller Korruption von einem gewissen Organisationsgrad auszugehen. Um längerfristigen Beziehungen den Weg zu ebnen, werden bei dieser Form der Korruption überwiegend größere Summen in die Planung und Durchführung investiert. Denkbar ist, dass diese Beziehungen über Jahrzehnte hinweg unbeachtet ausgebaut werden. Etabliert sich eine dauerhafte Beziehung durch sich wiederholende Transaktionen, erweitert sich oftmals der Kreis der involvierten Personen.[26]