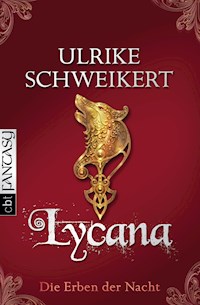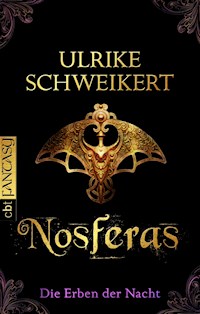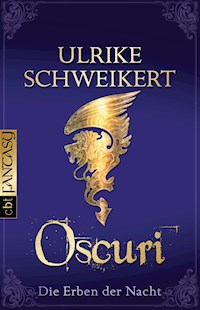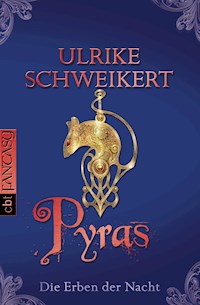Inhaltsverzeichnis
Widmung
PROLOG: EIN GROSSER PLAN
DIE HERRIN DER WÖLFE
DIE DRACAS
DUNLUCE CASTLE
Copyright
Für meine Freundin Sylvia Schmid und ihren Papageienclan und für meinen geliebten Mann Peter Speemann
PROLOG: EIN GROSSER PLAN
Die Vampirin stand an der Reling und sah in die Nacht hinaus. Der Himmel war von Wolken verhangen. Kein Stern war zu sehen. Nur die schäumende Gischt hob sich von den schwarz nach allen Seiten ausgedehnten Wassermassen ab, die sich unauf hörlich zu neuen Landschaften verformten, Hügel und Täler voneinander schieden. Der Sturm war zwar abgeflaut, doch noch immer warfen die Wogen das Schiff von einem Wellenkamm zum nächsten.
Die langen, schlanken Finger der Vampirin schlossen sich fest um die Reling, als das Schiff wieder einmal unvermittelt ins Bodenlose abzusacken schien. Ihre Augen waren fest auf den Horizont gerichtet, wo irgendwann endlich Irlands Küste auftauchen musste, ihre Gedanken jedoch arbeiteten emsig in einer verborgenen Kammer ihres Geistes an dem großen Plan. Sie würde den Meister nicht noch einmal enttäuschen. Dieses Mal würde sie als strahlende Siegerin zurückkehren und ihn überraschen. Sein Blick würde zuerst voll Staunen und dann stolz auf ihr ruhen. Und dann würde er die Hand nach ihr ausstrecken und sie mitnehmen.
Sie gestattete sich nicht, sich dieser wundervollen Vision hinzugeben. Noch gab es zu viel zu tun, Fäden zu spinnen und zu verweben, bis das Netz dicht genug war, es zuzuziehen und das zappelnde Opfer zu umschließen, immer enger, bis seine Gegenwehr erlahmte und es in ihrer Gewalt war. Sie lächelte versonnen. Ein schönes Lächeln, das ihr ebenmäßiges Gesicht erstrahlen ließ.
Zwei Monate hatte sie Zeit gehabt, sich das nötige Wissen anzueignen. Es war nicht einfach gewesen, und sie hatte zwei Reisen unternehmen müssen, um in alten Unterlagen das zu finden, was sie suchte.
Doch dann begann ihr Plan, Formen anzunehmen. Der Meister selbst hatte sie - vermutlich unwissentlich - auf die entscheidende Fährte gesetzt. Sie war stolz auf sich. In ihrem Geist war die Lösung seines Problems geboren. Sie hatte das Schwert gefunden, mit dem man den Knoten zerschlagen konnte - und sie war auch bereit, die Klinge zu führen, wenn es so weit war! Doch bis dahin galt es, Geister zu verwirren und Seelen zu vergiften. Sie zweifelte nicht daran, dass sie das richtige Werkzeug bald gefunden haben würde. Es war für Männer so leicht, ihrem Zauber zu erliegen! Und wenn sie den richtigen erst gefunden hatte, würde er die Schlingen für sie auslegen. Sie musste dann nur noch warten und im rechten Moment zugreifen! Die Vampirin spürte, wie ein Lachen in ihrer Kehle aufstieg. Nur noch ein paar Wochen, dann würde sie am Ziel ihrer Wünsche sein, und die vergangene Niederlage wäre nicht mehr als ein schattenhafter Albtraum, der sie einst gequält hatte und sich nun in Nebel auflöste.
DIE HERRIN DER WÖLFE
Die Morgensonne strich mit ihren ersten Strahlen über die Weite des kahlen Moores und ließ die winzigen Blüten des Heidekrauts aufleuchten. Der noch rötliche Schein schmeichelte den Konturen der schroffen Berge und verlieh der Landschaft einen trügerischen Hauch von Sanftheit, den der stürmische Wind Lügen strafte. Schneidend kalt brauste er in Böen von Westen heran, zerrte am Gewand der einsamen Gestalt mitten im Moor von Connemara und streifte ihr die Kapuze vom weißen Haar. Ein letzter Sonnenstrahl liebkoste das Antlitz der Frau, dann verschluckten Wolken die Morgensonne und die Gipfel der Berge. Ein eisiger Schauer prasselte herab und das Moor zeigte wieder sein abweisend düsteres Gesicht.
Die Frau blieb stehen, zog sich die Kapuze über den Kopf und setzte ihren Weg unbeirrt fort. Mochte ihr Gesicht auch eingefallen und zerfurcht sein, als habe es weit mehr als einhundert Jahre gesehen, und ihr Leib unter dem langen, weiten Gewand mager, so schritt sie dennoch kräftig aus und hielt den Rücken gerade. Ihren langen Stab schien sie nicht als Stütze bei dem nun immer steileren Aufstieg zu brauchen. Obwohl nirgends ein Pfad erkennbar war, ging sie, ohne zu zögern, voran, umrundete Tümpel mit schwarz schimmerndem Wasser und bodenlosem Morast, schritt an felsigen Abbrüchen entlang und zwischen stacheligen Büschen hindurch, die sich unter dem Wind geduckt nach Osten neigten. Die Gräben und rechteckigen Vertiefungen im moorigen Boden, die die Arbeit der Torfstecher verrieten, hatte sie längst hinter sich zurückgelassen. Bis hier hinauf verirrte sich nur selten ein Mensch, taugte der bräunliche Bewuchs der Berghänge doch nicht einmal, um ein paar Schafe zu weiden.
Die Frau blieb stehen. Die beiden grauen Wölfe, die ihr in einigem Abstand gefolgt waren, schlossen zu ihr auf und ließen sich neben ihr nieder. Ihr Blick wanderte zu den Spitzen der Twelve Bens oder Beanna Beola hinauf, wie die Kelten die Berge genannt hatten, die zwischen den dahinjagenden Wolken immer wieder kurz zu sehen waren. Und für einen Augenblick glaubte sie auch, die Spalte im Fels erahnen zu können, die das Ziel ihrer Reise war. Dann hatte der graue Nebel sie wieder verschlungen. Die alte Frau setzte ihren Weg fort.
Noch ehe die Wollgraswiesen und braunen Matten in Felsgestein übergingen, trat plötzlich ein Mann aus dem Schatten eines der Megalithgräber, deren mächtige Pfeiler und Steinplatten hier im einsamen Westen der Insel noch an vielen Stellen aufragten. Er ging auf sie zu und neigte den Kopf.
»Druidin Tamara Clíodhna, sei gegrüßt.« Kein Lächeln erhellte die hageren Gesichtszüge. Er nickte auch den beiden Wölfen zu. »Deartháir beag, deirfiúr beag« - kleiner Bruder, kleine Schwester.
Die Druidin erwiderte seine Begrüßung. »Cén chaoi a bhfuil tú, Mac Gaoth?«
Wieder neigte er den Kopf und antwortete mit der Gegenfrage: »Cén chaoi a bhfuil tú féin, Tamara Clíodhna?« - und wie geht es dir -, ohne dass seine Miene freundlicher wurde.
»Tá mé go maith, go raibh maith agat.« Die Druidin versicherte - wie es sich gehörte -, dass es ihr gut gehe. Damit war der Höflichkeit Genüge getan. Mac Gaoth drehte sich um und ging ohne ein weiteres Wort den Berghang hinauf. Den Blick auf seinen sehnigen Rücken gerichtet, folgte ihm die alte Frau. Er ging schnell und sah sich nicht einmal nach ihr um, doch sie hielt mit ihm Schritt und zeigte keine Anzeichen von Erschöpfung.
Mac Gaoth - Sohn des Windes - nannten sie ihn. Er war einer der Jüngeren der Sippe, die sich im Gebiet der Twelve Bens aufhielt, und er gehörte zu den Wilden, die die Jahre noch nicht gezähmt hatten.
Bald erreichten sie die Felsen, und Mac Gaoth bog in einen kaum erkennbaren Pfad ein, bis die Spalte sich plötzlich vor ihnen öffnete.
»Wen bringst du?«, fragte eine Stimme aus der Finsternis.
Wortlos trat der junge Mann beiseite und ließ die Druidin und ihre beiden Wölfe eintreten. Es war so dunkel, dass ihre Augen kaum die Umrisse des Mannes ausmachen konnten, der ebenso groß gewachsen und hager wie Mac Gaoth schien. Aber sie erkannte seine Stimme.
»Áthair Faolchu, Vater der Wölfe, ich habe gehofft, dass ich dich hier antreffe!«
»Tamara Clíodhna, was für eine Überraschung«, sagte die alterslose Stimme in der Dunkelheit. Wie Mac Gaoth war Áthair Faolchu einer der wenigen, der sie mit ihrem vollen Namen ansprach, von allen anderen wurde sie nur Tara genannt.
»Ah bhfuil aon scéal agat?«
Tara nickte. »Ja, ich habe etwas zu erzählen!«
»Nun, dann komm herein. Unser kleiner Bruder und die kleine Schwester mögen dir folgen.«
Die Druidin legte ihre Hände auf die Köpfe der beiden grauen Wölfe, die neben sie getreten waren, und ließ sich von ihnen durch den finsteren Gang führen, bis er sich nach einigen Biegungen zu einer domartigen Höhle erweiterte. Kleine Öllampen brannten in Haltern an Säulen und Vorsprüngen und ließen Schatten über die schroffen Granitwände tanzen. Tara betrachtete den Mann, der vor ihr stehen geblieben war und sich nun zu ihr umwandte. Er hatte sich nicht verändert, seit sie ihn vor vielen Dutzend Jahren kennengelernt hatte. Die pergamentartige Haut umspannte die Knochen so eng, dass sein Antlitz wie ein Totenschädel wirkte. Verstärkt wurde der Eindruck durch die tief liegenden Augen, die im Schein der kleinen Flammen rötlich schimmerten. Die Kleider, die seinen mageren Körper verhüllten, waren aus Leder. Der Pelz eines großen grauen Wolfes hing über seine Schultern herab. Der Schädel lag wie eine Kapuze über seinem Kopf. Tara hatte den Wolf gekannt. Er war in hohem Alter von einer Gruppe von Schaffarmern getötet worden. Áthair Faolchu selbst hatte seine sterbliche Hülle heimgeholt und trug sie nun wie das Vermächtnis eines Ahnen.
Der Werwolf führte sie an einer kleinen Gruppe Männer und Frauen vorbei, die sie neugierig musterten. Sie erkannte Mahon, Bidelia und Cairbre, drei alte Werwölfe, die, schon seit sie denken konnte, in Áthair Faolchus Gefolge waren, und den jungen Ivarr, der sich mit einigen anderen gern um den rebellischen Mac Gaoth scharte.
Áthair Faolchu führte die Druidin in eine kleinere Höhle, die mit Decken und Fellen ausgelegt war. »Setz dich. Ich kann dir leider nichts anbieten, das deinem Gaumen munden würde.«
Die Druidin hob abwehrend die Hand. »Das ist auch nicht nötig. Ich bin nicht gekommen, um mit dir zu speisen.«
Der Mann neigte den Kopf und ließ sich bedächtig ihr gegenüber auf einem Bärenfell nieder.
»Was können wir für dich tun? Es ist noch zu früh, den Pakt zu erfüllen. Und mein Instinkt sagt mir, dass du nicht nur gekommen bist, um uns neue Geschichten aus der Welt zu bringen!«
Er lehnte sich in die Felle zurück. Die Druidin ließ sich durch seine kränkliche Erscheinung nicht täuschen. Tara wusste, dass er nicht nur schnell und stark war. Es war der älteste und mächtigste Werwolf seiner Sippe. Dennoch würde sie das Gespräch auf ihre Weise führen.
»Die Geschichten aus der Welt sind aber durchaus wert, gehört zu werden! Ich bin bis nach Rom gereist.«
Zum ersten Mal huschte so etwas wie ein Lächeln über die bleichen Lippen. »Wolltest du mit eigenen Augen sehen, wie sich die Clans der Vampire gegenseitig an die Kehle gehen? Unsere Lycana und die Vamalia aus Hamburg, die Nosferas aus Rom, die Vyrad aus London und Pyras aus Paris, ja und die verehrten Dracas aus Wien - habe ich alle?« Er warf der Druidin einen Blick zu. Sie nickte.
»Sie alle zwischen denselben Mauern des alten goldenen Neropalasts, der Domus Aurea? Ich kann mir denken, es ist viel Blut geflossen!«
»Nein!«, widersprach Tara in scharfem Ton. »Der Krieg zwischen den Vampirclans ist beendet. Ich habe den Clanführern vor einem Jahr bei unserem Treffen auf Burg Chillon am Genfer See den Vorschlag unterbreitet, von nun an die jungen Vampire aller Familien gemeinsam auszubilden und zu stärken, und sie haben geschworen, Frieden zu schließen - oder zumindest, sich nicht länger zu bekämpfen.«
»Euer Treffen?«, wiederholte der alte Werwolf und lächelte schlau. »Willst du behaupten, sie hätten dich geladen, um sich mit dir zu beraten?«
Sie wich der Frage aus. »Donnchadh war einverstanden. Und er ist der Führer der Lycana, der alten Familie der irischen Vampire.«
»Donnchadh«, wiederholte Áthair Faolchu und schien dem Klang des Namens zu lauschen. »Und was sagt die schöne Mistress Catriona dazu?«
Die Druidin hob beide Hände. »Es gibt nichts, das dir entgeht!«
»Nicht viel. Doch du wolltest mir von Rom berichten und mich glauben machen, dieses Experiment sei nicht in einer Katastrophe gemündet?«
»Nein, keine Katastrophe. Der Plan scheint aufzugehen. Die jungen Vampire werden lernen, die über Jahrhunderte genährte Feindschaft zu begraben, die ihre Familien näher an den Abgrund der Vernichtung geführt hat, als die Menschen es je hätten tun können. Nein, es war ein gutes Jahr, das sie alle gestärkt und neue Bündnisse geschaffen hat.« Nun lächelte die alte Frau, dann aber umwölkte sich ihre Stirn. »Und dennoch schwebt eine Gefahr über ihnen, die ich nicht vorausgesehen habe!«
»Etwas, das nicht einmal die große, allwissende Tara vorausgesehen hat? Ich kann es kaum glauben!«
»Dies betrifft nicht nur die Lycana und die Vampire allesamt. Es bedroht auch einen der euren, den ihr ganz sicher nicht verlieren wollt!«
Das spöttische Lächeln war wie weggewischt. »Haben wir ihn nicht bereits vor langer Zeit verloren?«
»Nein! Wie kannst du so etwas sagen!«
Der Werwolf beugte sich ein wenig vor. »Berichte! Und sage mir, was kann ich tun? Was können wir tun, um das Unheil zu verhindern?«
Die Druidin erhob sich und griff nach ihrem Stab. Das Licht der Flammen glitt über die eingravierten Muster aus ineinander verschlungenen Spiralen, magische Zeichen der Kelten, die diese Insel lange vor den Christen bewohnt hatten. Die beiden Wölfe eilten an ihre Seite.
»Die Kraft der alten Magie lässt nach. Schneller als bisher. Ich fühle es bereits seit Monaten. Und was das bedeutet, muss ich dir nicht sagen!«
Áthair Faolchu erhob sich ebenfalls und trat in den Gang hinaus. Seine Miene war ernst.
»Bring mich zum cloch adhair«, forderte Tara, als sie neben ihn trat. »Ich muss die Kraft des Steines spüren, um zu entscheiden, was zu tun ist.«
Der Werwolf zögerte. Obwohl er ihr noch vor wenigen Augenblicken seine Unterstützung zugesagt hatte, widerstrebte es ihm nun unübersehbar, ihrer Forderung nachzukommen. Tara wartete geduldig und beobachtete den inneren Kampf, der sich in seiner Miene widerspiegelte. Sie scheute sich, ihn an den Pakt zu erinnern. Sie hatte das Recht, ihn jederzeit zu sehen und zu berühren!
»Also gut, dann komm«, sagte er schließlich. »Und nimm dir eine der Lampen mit. Wir haben kein Licht für Besucher dort drinnen!«
Die Druidin hob eine der Öllampen aus ihrer Halterung und folgte dem Werwolf in die Tiefe des Berges. Sie sprachen kein Wort. Es war lange her, dass Tara im Herz des Berges gewesen war. Sie stiegen sich eng windende Treppen hinunter, bückten sich unter Steinblöcken hindurch, folgten verzweigten Gängen und querten gewaltige Hallen. Vermutlich hätte Tara den Weg allein nicht wiedergefunden. Doch die Werwölfe hätten - trotz des Paktes - sowieso niemandem gestattet, hier ohne ihre Begleitung hinunterzusteigen. Nicht einmal der Druidin Tara, die sie respektierten und achteten, jedoch nicht verehrten, und deren magischer Stimme sie nicht gehorchen mussten.
Tara merkte, wie sich die steinernen Wände veränderten. Der graue Granit verschwand und wurde von weißem und grün gesprenkeltem Marmor ersetzt, durch den sich dunkel und kupferfarben schimmernde Erzbänder zogen. Sie näherten sich ihrem Ziel.
Endlich langten sie in der kleinen, fast kreisrunden Höhle an, die den wertvollen Stein beherbergte. Tara näherte sich bis auf drei Schritte dem altarähnlichen Podest, auf dem er auf einem schwarzsamtenen Kissen ruhte. Áthair Faolchu trat neben sie.
»Cloch adhair, die Kraft unseres Landes.«
Die Druidin nickte. Schweigend betrachteten sie den Stein aus dem grünen Marmor von Connemara, den viele auch nur anam nannten - die Seele. Der Stein war etwa zwei Fuß lang und in seinen Umrissen wie Irland geformt.
»Grün wie das saftige Gras der Insel, das die Grundlage allen Lebens ist, weiß wie das Licht der Seelen, die auf ihr leben, in die Anderwelt aufsteigen und wiedergeboren werden, und schwarz wie die Schatten des Krieges, die die Fremden seit Jahrhunderten über uns bringen«, sagte der Werwolf. »Spürst du seine Kraft?«
»Ja, seine Kraft ist ungebrochen, doch die seiner Kinder lässt nach. Ich fürchte, sie waren zu lange und zu weit fort von Irland. Der Schutz geht schon bald verloren. Sie müssen herkommen, noch ehe der Tag des Wechsels anbricht.«
Áthair Faolchu schwieg eine Weile, ehe er fragte: »Wozu diese Eile? Sind unser Land und die Familien nicht Schutz genug?«
»Nein!«, widersprach die Druidin barsch. »Ich kann die Finsternis am Horizont sehen, die ihre Finger bis nach Irland streckt. Selbst hier droht ihnen bald Gefahr!«
»Dann müssen wir eben aufpassen«, erwiderte der Werwolf, ohne den Blick seiner rötlichen Augen von dem Stein zu wenden.
»Wir werden den Bund erneuern und die erschöpften Kräfte an der Quelle ihrer Macht stärken!«, sagte Tara bestimmt.
Nun sah sie der Werwolf an. Seine Augen wurden schmal. »Du willst sie hierherbringen?«
»Ja, ich habe das Recht dazu, und das weißt du«, sagte die Druidin leise.
»Es ist nicht nötig, mich an den Pakt zu erinnern, aber die Stimmen, die sich gegen ihn erheben, werden lauter.«
»Solange du deine Sippe führst, werde ich darauf vertrauen, dass die Werwölfe zu ihrem Wort stehen!«
Er schwieg, doch sie spürte seine Ablehnung, als er sie zurück in die Höhle führte, wo die anderen Mitglieder der Sippe bereits ungeduldig auf den Abend warteten. Heute war Vollmond. Eine Nacht, in der sie ihre Körper im silbernen Licht baden und ihre Kräfte stärken würden.
Die Druidin verabschiedete sich. Sie wusste, dass die Werwölfe bei dem bevorstehenden Ritual unter sich sein wollten. Es banden sie nicht nur gute Gefühle an die Sippe der Werwölfe, und das war ihnen bekannt. Alte Verletzungen, Wut, Trauer und auch Hass drohten in solchen Nächten aufzubrechen. Es war ein langer Weg gewesen, gegenseitige Achtung und Vertrauen aufzubauen. Wie leicht konnte das in nur wenigen Augenblicken zerstört werden. Tara trat aus der Spalte und machte sich an den Abstieg. Sie spürte, dass die Werwölfe sie beobachteten, aber sie sah nicht zurück. Die Sonne war schon fast hinter den Gipfeln verschwunden, während im Osten ein bleicher Mond am Himmel hing. Der Sturm hatte die Wolken verblasen. Die letzten grauen Fetzen jagten über den Himmel, so als versuchten sie, ihre Brüder und Schwestern einzuholen.
Die Druidin hielt am Dolmen an, an dem sie auf Mac Gaoth getroffen war, und ließ sich auf seiner schon etwas schiefen Platte im Schneidersitz nieder. Den Stab quer über die Knie gelegt, die Handflächen gen Himmel geöffnet, saß sie da, während die Sonne erlosch und das Licht des Mondes an Kraft gewann. Die Druidin musste sich nicht umwenden, um zu sehen, was sich vor der Felsspalte zwischen verkrüppelten Büschen und Heidekraut abspielte. Sie hatte die Wandlung schon oft genug mit eigenen Augen erlebt. Wie sich das Gesicht in die Länge zu ziehen und eine Wolfsschnauze zu bilden begann, wie Fell durch die Haut brach, wie der Körper bebte und sich verformte und vor Schmerzen zitterte, ehe er auf vier Pfoten hinabfiel und ein erstes, triumphierendes Heulen zum Himmel sandte. Ja, der Gestaltwechsel war ein qualvoller, aber auch ein befreiender Prozess, den nur die erfahrenen und mächtigen Werwölfe durch reine Willensanstrengung zu jeder Tages- und Nachtzeit durchführen konnten. Die Jungen und Schwachen waren bei Vollmond gezwungen, ihre tierische Gestalt anzunehmen und auf Jagd zu gehen. Sie waren gefährlich, denn sie waren wild und unbeherrscht in ihrer Gier nach frischem Fleisch. Die Menschen fürchteten sich zu Recht und verschlossen in diesen Nächten Türen und Fenster und hängten Amulette und magische Sprüche über ihre Betten.
Vom Berg her wehte ein Heulen herab, das vielstimmig erwidert wurde. Tara konnte die Freude in den Stimmen hören. Die beiden Wölfe an ihrer Seite winselten unruhig. Die Druidin erhob sich, stieg von der Platte des Hünengrabes hinunter und setzte ihren Weg ins Tal fort, während sich die Werwölfe in fiebriger Erwartung auf die Jagd machten.
DIE DRACAS
Ein Spätsommertag war zu Ende. Die Nacht hatte sich über Wien gesenkt, und überall an den großen Plätzen und entlang der Prachtstraße, die zur Hofburg führte, wurden die Gaslaternen entzündet. Heute war Donnerstag und die feine Gesellschaft bereitete sich für ihren Auftritt auf dem Hofball oder in einem der Theaterhäuser der Stadt vor. Die Nacht würde lang werden, aber was machte das schon? Man konnte ja in den Tag schlafen, so lange man wollte.
Auch in einem Stadthaus an der neuen Ringstraße, die sich nun statt des mittelalterlichen Grabens um die Altstadt Wiens zog, erwachte das Leben. Das Haus war mehr Palast als Stadthaus zu nennen und beherbergte eine ganz besondere Familie, die sich dem alten Adel Österreich-Ungarns durchaus ebenbürtig fühlte. Das Oberhaupt der Dracas war Baron Maximilian, den man gewöhnlich in Gesellschaft seiner Schwester Antonia antraf. Er war groß und dunkel, seine Gesichtszüge ebenmäßig wie bei fast allen Mitgliedern der Familie. Er trug einen gepflegten Bart wie der Kaiser in seinen jungen Jahren. Seine Schwester Antonia war ihm ähnlich, doch von solch strahlender Schönheit, dass sich die Männer der Gesellschaft stets zu ihr umdrehten und ihr nachstarrten, als sei sie eine überirdische Erscheinung. Nur ihr oft mürrisch zusammengekniffener Mund störte das Bild perfekter Harmonie. Und der schrille Klang ihrer Worte, dachte Franz Leopold, als ihre Stimme unvermittelt an seine Ohren drang.
Müßig schlenderte der junge Vampir durch das Palais. Wie üppig verziert die Stuckdecken waren, wie edel die schweren Vorhänge, die auf die Bezüge der Chaiselongue und anderer Sitzmöbel abgestimmt waren. Die vergoldeten Kandelaber schimmerten im Schein des Kerzenlichts. Ja, das Palais der Dracas war prächtig. Nachdenklich ließ Franz Leopold den Blick schweifen. Solche Gedanken waren ihm früher gar nicht gekommen. Doch nun, nachdem er fast ein Jahr in Rom in der Domus Aurea verbracht hatte, sah er das Wiener Palais mit anderen Augen. Sicher musste Neros Palast einst noch prachtvoller gewesen sein, doch das war fast zweitausend Jahre her! Nun fand man unter dem Oppiushügel nur noch feuchte unterirdische Gänge und Kammern. Und doch huschte ein Lächeln über sein Gesicht, als die Erinnerung an die vergangenen Monate wie ein warmer Strom durch seinen Geist flutete.
»Was grinst du so einfältig?«, fragte ihn sein Vetter Karl Philipp, der soeben um die Ecke bog. Hinter ihm tauchte seine ältere Cousine Anna Christina auf.
Franz Leopolds Lächeln war wie weggewischt. »Ich dachte eben nur an diese unsägliche Domus Aurea, und wie glücklich wir uns schätzen können, wieder daheim zu sein.«
Karl Philipp zog eine Grimasse. »Das kannst du laut sagen!« Er war wie Franz Leopold groß und schlank, mit dunklem Haar, dunkelbraunen Augen und langen Wimpern. Und doch wirkte er neben seinem jüngeren Vetter wie ein verzerrtes Spiegelbild.
»Franz Leopold ist der schönste Junge auf der Welt. Er ist perfekt, wie kein Maler oder Bildhauer ihn hätte erschaffen können«, pflegte Marie Luise, die jüngste der Erben der Dracas, zu sagen. Ein lauernder Ausdruck trat dann stets in ihren Blick, und sie warf ihre lange, dunkle Lockenpracht zurück, bis sie das gesagt bekam, was sie in diesem Moment zu hören begehrte: »Franz Leopold ist der schönste junge Vampir, das stimmt, aber du und Anna Christina, ihr seid die schönsten Vampirinnen, die die Welt hervorgebracht hat!«
»Was habt ihr vor?«, wollte Franz Leopold wissen. »Stimmt etwas nicht?«
»Anna Christina will zur Baronesse, und ich war so leichtfertig, mich überreden zu lassen, sie zu begleiten.«
Franz Leopold sah die beiden verblüfft an. »Was will sie dort?«, fragte er mit gesenkter Stimme.
»Sie will nicht mehr zu dieser vermaledeiten Akademie für junge Vampire.«
»Ja, denn ich bin nun eine erwachsene Vampirin und habe mit diesem Kinderkram nichts mehr zu tun«, fügte Anna Christina mit einer Stimme, scharf wie eine Messerklinge, hinzu.
»Baron Maximilian sieht das anders und hat jede Diskussion abgelehnt, aber sie bildet sich ein, die Baronesse überzeugen zu können. Und ich soll ihr dabei helfen!«
Karl Philipp machte aus seinem Missmut keinen Hehl. Franz Leopold hätte fast aufgelacht. Sein Cousin war Anna Christina einfach nicht gewachsen. Sie verstand es, ihren hübschen Kopf durchzusetzen - zumindest bei ihrem Vetter. Ob ihr das allerdings auch bei der Schwester des Clanoberhaupts gelingen würde, war fraglich.
Plötzlich hellte sich die Miene seine Cousins auf. »Du musst auch mitkommen! Die Baronesse hat einen Narren an dir gefressen und wird eher auf dich hören als auf jeden anderen. Keine Widerrede!« Karl Philipp griff nach seinem Arm.
Franz Leopold wusste sich wohl gegen seinen Vetter zu wehren, obwohl der ein Jahr älter und ein wenig kräftiger war. Nun aber nickte er, denn er war neugierig, wie das Gespräch verlaufen würde. An seinem Ausgang jedenfalls zweifelte er keinen Moment! Und vermutlich wusste auch Karl Philipp, wie es enden würde. Anna Christina jedoch sah zuversichtlich drein und näherte sich mit forschen Schritten der Tür zu den Gemächern der Baronesse Antonia.
»Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin?«
Der scharfe Klang ließ auch Anna Christina ein wenig zurückzucken und die Zuversicht schwand für einen Augenblick. Dann jedoch fasste sie sich wieder, knickste elegant, dass ihr ausladender Reifrock zurückschwang, und richtete sich dann sehr gerade auf.
»Verzeiht, dass ich Euch störe, Baronesse Antonia. Ich würde gern etwas von großer Wichtigkeit mit Euch besprechen«, sagte sie tapfer.
»Wichtig für mich oder für euch?«, fragte die Schwester des Clanführers, ohne den Blick von ihren langen Fingernägeln zu wenden, die eine ihrer Unreinen sorgfältig zu Spitzen feilte.
»Wichtig für die Familie«, behauptete Anna Christina ein wenig keck.
Nun sah die Baronesse auf. »So?«
»Ich denke, es ist für niemand von Vorteil, wenn ich die Kinder«, sie betonte das Wort verächtlich, »zu ihrem Schulunterricht nach Irland begleite.«
»Nein? Und warum nicht?«
»Ich bin erwachsen …«
»Bist du nicht«, unterbrach sie die Baronesse. »Du hast noch nicht am Ritual teilgenommen und gehörst daher auch noch nicht zu den erwachsenen Vampiren reinen Blutes.«
»Aber ich werde siebzehn, noch vor Midwinter. Und dann werde ich aufgenommen und habe das Recht, selbst zu jagen und Menschenblut zu trinken!« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Franz Leopold fand, dass sie wie ein trotziges Kind wirkte. Fehlte nur noch, dass sie mit dem Fuß aufstampfte. Offensichtlich dachte die Baronesse ähnlich, denn sie runzelte ärgerlich die Stirn.
»Wann du erwachsen bist, bestimme ganz alleine ich - oder der Baron«, fügte sie schnell hinzu. »Das Jahr in Irland wird dir nicht schaden, auch wenn ich von dem ganzen gemeinsamen Akademieplan nicht viel halte. Und wenn du zurück bist, können wir über deine Aufnahme sprechen.«
»Dann ist bereits Midsommer«, rief Anna Christina entsetzt. »Ich kann und will nicht mehr so lange warten!«
»Dir wird nichts anderes übrig bleiben.« Die Baronesse betrachtete ihre gepflegten Krallen im Schein eines Kerzenleuchters und streckte der Dienerin dann die andere Hand hin.
Anna Christina warf ihren Cousins einen Hilfe suchenden Blick zu. »Sagt doch auch mal etwas!«
Warum sollte er für Anna Christina in die Bresche springen und womöglich bei der Baronesse in Ungnade fallen? Andererseits entbehrte der Gedanke, fast ein Jahr ohne ihr Gekeife verbringen zu können, nicht eines gewissen Reizes. Franz Leopold räusperte sich.
»Baronesse Antonia, vielleicht überdenkt Ihr Eure Worte noch einmal? Anna Christina ist ja nun wirklich nur noch einen winzigen Schritt von ihrem entscheidenden Geburtstag entfernt und schon so klug und … äh - erwachsen. Außerdem geht es in Irland sehr rau und windig zu. Das ist kaum der richtige Ort für sie. Und wozu muss eine elegante Wiener Dracas wie sie denn auch den niederen Tieren befehlen? Sich in einen Wolf oder eine Fledermaus verwandeln können oder gar in einen Hauch von Nebel, der mit dem Sturmwind reist, was ist das schon?« Er versuchte sich an einer wegwerfenden Handbewegung. Die Baronesse starrte ihn an. Franz Leopold spürte selbst, dass in seiner Stimme eine unangemessene Begeisterung schwang.
»Meine Antwort ist und bleibt nein! Ihr geht alle nach Irland. Und nun strapaziert nicht länger meine Nerven.«
»Du hast meine letzte Hoffnung zerstört«, beschwerte sich Anna Christina, als sie die Tür hinter sich geschlossen hatten und gemeinsam den Gang hinuntergingen. »Man hätte ja geradezu den Eindruck gewinnen können, dass du dich auf dieses Jahr freust. Irland! Das ist eine Reise ins Mittelalter - vermutlich gar in die Steinzeit! Das wird noch grässlicher als das rückständige Rom!«
»Ja, vermutlich hausen die dort noch in Höhlen mit Wölfen und Bären zusammen«, stimmte ihr Franz Leopold heiter zu. Die beiden anderen starrten ihn an.
»Du benimmst dich wirklich sehr seltsam«, wunderte sich Anna Christina.
Karl Philipp nickte. »Ja, schon seit wir aus Rom zurück sind. Ist mir auch aufgefallen. Du hast dich doch nicht etwa von diesem ›Nur-gemeinsam-sind-wir-stark‹-Geschwätz anstecken lassen? Sag, du bist noch immer überzeugt, dass wir weit über diesen minderwertigen Clans stehen und sie für immer verabscheuen und verachten werden«, verlangte Karl Philipp.
Franz Leopold lächelte noch immer. »Aber ja - die Vamalia, die Pyras, die Nosferas, die Vyrad und vor allem unsere verachtenswerten Gastgeber in Irland, die in der Steinzeit verhafteten Lycana.«
Das Bild einer jungen Vampirin stieg in seinen Gedanken auf. Ihre langen silbernen Locken glänzten im Mondlicht. Ihr Gewand schien an ihrem schlanken Leib herabzufließen. Sie war klein und zierlich, wirkte aber alles andere als kindlich. In ihren Zügen vermischten sich Schönheit und Harmonie mit der Weisheit, die in ihren türkisfarbenen Augen zu lesen war. Er konnte sogar den weißen Wolf sehen, der nie von ihrer Seite wich.
»Entschuldigt mich«, sagte er und verbeugte sich mit spöttischer Miene, »ich muss Matthias noch ein paar Anweisungen erteilen, bevor wir uns in das harte Schicksal unserer Verbannung ergeben.« Leichten Schrittes eilte Franz Leopold davon, um seinen Schatten zu suchen. Wie jedes Familienmitglied der reinen Blutlinie hatte er einen unreinen Vampir, der ihm zu Diensten war, ihm bedingungslos gehorchen und ihn beschützen musste. Die Unreinen hatten einst als Menschen gelebt, bis sie von einem Vampir gebissen und verwandelt worden waren. Von dieser Nacht an behielten sie ihre Erscheinung für alle Zeiten unverändert bei, auch wenn sie an Kraft und Erfahrung gewannen, während die Reinen bereits als Vampire geboren wurden und - ähnlich der Menschen - wuchsen und ihr Äußeres veränderten. Nur erstreckte sich die Existenz der Vampire über die Jahrhunderte, in denen ihre Stärke stetig zunahm, bis auch sie den Höhepunkt überschritten hatten. Und wenn die Kräfte und Schnelligkeit nachließen, dann mischten sie sich unter die Altehrwürdigen und überließen es den Jüngeren, das Schicksal des Clans zu führen.
Franz Leopold trat in sein Gemach, wo Matthias dabei war, seinen Reisekoffer zu packen. Bevor Baron Maximilian ihn zum Vampir gemacht hatte, war er Droschkenkutscher gewesen. Er war ein großer, vierschrötiger Mann mit der dunkleren Haut und dem schwarzen Haar der Ungarn und äußerst wortkarg. Doch hatte er inzwischen wenigstens gelernt, mit der Garderobe seines Herrn sorgsam umzugehen. Gerade legte er eines der seidenen Frackhemden zusammen und verstaute es in der Truhe. Matthias sah auf.
»Was wünscht Ihr?«, fragte er, während er nach der schwarzen Frackjacke griff.
»Ich möchte, dass du mir ein Buch besorgst und mit in den Koffer packst.«
»Was für ein Buch? Es gibt viele verschiedene Bücher.« Der unreine Vampir ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
»Das weiß ich auch«, zischte Franz Leopold. »Es muss etwas Besonderes sein. Ach, ich weiß auch nicht so genau.«
»Für Eure Reise nach Irland?«
»Natürlich, sonst müsstest du es ja nicht in den Koffer packen, oder?«
»Vielleicht über Druiden und alte Magie oder etwas über Wölfe? Über ganz spezielle Wölfe?« Sein Tonfall änderte sich nicht und er sah auch nicht von seiner Arbeit auf.
Franz Leopold betrachtete ihn misstrauisch. »Ja, das wäre nicht schlecht. Besorge mir so etwas. Ansonsten brauche ich dich heute Nacht nicht mehr. Pack nur die Koffer fertig und warte dann hier auf mich.«
Ohne ein weiteres Wort drehte sich Franz Leopold um und ging hinaus. Während er über den roten Teppich die Freitreppe zum Hauptportal hinunterlief, fragte er sich, ob Matthias inzwischen nicht mehr gelernt hatte, als seinem Herrn lieb sein konnte. Franz Leopold war selbst für einen Dracas ein meisterhafter Gedankenleser - zumindest für sein Alter. Doch war dies keine Fähigkeit, die er bei seinem Diener gerne sah. Vor allem nicht, wenn seine Fantasien wieder einmal nach Irland vorauseilten und er ihre Stimme hören konnte.
»Leo«, hatte sie ihn genannt, und die Erinnerung an den Klang dieses einen Wortes hütete er wie einen Schatz. Franz Leopold stieß das Portal auf und lief die letzten Stufen hinunter. Er sog die würzige Abendluft des späten Sommertages ein, unter die sich bereits der erste Hauch von Verfall mischte. Bald würde das saftige Grün der Blätter verblassen und sich zu herbstlichem Gelb wandeln. Doch dann würde er nicht mehr unter diesen Bäumen durch die Nacht flanieren, die im Licht der Gaslaternen gespenstische Schatten warfen. Nein, eine andere Landschaft wartete auf ihn, ein anderes Land - eine ganz andere Welt und Ivy-Máire!
Alisa faltete die Hände vor der Brust. Obwohl sie vor Nervosität zitterte, versuchte sie, ruhig liegen zu bleiben, während das Dröhnen der Hammerschläge durch ihren Leib vibrierte. Sie zählte die Nägel, die Hindrik einschlug, um ihre Reisekiste zu verschließen.
»Fertig!«, hörte sie seine Stimme ein wenig dumpf durch das Holz dringen. »Alles klar mit dir?«
»Ja«, antwortete Alisa. »Wenn es doch nur endlich losginge!«
Hindrik lachte. »Du bist über das Jahr schneller und stärker geworden, geduldiger allerdings nicht.«
Sie hörte, wie sich seine Schritte entfernten, und dann wieder die Schläge des Hammers, als er die Kisten ihres jüngeren Bruders Tammo und ihres Vetters Sören verschloss. Der Servient, wie die Vamalia ihre unreinen Clanmitglieder nannten, würde sie begleiten. Hindrik besaß zwar mit seinem blonden langen Haar und den Bartstoppeln an Kinn und Wangen das Aussehen eines jungen Mannes, gehörte aber zu den älteren und erfahrenen Vampiren des Hamburger Clans. Sein menschliches Leben war irgendwann im späten 17. Jahrhundert zu Ende gegangen. So legte Dame Elina, die der Familie der Vamalia vorstand, das Schicksal der drei Erben während ihres Aufenthalts auf der Insel beruhigt in Hindriks Hände.
Endlich spürte Alisa, wie die Kiste angehoben wurde. Der Geruch nach Schlick und Brackwasser nahm zu, und als die Kiste wieder abgestellt wurde, spürte sie das sanfte Wiegen der Schiffsplanken unter sich. Noch hatte die Flut nicht eingesetzt, doch dann würde es endlich losgehen. Sie hatte die Nächte gezählt und nun war es so weit. Die große Fahrt übers Meer konnte beginnen. Alisa war noch nie auf einem Schiff gereist, obwohl die Vamalia in zwei barocken Kaufmannshäusern auf der Wandrahminsel am alten Binnenhafen lebten. Jede Nacht betrachtete sie voller Sehnsucht den Wald aus Masten, Rahen und Wanten, die weit gereisten Schoner und Briggs der Handelsflotte, Barken und Fleuten, die Huker der Hochseefischer und die mit unzähligen Kanonen bestückten Fregatten und Sloops der Kriegsmarine. Nun würde sie in einer Bark übers Meer segeln, einem der großen Hochseefrachtschiffe mit vier Masten, und sie war dazu verdammt, in einer vernagelten Kiste zu liegen. Sie durfte nicht sehen, wie die Matrosen in die Wanten stiegen oder im Takt ihrer Lieder die Schoten um die Winchen zogen, bis der Wind in das Segeltuch fuhr und es wie weiße Schwingen blähte. Alisa spürte, wie sich das Schiff langsam hob. Draußen wurden Befehle gerufen. Das Schwanken verstärkte sich, als die Taue von den Duckdalben gelöst wurden. Der Gesang der Männerstimmen drang bis in den Frachtraum. Dann neigte sich das Schiff nach Lee und nahm Fahrt auf - die Elbe hinunter bis zu ihrer Mündung, in die Nordsee hinaus durch den Kanal und dann hinauf in Irlands Norden!
Die fünfte Nacht auf See brach an. Die Tweedsale hatte die Straße von Dover passiert, war an der Südküste Englands entlanggesegelt und fuhr nun zwischen Wales und Irland weiter nach Norden. Am Morgen hatte sie im Hafen von Dublin angelegt, nun hielt das Schiff auf eine Insel zu, die mitten aus der Irischen See ragte. Als das letzte Licht des Tages schwand, ließ der Kapitän vor der felsigen Küste die Ankerketten hinabrasseln und teilte die Schicht für die Nacht ein. Dann zog er sich in seine Kabine zurück und legte das Schicksal des Schiffes und seiner Fracht in die Hände der Wachen. Wie seine Bark stammte auch der Kapitän aus Glasgow. Die Tweedsale war die erste eiserne Viermastbark, die je gebaut worden war. Sie war viel kleiner als die hölzernen Vorgänger, aber auch wendiger und robuster in den stürmischen Breiten des Nordmeeres. Beruhigt schlief der Kapitän ein. Vielleicht wären seine Träume nicht so friedlich gewesen, hätte er gewusst, was in den Kisten in zwei seiner Frachträume ruhte. Im vorderen Raum war alles ruhig, doch in dem achtern gelegenen regte sich plötzlich etwas. Ein Deckel wurde angehoben. Dann setzte sich eine Gestalt auf und sah sich um. Eine Ratte huschte eilig davon und brachte sich zwischen den anderen Kisten in Sicherheit. Von dort beobachtete sie die Gestalt mit den menschlichen Umrissen, in deren Augen ein seltsam rötlicher Schimmer glomm. Nein, mit einem Menschen hatte sie es hier nicht zu tun. Außerdem hatte die Ratte die Erfahrung gemacht, dass Menschen - wenn ihre Körper erst einmal in geschlossenen Kisten aufbewahrt wurden - sich nicht wieder aus diesen erhoben.
Franz Leopold sah sich um. Es war dunkel im Frachtraum. Ein Mensch hätte nicht einmal die Hand vor Augen erkannt, doch er konnte verschiedene Kisten, Säcke und Fässer ausmachen. Es roch nach feuchtem Holz, nach Salz und Teer, aber auch nach der Ladung. Franz Leopold glaubte, Pfeffer und Anis wahrnehmen zu können, Tee und Kakaobohnen. Er rümpfte die Nase. War das einem Dracas angemessen? Wie ein Sack Pfeffer oder eine Kiste Tee im Bauch dieses Seelenverkäufers transportiert zu werden?
So leise wie möglich schlich er zur Tür. Franz Leopold tastete nach den Gedanken der anderen Dracas, die ebenfalls erwacht sein mussten, sobald die Sonne draußen hinter dem Horizont versunken war. Er wäre gut beraten, seine freudige Erwartung vor ihnen zu verbergen, damit sie nicht bemerkten, dass einer ihrer Schützlinge sich gerade davonmachte. Vor allem Matthias zu täuschen, war nicht leicht.
Geräuschlos schloss Franz Leopold die Tür und blieb dann noch eine Weile in dem dunklen Gang stehen. Im Frachtraum regte sich nichts. Gut! Sie glaubten ihn noch immer in seiner sicher vernagelten Transportkiste. Ein überlegenes Lächeln huschte über sein Gesicht. Der neue Unreine in Wien hatte seinen Drohungen und einem üppigen Bestechungsgeld nachgegeben und für seine Kiste viel zu kurze Nägel verwendet, die den Deckel nicht richtig verschlossen. Leichtfüßig eilte Franz Leopold die steile Leiter empor und dann einen Gang entlang. Zwei Bordwachen kamen ihm entgegen, doch das beunruhigte ihn nicht. Menschen waren so blind in ihrer Zuversicht, dass es das, was sie nicht wahrhaben wollten, auch nicht geben konnte.
Der Vampir drückte sich in eine Nische und ließ die beiden Männer passieren. Der Geruch von warmer Haut und Schweiß stieg ihm in die Nase und erinnerte ihn allzu deutlich an seinen Hunger. Er spürte, wie sich seine Eckzähne vorschoben, und konnte nur mühsam dem Drang widerstehen, den beiden zu folgen und sich ihr Blut zu nehmen. Wenn er das tat, riskierte er weit mehr als eine Rüge für das unerlaubte Verlassen seines Sarges. Jungen Vampiren war es verboten, auf die Jagd zu gehen und Menschenblut zu trinken. Dass dies nicht nur eine grausame Schikane der Älteren war, sondern dem Schutz der Jüngeren diente, hatte Franz Leopold selbst schmerzhaft erfahren müssen. Seine Gier hätte ihn fast mit in den Tod gesogen! Und nun, da er einmal die Süße menschlichen Blutes gekostet hatte, war der Verzicht noch grausamer. Franz Leopold schluckte trocken und wandte sich mit einem Ruck ab. Daran durfte er jetzt nicht denken. Er wollte nur für eine Weile der engen Kiste entgehen und die Freiheit der Nacht genießen.
Er stieß die Tür auf, trat an die Reling und ließ den Blick erst um den Bug, zurück zum Heck und dann zu den vier Masten mit den festgezurrten Segeln hinaufgleiten. Von den Wanten aus musste man einen wunderbaren Blick über das Meer und die Insel haben, an deren Küste sie ankerten.
Franz Leopold griff nach den zu einem Netz verbundenen Tauen und zog sich hoch. Trotz des Fracks und der eleganten Lederschuhe mit den glatten Sohlen bereitete es ihm keine Schwierigkeiten. Er stieg immer höher, bis er die Rah erreichte, an der das oberste Segel des Großmasts befestigt war. Franz Leopold hockte sich auf das gerundete Holz und sog genüsslich die Gerüche ein. Der Mond malte silberne Streifen auf das glatte Wasser, der Nachtwind strich durch sein Haar. Vorn am Bug konnte er die beiden Bordwachen erkennen. Doch sein Blick richtete sich auf eine weitere Gestalt, die hinten durch eine Tür auf das Deck hinausschritt. Der Mond verbarg sich für einige Augenblicke hinter den Wolken und tauchte dann das Schiff wieder in sein Licht. Die Gestalt unter ihm trat an die Reling. Er stutzte. Zwei Dinge fielen ihm auf: Ihr fehlte die warme Aura der Menschen - und sie warf keinen Schatten! Franz Leopold stöhnte. Dann war sein Verschwinden doch nicht unbemerkt geblieben. Nun gut, sollte er nach ihm suchen. Noch hatte ihn der Verfolger nicht erspäht.
Nachdenklich betrachtete Franz Leopold den Vampir unter sich. Warum sah er auf das Meer hinaus, wenn es seine Aufgabe war, ihn zu finden? Und wer war das dort unten überhaupt? Da seine Cousinen sich nicht einmal, wenn sie sich zur Ruhe legten, von ihren ausladenden Kleidern trennten, schieden sie schon einmal aus. Auch Matthias konnte es nicht sein. Dafür war die Gestalt zu schlank. Nun schlenderte sie an der Reling entlang. Nein, Karl Phillip war es ebenfalls nicht, doch die Art, wie sie sich bewegte, war ihm bekannt.
Eine Erinnerung stieg in ihm auf. Erst verschwommen, dann immer klarer. Konnte das möglich sein? Neugierig machte sich Franz Leopold an den Abstieg. Er hatte erst die Hälfte des strickleiterartigen Netzes überwunden, als er bereits sicher war. Noch hatte sie ihn nicht bemerkt. Vermutlich wusste sie nicht einmal, dass sie auf demselben Schiff reisten.
Als er nur noch sieben Seilsprossen über dem Boden war, öffnete Franz Leopold seinen Geist, bis er ihre Gedanken streifte. Er fand nur freudige Erwartung und Erinnerungen an Rom und ein fast kindliches Staunen über die Schönheit der Nacht und das Mondlicht, das silbern von Welle zu Welle sprang und sie an Ivy erinnerte. Doch plötzlich stutzte sie. Noch ehe die Vampirin begreifen konnte, was ihr Misstrauen geweckt hatte, ließ sich Franz Leopold hinter ihr auf die Planken fallen. Sie fuhr herum und riss die blaugrauen Augen auf.
Gemächlich reckte sich Franz Leopold zu seiner vollen Größe und schnippte eine Hanffaser vom Ärmel seiner Frackjacke. »Ah, Alisa de Vamalia aus Hamburg«, sagte er mit näselnder Stimme. »Ich sehe dich überrascht? Ja, es ist mir nicht entgangen, dass deine Sinne so vom Anblick des nächtlichen Meeres gefesselt waren, dass du geradezu sträflich die Beobachtung deiner Umgebung versäumt hast. Du bist über den Sommer nachlässig geworden! Ich hätte dir unbemerkt ins Genick springen können - wenn mir danach zumute gewesen wäre.«
Er betrachtete sie eingehend. Alisa war über den Sommer ein wenig größer und schlanker geworden. Die Wangenknochen schienen deutlicher hervorzutreten. Sie trug eine einfache Jacke über schwarzen Hosen. Das lange blonde Haar mit dem Kupferschimmer hatte sie geflochten und zu einem Knoten hochgesteckt. Nicht gerade eine raffinierte Aufmachung, und doch passte sie zu ihrer etwas burschikosen Figur und den offenen Gesichtszügen.
Sie erholte sich schneller von ihrem Schreck, als Franz Leopold erwartet hätte, und auch ihre Miene beherrschte sie fast meisterhaft. Hätte er nicht ihre Gefühle gelesen, hätte er sich womöglich von ihrer gelangweilt klingenden Stimme täuschen lassen. So aber spürte er die rasche Abfolge von Erschrecken, Überraschung, einem Augenblick der Freude verdrängt von der alten Abneigung, die sie ihm entgegenbrachte.
»Franz Leopold de Dracas, sieh an. Was man in Hamburg nicht so alles in die Frachträume gepackt hat.«
In diesem Moment bemerkte sie den Lauscher in ihren Gedanken und beförderte ihn rüde hinaus. Sie hatte nicht nur gelernt, ihr Herz nicht auf der Zunge zu tragen, auch ihre mentalen Kräfte waren stärker geworden.
»Du bist deinen Aufpassern doch nicht etwa heimlich davongelaufen?«
Franz Leopold konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. »Die Frage kann ich, glaube ich, so zurückgeben. Ich vermute mal, auch du hast nicht die ausdrückliche Erlaubnis, hier alleine umherzustreifen.«
Alisa lächelte zurück. »Nein, die habe ich nicht, auch wenn ich vermute, dass es Hindrik wieder einmal nicht entgangen ist, dass ich entwischt bin.«
»Das kann ich mir denken. Du bist einfach noch nicht so weit! Mein Entkommen hat dagegen keiner bemerkt. Im Gegensatz zu dir bewege ich mich nicht nur völlig lautlos. Ich arbeite auch an einer neuen Technik, die Gefühle und Gedanken beeinflusst.«
»Was soll das heißen: Ich sei einfach noch nicht so weit?« Ihre Stimme war gefährlich ruhig, doch Franz Leopold war sich sicher, dass er sie jeden Moment so weit haben würde, dass sie ihm ihre Wut ins Gesicht schleuderte. Ob sie ihn auch mit ihren Fäusten attackieren würde? Sie war kurz davor. Doch statt ihn anzuschreien oder gar zu schlagen, kicherte sie plötzlich.
»Ah, ich verstehe. Deine neue Technik funktioniert ganz exzellent!«
Franz Leopold fuhr herum. In der Tür, die auf Deck hinausführte, stand Matthias und kam nun auf seinen Herrn zu. Seine Miene war unbeweglich, doch Franz Leopold konnte seinen Unmut spüren. Er war für sein Wohl verantwortlich und musste vor dem Baron Rechenschaft ablegen, wenn ihm etwas zustieß. Doch das kümmerte Franz Leopold nicht. Das war alleine Matthias’ Problem.
»Kommt mit zurück«, sagte der Servient barsch. »Ihr dürft Eure Kiste während der Reise nicht verlassen.«
»Was erlaubst du dir!«, beschwerte sich Franz Leopold mürrisch, wagte aber nicht zu widersprechen. Er konnte es nicht riskieren, sich vor Alisa zu blamieren. Womöglich würde Matthias ihn einfach packen und nach unten schleppen.
Alisa hob die Hand und winkte ihm lässig zu. »Also dann, viel Spaß in deiner Kiste. Ich werde noch ein wenig die laue Nacht genießen.«
»Das glaube ich nicht«, gab Franz Leopold betont liebenswürdig zurück. »Sieh mal, wer da kommt.«
»Hindrik!«, stöhnte Alisa, ohne sich umzudrehen. Die beiden Servienten nickten einander zu, und Hindrik forderte seinen Schützling auf, ihm zurück in die Frachträume zu folgen.
»Dann sehen wir uns bald wieder«, sagte Alisa und hakte sich bei Hindrik unter.
»Ich fürchte, das lässt sich nicht vermeiden«, antwortete Franz Leopold, doch seine Stimme klang nicht so abweisend wie seine Worte. Er sah den beiden nach, bis sich die Tür hinter ihnen schloss, dann erst folgte er Matthias aufreizend langsam nach unten.
DUNLUCE CASTLE
Heute Nacht würden sie Dunluce Castle erreichen. Endlich! In Belfast waren ihre Kisten ausgeladen und dann von einem Küstensegler übernommen worden. Alisa dachte zu Beginn, es müssten Fischer sein, die den Weitertransport übernahmen, zumindest war das Erste, was ihr in die Nase stieg, der durchdringende Gestank nach Fischresten, doch dann nahm sie noch einen anderen Geruch wahr. Vampire! Fremde Vampire, die weder zu ihrer Familie gehörten noch zu den Wiener Dracas. Das konnten nur Boten des irischen Lycana-Clans sein! Familienangehörige von Ivy und Mervyn. Ob sie gar selbst mitgekommen waren, um sie abzuholen? Ungeduldig trommelte Alisa mit den Fingernägeln gegen den Deckel ihrer Kiste. Zu ihrer Überraschung hörte sie, wie die Eisenstifte herausgezogen wurden. Dann klappte der Deckel auf und sie sah in ein unbekanntes männliches Gesicht. Es war länglich und hager mit eingefallenen Wangen. Obwohl die faltige Haut wettergegerbt schien, war sie so weiß wie Alisas. Nur eine Narbe am Hals hob sich als rötlich gezackte Linie ein wenig ab. Sein Haar war lang und ebenso farblos wie seine Bartstoppeln. Er schien außergewöhnlich groß und streckte ihr nun einen seiner kräftigen Arme entgegen. Seine Hand schloss sich mit festem Griff um die ihre.
»Willkommen an Bord der Cioclón«, sagte er mit rauer Stimme und zog sie mit einem Ruck hoch. Erst als Alisa die Planken unter den Sohlen spürte, ließ er sie los und trat einen Schritt zurück. »Mein Name ist Murrough, was so viel wie ›Kämpfer des Meeres‹ bedeutet, und das war ich früher einmal. Auch wenn mich die Engländer abfällig einen Piraten nannten!« Er spuckte über die Reling.
Alisa sah sich um. Das einer Schnigge oder Kuff ähnliche Schiff hatte eineinhalb Masten mit einem Gaffelsegel und zwei Vorsegeln. Der Rumpf der Cioclón war breit und platt und wurde von zwei Schwertern zu beiden Seiten stabilisiert.
»Ich habe die Aufgabe, euch sicher nach Dunluce Castle zu bringen«, fuhr der Bootsführer fort. »Also lasst uns zusehen, dass wir genügend Wind in den Segeln haben, um noch vor dem Morgengrauen anzukommen.«
Trotz des Willkommensgrußes konnte Alisa kein Lächeln in seiner grimmigen Miene entdecken. Seine Augen glommen in tiefem Rot. Er wandte sich ab und gab drei weiteren Vampiren knappe Befehle.
Alisas jüngerer Bruder Tammo, der wie die anderen ebenfalls aus seiner Reisekiste befreit worden war, trat an ihre Seite und sah dem Vampir nach. »Ist er nicht unglaublich?«, raunte er. In seiner Stimme schwang Bewunderung und ein wenig Furcht.
Alisa folgte seinem Blick. Hindrik trat nun zu ihm. Sie wechselten ein paar Worte und standen dann in einträchtigem Schweigen zusammen am Bug, um den die nächtlich schwarze See in weiße Gischt zerstob. Nein, feindselig gegenüber den anderen Familien schien Murrough nicht zu sein. Oder akzeptierte er Hindrik nur deshalb, weil der in seinem früheren Menschenleben ebenfalls zur See gefahren war?
Alisa schlenderte zu Franz Leopold, der sich ein wenig abseits von seiner Familie über die Reling beugte. Auf dem einfachen Fischerboot war der elegante Aufzug der Wiener geradezu lächerlich. Schweigend stellte sie sich neben ihn. Die Nacht heute war stürmisch und nur ab und zu schimmerte das Mondlicht für einen Moment zwischen den Wolken hindurch. Die Küste mit ihren felsigen Klippen, die mit sandigen Buchten wechselten, ließ sich nur erahnen.
»Wenn ich euch so betrachte, dann bin ich mir sicher, die Dracas werden eine aufregende Zeit in Irland verbringen!« Sie unterdrückte ein Lachen.
»Oh ja, das werden wir«, erwiderte Franz Leopold ernst. »Ich kann es kaum erwarten.«
Verwundert betrachtete Alisa ihn von der Seite, doch sie konnte nicht einen Hauch von Ironie entdecken.
»Cowan, wach auf!« Sein Vater schüttelte ihn an der Schulter. »Ich brauche heute Nacht noch einmal deine Hilfe.«
Der Junge schlug die Augen auf und gähnte. »Was gibt es?« Ein rascher Blick auf den Spalt zwischen den schweren Vorhängen, die die Zugluft abhalten sollten, zeigte ihm, dass es noch finstere Nacht war. Mit einem Mal war der Junge hellwach und schlug die Decke zurück. »Sind die Männer zurück? Was soll ich tun?«, fragte er eifrig, während er nach seinen groben Holzschuhen angelte.
Myles schien einen Augenblick zu überlegen, ehe er seinem Sohn antwortete. Dann sagte er mit Bedacht: »Ja, es kommen einige Freunde, die durch den Süden gereist sind, um etwas zu besprechen.«
Cowan zog einen dicken Pullover aus Schafswolle über den zerschlissenen Kittel, in dem er geschlafen hatte. Neben dem Muster der Familie hatte die Tante seine Initialen eingestrickt, wie es bei vielen Fischerfamilien üblich war. Zusammen erleichterten sie nach einem Unglück, die Toten zu identifizieren, die oft erst Tage später ans Ufer gespült wurden, wobei Cowan nicht fürchtete, dass sein Pullover ihm einst diesen Dienst erweisen musste. Myles fuhr mit seinem Boot nur auf den Lough Corrib hinaus, der sicher auch seine Tücken hatte, aber nicht mit der launischen See zu vergleichen war.
Cowan angelte nach seinen Hosen. Die Säume waren ausgefranst und schmutzig, doch das kümmerte weder ihn noch seinen Vater. »Kommen sie hierher ins Haus?«
Myles schüttelte den Kopf. »Nein, wir werden uns in einer verlassenen Hütte bei der Mine oben treffen.«
Cowan nickte mit ernster Miene. »Ja, hier ist es zu auffällig. Nicht alle Nachbarn denken wie wir. Zu oft war Verrat der Untergang, bevor es überhaupt begonnen hat.« Myles sah seinen Sohn voll Erstaunen an.
»Was ist? Denkst du, ich bin ein naiver Junge, der nicht weiß, was vor sich geht? Ich bin vierzehn, und ich bin ein Mann, der mit euch kämpfen kann!«
»Ein Mann? Du? Vielleicht in deinen Träumen!«, mischte sich eine helle Stimme ein. Vater und Sohn fuhren herum und starrten das Mädchen an, das barfuß und in einem langen Nachthemd in die Kammer trat. Die beiden warfen einander betretene Blicke zu.
»Nellie, wir wollten dich nicht aufwecken. Geh wieder in dein Bett und schlafe.«
Das Mädchen blickte vom Vater zu ihrem Zwillingsbruder, der ihr bis auf das kürzere Haar sehr ähnlich sah. Beide hatten rötliches, lockiges Haar, blaue Augen und ein Gesicht voller Sommersprossen. Ihre Mutter hatte die Geburt der Zwillinge das Leben gekostet, und so hatte Myles es mithilfe seiner Schwester, die nur ein paar Häuser weiter lebte, übernommen, die Kinder aufzuziehen.
»Ah, die großen Geheimnisse treiben euch wieder in die Nacht hinaus«, sagte sie.
»Wie kommst du denn auf so was?«, stotterte ihr Vater.
»Pa, du trägst Stiefel und die lederne Jacke, dein gepackter Rucksack steht hier an der Tür, und mein morgenfauler Bruder Cowan kann es gar nicht erwarten, dir in die finstere Nacht hinaus zu folgen!«
»Die Fische beißen im Morgengrauen am besten«, wollte ihr Vater sich ein letztes Mal herausreden.
»Pa, versuche nicht, mich für dumm zu verkaufen!«
»Wann seid ihr nur so …«
»… erwachsen geworden?«, ergänzte Nellie, obwohl das vermutlich nicht das Wort war, das ihr Vater gesucht hatte. »Jedes Jahr ein Stückchen mehr!«, sagte sie ernst und tätschelte Myles den Arm. »War das nicht euer Ziel? Dass wir gedeihen und schnell erwachsen werden? Nun sind wir so weit und können dir mehr Hilfe als Last sein. Freu dich darüber.«
Myles zog eine Grimasse.
»Wir sollten aufbrechen«, drängte Cowan. »Geh zurück in dein Bett und genieß deinen Schlaf, Schwesterherz«, sagte er und schulterte den schweren Rucksack des Vaters.
»Ja, wir sollten gehen. Und ich werde euch begleiten.«
»Das ist nur was für Männer«, gab ihr Bruder zurück.
»Ach ja? Und warum ist dann Karen unter ihnen?«
Vater und Sohn sahen sich erstaunt an. »Woher weißt du das?«, stieß Myles hervor.
»Ach Pa, ich habe Augen und Ohren im Kopf und einen durchaus scharfen Verstand, der eins und eins zusammenzählen kann - auch wenn ihr Männer das nicht wahrhaben wollt. Wartet, dann ziehe ich mir was Warmes über. Ich brauche nur einen Augenblick.«
Myles ging mit schweren Schritten auf seine Tochter zu und legte ihr den Arm um die Schulter. »Ich weiß zwar nicht, wie du von diesem Treffen erfahren hast - wir waren immer sehr vorsichtig …« Nellie schnaubte und verdrehte die Augen. »… doch dann weißt du auch, dass dies kein Spiel ist. Es ist sehr gefährlich, und wenn wir entdeckt werden, kann es leicht tödlich enden. Du weißt, die Engländer verstehen keinen Spaß, das hat uns die leidvolle Geschichte unserer Vorfahren gelehrt.«
»Ich kenne die Geschichte dieses Landes«, sagte Nellie und sah ihren Vater ernst an. »Tante Rosaleen hat mir viel erzählt, über ihren Großonkel, der an Emmets Seite aufgehängt worden ist. Und ich kenne die Geschichte von Robert Emmets Haushälterin, die sie in Dublin eingekerkert und gefoltert haben, obwohl sie selbst niemals eine Waffe erhoben hat! Du siehst, es ist auch für die Frauen gefährlich, wenn sich ihre Männer, Väter oder Brotherren auf dieses Spiel einlassen.« Trotzig hob sie das Kinn. »Und wenn ihr mich schon in Gefahr bringt, dann will ich wenigstens dabei sein und unser Geschick mitbestimmen.« Ihr Vater sah sie noch immer hilflos an.
»Habt ihr an Brot und Käse gedacht?«, fuhr Nellie eifrig fort. »Und es sollte genug Bier und Whiskey da sein. Die Nächte sind kalt und die Männer werden sich aufwärmen wollen. Was steht ihr da und starrt mich an? Los, packt noch einen Rucksack, während ich mich rasch anziehe.« Nellie lief aus der Kammer.
»Na ja, so ganz unrecht hat sie nicht«, meinte Cowan. »Vielleicht sollten wir ihr doch erlauben, uns zu begleiten.«
»Lässt sie mir denn eine Wahl?«, schimpfte Myles. »Wenn ich ihr befehle, hier auf uns zu warten, kannst du darauf wetten, dass sie irgendeine Dummheit anstellt. Dickköpfiges Ding, das sie ist.«
Cowan grinste und rieb sich den Schädel. »Das trifft wohl auf uns alle zu. Von Ma haben wir das jedenfalls nicht, sagt Rosaleen. Sie sei sehr sanftmütig gewesen.«
Ein verklärter Ausdruck trat in Myles’ bärtiges Gesicht, das sonst meist schroff oder abgehärmt wirkte. »Ach meine Heather, sie war eine wundervolle Frau. So herzensgut und weich und …«
Cowan ging hinaus, um noch einen Rucksack mit Essen und Getränken zu packen, wie seine Schwester vorgeschlagen hatte. Er war froh, etwas tun zu können. Wenn der Vater in diese traurige Stimmung geriet, machte ihn das verlegen, und er wusste nicht, was er sagen sollte. Wie konnte er ihn trösten? Schließlich hatte er seine Mutter niemals kennengelernt.
»Seid ihr bereit?« Nellie erschien fertig angekleidet und mit einem Bündel auf dem Rücken. Ihre Wangen waren gerötet und ihre Augen glänzten vor Aufregung. »Dann lasst uns gehen!«
Im Schutz der Dunkelheit verließen die drei das Haus am Ufer des Lough Corrib und wanderten auf den Hügel zu, der sich im Westen erhob. Myles hatte darauf verzichtet, die Lampe anzuzünden. Der Mond zeigte ihnen den Weg, der rasch schmaler wurde und sich dann zwischen Moortümpeln und dornigem Gebüsch aufwärts wand.
cbt - C. Bertelsmann Taschenbuch Der Taschenbuchverlag für Jugendliche Verlagsgruppe Random House
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage Originalausgabe November 2008 Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2008 cbt/cbj Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH Alle Rechte vorbehalten SE · Herstellung: ReD
eISBN : 978-3-641-02331-7
www.cbt-jugendbuch.de
Leseprobe
www.randomhouse.de