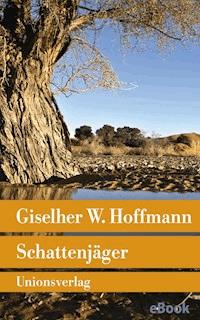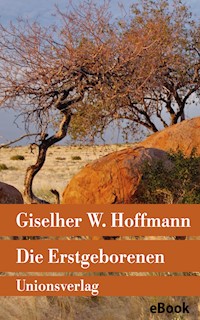
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der alte Eksteen, Betreiber eines kleinen Kramladens in einem trostlosen Ort in Namibia, hat seinen alten Traum, in der Kalahari Diamanten zu finden, nie aufgegeben. Er verkauft alles, was er hat, und baut mitten in der Wüste eine Farm - mit Frau und Sohn und dem Wanderer Hott’nott, der ihm den Weg zum Reichtum, zu den »steinernen Tränen« eines uralten Volkes zeigen soll. Als eine Sippe der Gwi, der »Erstgeborenen«, wie sich die Buschmänner und Buschfrauen nennen, auf der Suche nach Nahrung an der Farm vorbeizieht, kommt es zu einer unheilvollen Begegnung, die nicht nur für die Naturmenschen tödlich endet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Der alte Eksteen hat seinen Traum, in der Kalahari Diamanten zu finden, nie aufgegeben. Er verkauft alles, was er hat, und baut mitten in der Wüste eine Farm. Doch es dauert nicht lange, bis es dort zu einer unheilvollen und folgenreichen Begegnung mit den »Erstgeborenen« kommt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Giselher W. Hoffmann (1958–2016) lebte als freier Schriftsteller an der Atlantikküste Namibias. Mehrere Jahre arbeitete er als Jäger in der Kalahari. Sein Gefährte war lange Zeit ein Gwi, ein »Erstgeborener«, durch den er mit diesem Volk und seiner hohen Kunst der Anpassung an die Natur vertraut wurde.
Zur Webseite von Giselher W. Hoffmann.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Giselher W. Hoffmann
Die Erstgeborenen
Roman
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1991 im Peter Hammer Verlag, Wuppertal.
© by Giselher W. Hoffmann 1991
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30365-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 14:44h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE ERSTGEBORENEN
1 – Vor einem Jahr war der letzte Sturzregen über …2 – Zeit seines Lebens hatte Hermanus Johannes Ecksteen danach …3 – Oom Breed war im Herzen stets ein Geologe …4 – Ich lag flach hingestreckt hinter einer Dünenkuppe und …5 – Johan Ecksteen war ein hagerer Bursche mit einem …6 – Sie zügelten die Pferde am Abend unter einer …7 – Die Pferde galoppierten Kopf an Kopf durch die …8 – Die Riesen, die im Land der wasserlosen Flüsse …9 – Die erleuchteten Fenster nach Osten und Norden hin …10 – Ein Lichtstrahl stach mir in die Augen …11 – Der Alte sei gestern zu Bett gegangen und …12 – Ma kehrte am späten Nachmittag aus Windhoek zurück …13 – Xei hatte den Pfeil auf den Alten gerichtet …14 – Ich war nicht allein: Der Geruch von Schweiß …15 – Die weißen Riesen sind eigenartige Wesen: Sie gehen …16 – Sie aßen ein gebratenes Huhn und tranken dazu …17 – Etwa vierhundertundfünfzig Kilometer nordöstlich von Duineveld liegt das …18 – Die Haushälterinnen, die zu Bankdirektor Gelder ins Büro …19 – Als sich der Himmel im Osten rötete …20 – Ma Ecksteen warf einen Blick in den Rückspiegel …21 – Verstecke die Geheimnisse, die ich dir eben anvertraut …22 – Als die alte Spinne mit der Schildkröte davongeritten …23 – Es war wie im Traum, am Nachmittag ziellos …24 – In der Nacht seiner Initiation hörte Hagao zum …25 – Ich schlief, doch im Traum floh ich durch …26 – Der gutmütigste aller Schwiegerväter döste, als Xei in …27 – Wieder war es ein Breed, der Duineveld aus …28 – Vor vier Tagen hatte Xamnoa zum ersten Mal …29 – Damals war ich ein Tier: Ich bin dem …30 – Der Winter lag im Sterben31 – Im Februar sprang im Nordosten Südwestafrikas, dort …32 – In den Nächten glühte die Kalahari, als sei …33 – Der Kleine Gott Gawama schleuderte eine Handvoll unsichtbarer …34 – Der Schweiß perlte Johan Ecksteen von der Stirn …35 – Xei kauerte in einem metertiefen Erdloch. Die Jäger …36 – Seit mehr als einem Jahr war Johan Ecksteen …37 – Johan eilte wie im Traum durch die Straßen …38 – Der Grenzzaun erglühte. Doch als die Sonne gleich …39 – Als der Wecker auf dem Schemel neben Johan …40 – Die Tage zogen an mir vorüber wie Springböcke …41 – Johan war beim Außenposten auf einen Kameldornbaum geklettert …42 – Tsodo folgte den Fußspuren mit raumgreifenden Schritten …43 – Der alte Mann saß nach Geschäftsschluss gern auf …44 – Johan Ecksteen hatte sich vorgenommen, den Gwi freundlich …45 – In der mit einer Stalllaterne erleuchteten Milchkammer roch …46 – Die Nacht hatte Himmel und Erde zu einer …47 – Der gute Vorsatz, aus Duineveld einen mustergültigen Betrieb …48 – Meine Elenantilopen sterben nie, auch der Löwe und …49 – Meine Hände schienen Flügel zu sein, so flatterten …50 – Das erleuchtete Schlafzimmerfenster schnitt ein gelbes Rechteck in …51 – Am Abend des dritten Tages, als das Schweigen …52 – Johan Ecksteen lag auf dem Rücken, die Beine …53 – Ich hatte eine Weile die Spuren mit einem …54 – Am Sonntag blieb Johan Ecksteen gern noch eine …55 – Zwischen den Büschen verbarg sich ein unterirdischer Bau …56 – Am späten Nachmittag erinnert der tiefrot schimmernde Sand …57 – Der Osten erglühte, so als hätte der Wind …58 – Der Leutnant empfing Syria Landtberg in seinem Büro …59 – Ehe ich verbrannte, rann mir Wasser die Kehle …60 – Magdalena und Benjamin hockten vor ihren Hütten auf …61 – In der Nähe des gefesselten Waldes, der das …62 – Ich warne dich, Syria: Wenn einer von euch …63 – Das erste Viertel des Mondes schwamm über dem …64 – Im Morgengrauen, wenn das Gezwitscher der Vögel noch …65 – Als die Tragflächen in zehn Metern Höhe über …66 – Ich weiß es noch ganz genau: Eine Schweißperle …67 – Syria und der Leutnant kehrten am späten Vormittag …68 – Der Wind, der die Wolken aus dem Osten …69 – Der Regen trommelte auf das Wellblechdach, rann die …70 – Ich warf die Tür zu, lehnte mich an …71 – Manchmal, da wache ich mit einem Lächeln auf …72 – Elf Glockentöne schwebten durch die Küche, dann ratschten …73 – Die Kalahari birgt eine Vielzahl an Konturen …74 – Nachdem Hagao den Löwen mit einem Giftpfeil getötet …75 – Wir hatten geschlafen und waren zu Tode erschreckt …76 – Eine Stalllaterne stand auf dem Hochwasserbehälter, um Syria …77 – Das Lager war verlassen. In der Asche spielte …78 – Während Johan Ecksteen vor Schmerz mit den Zähnen …79 – Obwohl sich Trittsiegel, ähnlich wie Fingerabdrücke, kaum voneinander …80 – Syria saß an den Baum gelehnt und blickte …81 – Jeder, der einmal heimlich seine Gefährtin in der …82 – Die Weiber, Hagao und ich hatten den freundlichen …83 – Eine kilometerlange Kameldornbaumreihe schlängelte sich von Nordwesten nach …84 – Wir hatten uns wieder einmal gestritten, Hagao und …85 – Eben noch war der Bohrmeißel durch loses Kalkgestein …86 – Wir vernahmen zwar das Dröhnen des Donnervogels …87 – Die nächsten zwei Tage waren mit Fragen ausgefüllt …88 – Es kostete Tsodo viel Kraft und Geduld …89 – Als Johan Ecksteen die Bohrstelle erreichte, erwartete er …90 – Als die Stimmen des Donnervogels und der vergitterten …91 – Dem Herero waren Wunder nicht fremd …92 – Lass mich los!«, brüllte Johan. »Du sollst mich …93 – Aus der Luft war es gut zu erkennen …94 – Leutnant van Wyk schob sich die Dienstmütze auf …95 – Ich habe die anderen nie wiedergesehen. Vielleicht sind …Mehr über dieses Buch
Über Giselher W. Hoffmann
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Giselher W. Hoffmann
Zum Thema Afrika
Zum Thema Namibia
Zum Thema Wüste
Zum Thema Nomaden
Vor vielen, vielen Regenzeiten lebten die Gwi-Buschmänner in einem Tal, das in der Richtung der untergehenden Sonne von einem Berg versperrt wurde. Aber es war ein freundlicher Berg, denn abends, wenn der Wind aufkam, begann er zu singen und lockte die Gwi und alles durstige Getier in seinen mit Wasser gefüllten Bauch.
Eines Tages jedoch weinte der Berg, und ein Gwi-Buschmann kletterte auf seine Schulter, um ihn zu fragen, warum er so traurig sei. Da sah er in der Ferne seltsame Wesen heranrücken, weiße und schwarze Riesen, die mit silbernen Fäden die Bäume fesselten, steinerne Hütten errichteten und das Antlitz der Großen Dürre von ihren zahmen Elenantilopen und krausköpfigen Gazellen zertrampeln ließen.
Die Gwi und die wilden Tiere rannten in panischer Angst davon. Der Berg aber konnte nicht fliehen. Und so versteckte er sich unter dem Sand.
Seither ist der Berg sehr einsam, und damit die weißen und schwarzen Riesen ihn nicht weinen hören, schluckt er seine Tränen hinunter – steinerne Tränen, in denen die Flammen längst erloschener Feuer brennen.
1
Vor einem Jahr war der letzte Sturzregen über der Kalahari niedergegangen. Die Sonne brannte auf die rostbraunen, nur spärlich mit Gräsern und Akazienbäumen bewachsenen Dünen herab, und der Wind spielte lustlos in dem staubigen Flussbett des Auob. An den Biegungen waren entwurzelte Bäume in den ausgetrockneten Wasserlauf gestürzt; Zeugen einer Flut, die sich damals nach dem Wolkenbruch gen Südosten gewälzt hatte: tosend und weitaus schneller als Benjamin, der mühsam durch den angeschwemmten Sand im Flussbett stapfte und sich mit einem Packesel abmühte.
Benjamin war ein Hottentotte – besser: ein wandernder Händler, der für Wochen, oftmals Monate in der Kalahari verschwand, angeblich, um bei den Buschmännern die von Touristen begehrten Pfeil und Bogen gegen Glasperlen, Blechtassen, Tabak und Taschenmesser einzutauschen. In Wirklichkeit aber war er im Auftrag eines gewissen Hermanus Johannes Ecksteen auf der Suche nach der berühmt-berüchtigten Verlorenen Stadt, die im Jahre 1885 ein Amerikaner namens Farini in der Wüste entdeckt hatte. Bisher war es niemandem vergönnt gewesen, einen zweiten Blick auf die Ruine zu werfen, denn Farini hatte der Welt nichts als eine Landkarte und die Skizze eines runden Monuments inmitten halb im Dünensand vergrabener Bausteine hinterlassen. Und Benjamins Auftraggeber, der einen Gemischtwarenladen in Gochas besaß, wollte der erste Weiße sein, der die Verlorene Stadt wieder zu Gesicht bekam.
Nur ist es so, dass die Buschmänner einem Fremden selten etwas anvertrauen, und dem mageren Hottentotten im beigefarbenen Overall und der leuchtend roten Pudelmütze auf dem Kopf verrieten sie gleich gar nichts, weil sein ewiges Lächeln die Herzen der Gwi-Mädchen verwirrte und in seinen Augen die Lüge wohnte. Erst als Ecksteen dem Hottentotten billigen Branntwein mit auf die Reise gab, gelang es Benjamin, der Kalahari ein Geheimnis zu entreißen, zwar nicht das der Verlorenen Stadt, doch immerhin eines, so glaubte er, das ihm viel Geld einbringen würde.
Obwohl er Durst hatte und seine Füße in den kuduledernen Schuhen schmerzten, gönnte er sich und dem Packesel keine Rast, denn er wollte die kurz vor der Jahrhundertwende von Missionar Rust gegründete Station Gochas vor Einbruch der Dunkelheit erreichen.
Zwei Stunden später verließ er den Auob und kletterte die steile Anhöhe zu einem Kalkplateau hinauf. Dort, am Rande des Abgrunds, lag Gochas, ein winziger Ort im Südosten Südwestafrikas. Im März 1908 hatte Hauptmann von Erchert hier seinen vernichtenden Angriff auf Simon Kopper, den Kapitän der Fransmannhottentotten, gestartet. Benjamin humpelte an der Stelle vorüber, an der damals das Schutztruppenfort gestanden hatte, und bog in die Sandstraße ein, die breit und staubig den Ort in zwei Hälften teilte. An diesem späten Nachmittag war die Straße wie leer gefegt. Er blieb stehen, wehrte die blutende Sonne mit einer Hand ab und musterte die lückenhafte Häuserreihe zur Linken. Sein Blick blieb an einem gelben, flach gestreckten Gebäude am Ausgang des Ortes haften. Er konnte nicht lesen, aber in Gochas wusste jedermann, dass ecksteen-algemene-handelaar auf dem vom Verandadach baumelnden Schild geschrieben stand, und der Hottentotte lächelte, als er sah, dass der Gemischtwarenladen noch geöffnet hatte. Er band den Packesel am Verandapfosten an, stieg unter dem Schild hindurch auf den mit Brettern ausgelegten Bürgersteig und trat, nachdem er kurz an die Holztür gepocht hatte, in den Laden. Es dauerte eine Weile, ehe er im Dämmerlicht Ma Ecksteen erkannte, die auch heute hager und kerzengerade in einem bis zum Hals zugeknöpften Spitzenkleid an der Kasse stand. Hinter dem Ladentisch, den Ma im Laufe der Jahre so blank gescheuert hatte, dass die Linoleumplatte weiß geworden war, lehnten warenüberhäufte Regale an der Wand und boten dem Farmer und Dorfbewohner all das feil, was ein Mensch in der unwirtlichen Kalahari zum Überleben braucht.
Der Hottentotte nahm grinsend seine Pudelmütze vom Kopf: »Ich bin wieder da, Missus.«
»Das rieche ich«, sagte Ma Ecksteen, denn Benjamin hatte sich auf seiner monatelangen Reise nicht einmal gewaschen. Zu ihrem Entsetzen trat der Hottentotte in seinem schmuddeligen Overall bis dicht an den Ladentisch heran.
»Ich muss den Baas sprechen, Missus.«
Ma Ecksteen wich angeekelt an die Regale zurück. »Johan!«
Ein rothaariger Junge steckte den Kopf durch die Verbindungstür, die in den angrenzenden Lagerraum führte. »Ma?«
»Ruf deinen Pa«, befahl sie. »Und du …«, sie wandte sich an Benjamin, »du wartest so lange im Lager. Hier verscheuchst du mir die Kundschaft mit deinem Gestank.«
Im Lagerraum roch es nach Sackleinen, Maismehl, braunem Zucker, Tabak, Kaffee und Waschpulver, und selbst im hintersten Winkel hörte man vorn die alte Kasse bimmeln. Vor allem am Samstagmorgen, wenn die Farmer nach Gochas kamen, um Besorgungen zu erledigen. Schon in der Früh sah man sie auf der Veranda stehen und ihre Pfeifen schmauchen, während die Frauen etwas abseits tuschelten, bis Ma die Türe öffnete. Dann strömten sie lärmend herein, wohl wissend, dass Ma Kaffee gekocht und Zwieback gebacken hatte. Und Pa Ecksteen musste sich hinter dem Ladentisch die Klagen anhören: Ein Farmer hatte keinen Regen bekommen, der andere seinen Zuchtbullen verloren, dem Nächsten war das Bohrloch versiegt, und Oma Hester hatte es auf der Brust, und Tante Martha erwartete wieder, und wenn Pa ihnen Kredit einräumte, sah man, wie sie sich aufrichteten, um der Kalahari erneut die Stirn zu bieten …
Benjamin überlegte gerade, ob er sich vorsorglich ein Paket Zucker und etwas Tabak einstecken sollte, als Hermanus Johannes Ecksteen in das Lager trat.
2
Zeit seines Lebens hatte Hermanus Johannes Ecksteen danach gestrebt, ein erfolgreicher Mensch zu sein, aber bisher war er es nur im negativen Sinn gewesen: Die Eltern kümmerten sich kaum um das rothaarige Kind mit den abstehenden Ohren und den Biberzähnen, denn sie besaßen eine kleine Farm in der Karru und hatten sieben hungrige Mäuler zu stopfen. Als Ecksteen acht war, kam er ein Jahr zu spät in die Schule, weil es mit seinem Wortschatz nicht weit her war, und mit zwölf konnte er immer noch keine Zahlen richtig herum schreiben, außer der Sechs, die so oft in seinem Zeugnis gestanden, dass er sie sich schließlich eingeprägt hatte.
Der kleine Hermanus war nicht dumm; sein Interesse galt vielmehr einem Fach, das in der Schule nicht gelehrt wurde: der Archäologie! Und so stieg er im Traum lieber zu einem Pharao in die düstere Grabkammer als zu einem Mädchen ins Gebüsch, und am Tage kritzelte er anstelle von Zahlen geheimnisvolle Zeichen an die Tafel, die kein Lehrer zu deuten wusste. Und das war sein Pech.
Der Erste Weltkrieg setzte seiner Karriere als Berufsschüler ein Ende. Bis an die Zähne bewaffnet, marschierte der inzwischen zum jungen Mann gereifte Hermanus los, obwohl er nichts gegen die Briten hatte. Es dauerte nicht lange, und Ecksteen wurde in eine Schreibstube versetzt, weil er auf seinem Wachposten eingeschlafen war. Da er sich jedoch mit den Zahlen nicht anfreunden konnte, reduzierte er am Schreibtisch kurzerhand die Schutztruppe auf sechs Mann, die angeblich über sechsundsechzig Karabiner und sechshundertsechsundsechzig Patronen verfügten und denen laut Ecksteens Rechnung am Monatsende ein fürstlicher Lohn von sechstausendsechshundertsechsundsechzig Mark pro Mann zustand. Das fiel dem Schatzmeister auf, und für Ecksteen war der Krieg vorzeitig aus.
Kaum entlassen, legte ihm sein Vater Fesseln an: Die elterliche Farm rief! Doch was Ecksteen am Morgen mit seinen ungeschickten Händen aufbaute, das stieß er am Abend mit dem Hintern wieder um, und als der Zweite Weltkrieg ausbrach, bat ihn der Vater, die Farm im Nordkapland zu verschonen und seine Zerstörungswut stattdessen an der Front auszulassen.
Ecksteen wusste nicht recht, gegen wen er diesmal ins Veld ziehen sollte. Er hatte nämlich im wahrsten Sinn des Wortes den Überblick verloren, denn er war unterdessen so kurzsichtig geworden, dass er auf zehn Schritte seinen besten Freund nicht vom ärgsten Feind hätte unterscheiden können. Ministerpräsident Jan Christiaan Smuts erleichterte ihm die Wahl, indem er Ecksteen eine Brille verpasste und ihn ins Internierungslager steckte.
Etwa zur selben Zeit wurde im kriegszerrütteten Deutschland, genauer in Hamburg, ein Mädchen geboren. Die Mutter, Frau des Kleiderfabrikanten Landtberg, taufte es Syria und war außer sich vor Glück, durfte sie doch hoffen, dass ihre Tochter nie eine Uniform würde tragen müssen. Da Syria zu diesem Zeitpunkt weder sprechen noch laufen konnte, wollen wir das Mädchen aufwachsen lassen und so lange zu unserer eigentlichen Geschichte zurückkehren:
Nach dem Zweiten Weltkrieg erbte Ecksteen die Farm in der Karru und war gerade dabei, sie systematisch herunterzuwirtschaften, als ihm jemand sagte, dass Geld in einer Kasse dürrebeständiger sei als ein Schaf auf der Weide. Er verkaufte die Farm und erwarb in Gochas den Gemischtwarenladen. Doch ihm ging es trotz der Kasse nicht gut, weil er anfangs stets zu viel zahlte und zu wenig für sein Geld bekam, bis er Ma heiratete, die zwar nicht zu ihm passte, aber dafür mit Zahlen umzugehen wusste.
Wie wir feststellen, war Ecksteen weder ein Farmer noch ein Soldat und ebenso wenig ein Geschäftsmann wie der Kleiderfabrikant Landtberg etwa, der unterdessen eine Fabrikkette aufgebaut und seiner Tochter Syria eine Manufaktur in Holland anvertraut hatte.
Wer weiß, vielleicht wäre aus Ecksteen unter anderen Umständen ein respektabler Archäologe geworden, doch jemand, der eine horizontale Acht malt, wird in seinem Leben keine Pyramide von innen sehen. Und so zwang ihn das Schicksal, Rollen zu spielen, die ihm nicht lagen, und um seine Schwächen zu vertuschen, setzte er alles daran, seinen Mitmenschen zu gefallen, indem er sich jeden Samstagmorgen die Ausreden der Farmer anhörte, absichtlich ungezahlte Rechnungen übersah, für astronomische Summen bürgte und so den Laden mehrmals an den Rand des Ruins brachte.
Einmal, das musste man ihm lassen, vollbrachte er ein kleines Wunder: Er zeugte einen Stammhalter! Johan war zwar ein schwaches, winziges Lebewesen, aber immerhin ein Kind, das in die Windeln schiss wie alle anderen Säuglinge auch. Wann immer Ecksteen ins Bad stieg, blickte er stolz an sich herunter und konnte es kaum fassen, dass dieses kleine Ding dort unten so etwas Großes vollbracht hatte.
Nur in seinem Arbeitszimmer, hinter verschlossener Tür und inmitten der vielen Bücher, da war er wirklich in seinem Element. Niemand ahnte etwas von dem ungeheuren Wissen, das er sich selbst angeeignet hatte, und als Benjamin ihm an diesem Nachmittag im Lager das Geheimnis anvertraute, rieselte ihm eine Gänsehaut den Rücken herunter, und das Haar sträubte sich ihm im Nacken vor Glück.
Vorn im Laden hörten ihn Ma und Johan erregt mit dem stinkenden Hottentotten flüstern, Geldscheine wechselten den Besitzer, dann schloss sich Ecksteen in seinem Arbeitszimmer ein, war für niemanden zu sprechen. Erst Stunden später kam er mit einem fieberglänzenden Ausdruck in den Augen hinter dem Stapel wissenschaftlicher Literatur zum Vorschein und verkündete im Esszimmer, wo sich Ma und Johan zum Abendbrot niedergelassen hatten, dass er ihnen etwas mitzuteilen habe.
»Ach?«, sagte Ma und schob sich einen Happen Süßkartoffel in den Mund. Dabei zwinkerte sie Johan belustigt zu, denn sie kannte Ecksteens hochfliegenden Träume und hatte sie bisher geduldet, weil es sich eben nur um Träume gehandelt hatte, die er, sei es aus Zeitmangel oder aus Feigheit, sowieso nicht verwirklichen konnte. Der folgende Satz, den er ihr mit entschlossener Stimme anvertraute, traf sie deshalb völlig unvorbereitet: »Ich werde den Laden verkaufen und dafür Land bei Unions End erwerben!«
Der Bissen blieb Ma in der Kehle stecken. Sie wurde blass und würgte etwas Unverständliches hervor, das aber eindeutig nach einer Frage klang. Und darauf schien Ecksteen nur gewartet zu haben. Er wuchs im Esszimmer zu einer zwei Meter großen Abenteurerfigur heran, die er nicht war, denn er sah eher wie ein Missionar aus mit seinem behäbigen Leib und der fleischigen Nase im runden Gesicht, das bis an die Wangenknochen hoch von einem roten Bart überwuchert wurde. Jetzt klaffte das Gestrüpp auseinander, und Ecksteen sprach kurz und abgehackt, wie es seine Art war: »In der Nähe des Länderdreiecks, dort, wo Südwestafrika, das Betschuanaland und die Union Südafrika zusammentreffen, soll es einen Berg geben!«
Seine Worte schwebten unangefochten im Raum, bis Ma ihre Kehle mit einem Schluck Tee frei gespült hatte: »Aber das ist doch kein Grund, den Laden aufzugeben!«, rief sie, denn für Ma war der Laden das Symbol eines bequemen Lebens, und sie hatte all die Jahre erbarmungslos die Gefahren der Armut abgewehrt, die dem Symbol hin und wieder gefährlich nahe gekommen waren.
Ecksteen schrumpfte in sich zusammen, sodass Ma schon einen hoffnungsvollen Augenblick glaubte, er hätte es sich anders überlegt, da neigte er sich plötzlich vor und verteilte die hervorbrechende Wortflut mit ruckartigen Handbewegungen über den Tisch: »Ich habe immer angenommen, dass es in der Umgebung vom Unions End keine Berge gäbe, sondern nur Dünen, unter denen sich vielleicht Kalkrücken verbergen oder nichts weiter als Sandschichten. Benjamin hat also einen Berg gefunden, wo theoretisch kein Berg stehen dürfte, verstehst du?«
Er erwartete nicht, dass Ma vor Staunen den Mund aufriss – obwohl er sein Leben dafür gegeben hätte, denn sie war eine nüchtern denkende Frau, die keine Fantasie besaß, weder in der Liebe noch in sonstigen Dingen –, nein, ein wenig Interesse hätte ihn schon zufriedengestellt, doch als ihm nur ihr verständnisloser Blick begegnete, den er so an ihr hasste, ließ er die Arme sinken und wandte sich an seinen Sohn, der ihn aus großen Augen anhimmelte und alles wiedergutmachte.
»Es ist keine gewöhnliche Höhle, Johan, mehr eine trichterförmige Blase aus Lavagestein, die mit artesischem Wasser gefüllt ist.« Er nahm seine Hände zu Hilfe, um die Umrisse der seltsamen Entdeckung in die Luft zu hacken, dann beugte er sich wieder über den Tisch. »Weißt du, was das heißt, Junge?«
Ehe Johan den Kopf schütteln konnte oder Ma, die ebenfalls nicht wusste, worauf er hinauswollte, richtete sich Ecksteen auf und sagte etwas von Magma, das Wissenschaftlern zufolge im Erdinneren kocht und brodelt.
»Und weils da unten keinen Schornstein gibt, baut sich ein gewaltiger Druck auf«, fuhr er fort und ballte die Fäuste so fest, dass sie zitterten, und diesmal konnte selbst Ma etwas nachempfinden. »Dabei wird vom Feuer gereinigter Kohlenstoff zusammengepresst und durch eine schwache Stelle in der Erdkruste nach oben gequetscht …«
Ma zischelte etwas.
»Was hast du dem Jungen gesagt, Ma? … Woher weißt denn du, dass Diamanten und Kohlenstoff was miteinander zu tun haben?«
»Ich habe in der Schule aufgepasst.«
Als Ecksteen die Arme wieder hob, um Johan den Rest zu erklären, wirkten seine Gesten verunsichert, aber seine Stimme hatte ihr Feuer nicht verloren: »Der gebündelte Kohlenstoff fließt mit dem Lavastrom an die Erdoberfläche, kühlt ab oder so was Ähnliches und formt dann ebendiesen Stein von unvorstellbarem Wert, nämlich den … na, Johan?«
»Kohlenstoff, Pa!«
»Was hat Ma dir vorhin zugeflüstert?«
»Diamant, Pa?«
»Ja, den Diamanten, Junge.«
»Wie sieht so ein Stein eigentlich aus, Pa?«
»Wunderschön, wie ein versteinerter Tautropfen …«
»Hat Benjamin dir keinen mitgebracht?«
Die Frage war von der Seite gekommen! Sein Schädel ruckte herum, und er starrte Ma wütend durch die runden Brillengläser an. »Nein, das hat Benjamin nicht, aber er konnte mir ungefähr sagen, wo der Berg liegt …«
»Benjamin hat den Berg also gar nicht gesehen?«
»Nein … doch, indirekt schon … ich meine, ein Buschmannmädchen hat ihm genau erklärt, wo der Berg ist.«
In der darauffolgenden Stille entwickelte sich alles so, wie er es befürchtet hatte: Ma saß eine Weile kerzengerade und mit einem verkniffenen Gesichtsausdruck am Tisch, als sei es ihr ein Rätsel, dass ein so leichtgläubiger Narr, wie ihr Mann es allem Anschein nach war, ungestraft herumlaufen durfte, dann zerbröckelte ihre Starre, und sie feuerte eine Salve Fragen auf ihn ab, die er nur zum Teil mit schlagfertigen Antworten abwehren konnte; der Rest beraubte ihn seiner Glaubwürdigkeit.
Bitte, tu mir das nicht vor meinem Sohn an, betete er, obwohl er wusste, dass es zwecklos war, denn Ma glaubte an nichts, was sie nicht mit ihren fünf Sinnen einkreisen konnte. Wie das Geld zum Beispiel: Das knistert, das riecht herrlich schmuddelig, das schmeckt wunderbar bitter, das erfreut das Auge, das gleitet seifig durch die Finger und bringt außerdem Wohlstand. Was war dagegen das Wort eines Hottentotten wert? Nichts!
»Schön, Benjamin ist ein Schakal, aber ich glaube nicht, dass er sich die Geschichte aus dem Daumen gesogen hat. Dazu ist er viel zu beschränkt!«, behauptete Ecksteen und hätte Ma am liebsten geohrfeigt, weil sie ihn, den Herrn des Hauses, zwang, sich vor seinem Sohn zu verteidigen.
»Meinst du nicht, wir sollten der Sache erst auf den Grund gehen?«, fragte Ma.
»Wir müssen sofort handeln, ehe uns jemand die Höhle vor der Nase wegschnappt, denn der Hottentotte hält nur so lange dicht, bis ihm das Geld ausgeht!«, rief Ecksteen und nahm allen Mut zusammen. »Auch wenn wir nur den unterirdischen See finden, wird er den Wert der Farm sofort verdoppeln. Also, was ist, Ma? Willst du mit achtzig immer noch Konservendosen über den Ladentisch schieben oder in wenigen Wochen eine reiche Frau sein?«
Was bei Ma noch nie vorgekommen war, geschah jetzt: Ihr inneres Auge erfasste einen Stein von der Größe einer Zitrone. Sie sah ihn bereits in ihrer Hand liegen, und das funkelnde Feuer darin versprach einen Reichtum, der über die Grenzen ihrer Fantasie hinausragte.
»Hab Vertrauen zu mir«, bat Ecksteen. »Ich tue es schließlich für dich und deinen Sohn, Ma. Du wirst den Lebensabend einmal wie eine Königin verbringen, das verspreche ich dir, und Johan soll studieren, selbstverständlich in Europa, Oxford oder wie das Ding heißt …«
»Also gut«, sagte sie, »ich werde morgen mit oom Breed sprechen.« Alle redeten den Alten mit oom Breed an, obwohl er kein Onkel war. »Natürlich muss er uns ein gutes Angebot machen, sonst …«
Die Erleichterung nahm Ecksteen fast den Atem. Sie hat angebissen!, jubelte er im Stillen, aber nach außen hin tat er skeptisch: »Oom Breed, der pensionierte Geologe, der immer ein Sahnebonbon mitgehen lässt und nie seine Rechnungen bezahlt?«
»Genau der!« Ma lächelte. »Er hat Geld wie Heu. Wenn wir den Laden an ihn verkaufen, treiben wir erstens die Rückstände ein, und zweitens wird er nicht auf den dummen Gedanken kommen, selbst nach Diamanten zu suchen.«
»Was wir hier besprechen, darf unter keinen Umständen aus diesen vier Wänden sickern!«, sagte Ecksteen. »Wenn du deinen Kameraden gegenüber auch nur ein Wort erwähnst, Johan, kannst du dir Oxford in die Haare schmieren, verstanden?«
»Ja, Pa!«
Ma brauchte er nicht zu ermahnen. Sie täte sich lieber die Zunge abbeißen, als einen Diamanten mit einem Außenseiter zu teilen.
3
Oom Breed war im Herzen stets ein Geologe geblieben. Selbst als ihn das Alter aus der Wüste verdrängt hatte und er seine Tage im Schaukelstuhl auf der Veranda verbrachte, dachte er mit Freude an die vielen abenteuerlichen Jahre in der Wüste zurück. Da er aber nie das Erz gefunden hatte, das aus anderen reiche Männer gemacht hatte, warf er nur einen kurzen Blick in die eng mit Zahlen beschriebenen Geschäftsbücher und nannte sich im Stillen einen Narren, weil er sein Leben lang das Geld in der Erde anstatt in den Städten gesucht hatte. Doch oom Breed war auf der Hut, denn jemand, der seinen Laden verkaufen und ausgerechnet in einer Zeit farmen wollte, in der die Maul- und Klauenseuche im Land tobte, der war seines Erachtens entweder pleite oder verrückt.
»Ich will es dir erklären, oom«, sagte Ma. »Wir haben in den letzten Jahren sehr viel verdient, das muss ich zugeben, aber auch verflucht hart dafür gearbeitet, und irgendwann kommt der Tag, dann will man endlich seine Ruhe haben.«
Nun, Breed war es recht. Er glaubte sogar, den größten Fund seines Lebens gemacht zu haben. Erst als Benjamin ein paar Monate später volltrunken in den Laden taumelte, ihm das Geheimnis mit einer alkoholgewürzten Atemwolke ins Gesicht blies und nebenbei um etwas Geld bettelte, dämmerte dem alten Mann, dass die Ecksteens ihn bewusst in dem gottverlassenen Ort festgenagelt hatten, damit er ihnen nicht zuvorkäme … Im Moment betrachtete Breed zufrieden die mit Waren vollgestopften Regale, während sein Sohn Willem, anstelle von Johan, Maismehlsäcke durch den Lagerraum schleppte.
Ecksteen fuhr indes noch am selben Tag nach Windhoek. In der Hauptstadt Südwestafrikas sprach er bei seinem Bankdirektor vor, einem dynamischen Mann namens Gelder. Anschließend eilte Ecksteen ins Grundbuchamt und ließ zwischen den Trockenflüssen Nossob und Auob dreißigtausend Hektar Land auf seinen Namen registrieren, obwohl ihm der Bankdirektor davon abgeraten hatte, denn in diesem Gebiet fiel kaum Regen. Was Gelder nicht wusste, war, dass Ecksteen keineswegs auf Regen, sondern auf Diamanten hoffte.
»Und wie soll die Farm heißen, meneer Ecksteen?«, fragte der Beamte.
»Duineveld!«
An diesem Abend verließ der Hottentotte Benjamin den Ort Gochas, um seine Geschichte in den weit verstreuten Dörfern zu verkaufen, denn er hatte erfahren, dass mit der Gier viel Geld zu verdienen war.
Bereits eine Woche später zog die Familie Ecksteen gen Osten in Richtung auf das Länderdreieck, wo heute Botswana, Namibia und die Republik Südafrika aufeinandertreffen. Zwanzig Kilometer südwestlich vom Unions End, der Nordspitze Südafrikas, trat Ecksteen unvermittelt auf die Bremse, kletterte aus dem mit Hausrat und Möbeln beladenen Ford und breitete die Arme aus. »Das ist Duineveld!«, rief er und riss die Arme und damit das umliegende Land an sich. »Das gehört jetzt alles uns!«
Ma war froh, dass sie saß, denn sie umschloss ein Land, so verlassen und öd, wie sie es nie für möglich gehalten hatte. Es gab nicht das geringste Anzeichen einer Zivilisation. Auf den von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Sandhügeln wuchs der harte, kniehohe Dünenhafer in dichten Büscheln, und in den Tälern wiegten sich zwischen den Akazien und Grewiasträuchern die Aristidagräser, das Krug-, Strauß- und Federgras. Die Kalahari sah wie neugeboren aus, und die Nachwehen eines Sturmes, der alle Spuren ausgewischt hatte, waren noch im anhaltenden Ostwind zu spüren. »Wo werden wir wohnen, Pa?«
»Wo du willst!«, antwortete er und ließ seine Hand über die roten Hügel flattern. »Komm, such dir ein hübsches Plätzchen aus!«
Da stand Ma nun im Spitzenkleid auf einer Düne; trotz der Hitze bis oben hin zugeknöpft und sorgfältig darauf achtend, dass der Wind ihr um Gottes willen nicht ihre nackten Waden entblößte. Plötzlich wusste sie, wo sie wohnen wollte: in dem Haus hinter dem Laden! »Hier …«
»Schön, bleiben wir also hier!«
»Hier gibt es doch gar nichts, wollte ich sagen«, flüsterte sie, den Tränen nahe, doch inzwischen war Ecksteen bereits die Düne hinabgerannt und befahl Johan, das Zelt unter einem Kameldornbaum aufzustellen.
»Wir werden natürlich nur zeitweilig darin wohnen, Ma«, versprach er. »Sobald ich den Berg gefunden habe, baue ich dir einen Palast!«
Ma wünschte sich, sie könnte den Enthusiasmus der beiden Kinder teilen, denn das war Ecksteen in ihren Augen über Nacht geworden: ein vor Eifer übersprudelnder Lausejunge!
»Wo ist der Berg?«, rief sie in das Tal.
»Gib mir eine Woche, Ma!«
Als die Weihnachtsferien vorüber waren und die Ecksteens ihren Sohn in Windhoek wieder dem Schülerheim überlassen mussten, hatte er den Berg immer noch nicht gefunden. Dabei war er den Tierfährten kreuz und quer durch das Land gefolgt, hatte den Flug der Wachteln beobachtet und nach Bienenschwärmen und dem Abdruck zierlicher Fußspuren Ausschau gehalten. Aber er entdeckte nur eine versiegte Quelle in einem ausgetrockneten Seitenarm des Nossob.
Aus der energischen Ma wurde eine frühzeitig alternde Frau, die mehr im drückend heißen Zelt auf dem Feldbett lag und ihrem Laden nachtrauerte, als sich von Ecksteens Träumen in den Himmel tragen zu lassen. Und da Ecksteen der kindliche Glaube fehlte, mit dem Johan das Feuer seiner Begeisterung stets aufs Neue geschürt hatte, beschlich ihn allmählich Angst. Er versuchte, seine Frustration mit Wildern im kalahari gemsbok national park abzureagieren, doch sooft er in das Lager zurückkehrte und Ma vor sich hin brüten sah, waren alle Anstrengungen umsonst gewesen.
Sie geht mir ein wie eine Blume, dachte er besorgt, und eines Morgens hielt er den Anblick nicht mehr aus. Er schwang die Beine entschlossen aus dem Feldbett. »Ich werde dir ein Haus bauen«, sagte er. »Steh auf, Ma, wir fahren in einer Stunde nach Gochas.«
Dort standen sie unter dem Vorbau ihres ehemaligen Ladens, und er rauchte seine Pfeife, wie es alle Farmer taten, doch sie schmeckte ihm nicht, als er den betrübten Blick seiner Frau gewahrte und das neugierige Pack ringsum ihn anstarrte, näher schlurfte und schließlich mit Fragen überschüttete, die ihn zum Lügen zwangen, weil er keine Ahnung von der Farmerei hatte und schlecht zugeben konnte, dass er einem Berg nachgerannt war, der möglicherweise gar nicht existierte.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis oom Breed endlich die Ladentür öffnete, zumindest kam es Ecksteen so vor.
»Das ist aber eine nette Überraschung!«, rief Breed, und im Laden, während er ihnen Kaffee einschenkte, in dem nur ein Löffel Zucker schwamm statt der drei, die Ma ihren Kunden angeboten hatte, fragte er, wie ihnen das Farmleben denn schmecke.
»Wie der Kaffee«, murmelte Ma, was Breed aber nicht hörte, weil Ecksteen im gleichen Moment behauptete, er sei nie im Leben glücklicher gewesen.
»Das freut mich!« Breed wandte sich gut gelaunt an Ma. »Hier hat sich einiges geändert. Ich habe die Preise um zehn Prozent geschnitten, dafür gibts bei mir keinen Kredit mehr. Das hättet ihr auch tun sollen. Der Umsatz steigt und steigt …« Mit einer Behändigkeit, die sie dem Mann nicht zugetraut hätten, flitzte Breed hinter den Ladentisch und rieb sich die Hände. »Was darfs denn sein?«
»Ich möchte die Farm ausbauen – Zäune ziehen, ein Bohrloch schlagen und für Ma ein Häuschen errichten …«
»Kein Problem«, unterbrach ihn Breed. »Mein Sohn ist ein Bohrmeister, ein richtiger Spürhund, sag ich euch. Der findet jede Wasserader! Wenn ihr wollt, schicke ich ihn am Montag nach Duineveld. Selbstverständlich wird er für euch das Baumaterial rausschleppen – kostet nur ein paar Rand extra, na?«
»Lass uns gehen, Pa«, flüsterte Ma. »Mir ist übel!«
Aus dem Baumaterial entstand ein Wellblechschuppen und daneben ein weiß getünchter Zweizimmerblock, an den sich nach Süden hin eine Veranda lehnte, während draußen vor der Haustüre die Bohrmaschine wie ein riesiges, nickendes Stahlhuhn im Sand nach Wasser pickte. Breeds Sohn stieß in achtzig Metern Tiefe auf eine Wasserader, und Ecksteen war heilfroh, als der Windmotor stand und Willem endlich von dannen zog, denn der Junge hatte Ma mit seinem ewigen Gerede, wie gut der Laden gehe und so, zu einem Nervenwrack gemacht.
Ma begleitete Ecksteen immer seltener nach Gochas, um Rinder, Schafe oder Proviant und einmal sogar zwei Pferde zu kaufen. Selbst den geselligen Abenden und dem Gottesdienst blieb sie fern. Irgendwann – er hatte es anfangs gar nicht bemerkt – geriet Ma wieder ins Grübeln, diesmal unter einem glühenden Wellblechdach, und sie tat den Mund nur noch auf, um ihren Mann mit Vorwürfen zu überhäufen, bis das Feuer auch in ihm erlosch und er plötzlich zu frieren begann. Er hüllte sich in einen Mantel, doch das Tuch, obgleich dicht gewebt, vermochte nicht die menschliche Wärme zu ersetzen, die ihm Ma entsagte, und so fröstelte es ihn fortan bei Tag und bei Nacht.
Dann begann der Wasserspiegel im Bohrloch, rapide zu sinken. Ecksteen versuchte notgedrungen, einen Teil der Rinder und Schafe zu verkaufen, doch überall herrschte die Angst vor der Maul- und Klauenseuche, und er wurde die Tiere nur zu einem niedrigen Preis unter der Hand los.
Und als die Weihnachtsferien ihm seinen Sohn zurückgaben, sattelte er die Pferde, schnitt den Grenzzaun auf und ritt mit Johan in das Betschuanaland.
Der alte Ecksteen schenkte den davonhuschenden Antilopen, die gelegentlich vor den Reitern hersprangen, kaum Beachtung, denn er war in die Kalahari geritten, um Menschen zu jagen.
4
Ich lag flach hingestreckt hinter einer Dünenkuppe und wagte nicht, in das Tal zu blicken, aus dem der Geruch eines Mähnenlöwen zu mir heraufwehte. Der Schweiß strömte mir über das Gesicht, versickerte zwischen meinen Gesäßbacken und tropfte aus meinen Achselhöhlen in den Sand, denn Nodima, der allmächtige Gott der Gwi-Buschleute, hat mir das Herz einer schreckhaften Antilope geschenkt.
Bisher war meine Furcht vor dem Gespött der anderen Sippenmitglieder größer als die Angst vor einer Gefahr gewesen. Ich hatte gehofft, dass es auch diesmal so sein würde, aber die Angst wuchs in meinem Inneren zu einem Schmetterling heran, sodass auch meine Beine und Arme zu zittern begannen, als wären sie Flügel, die mich forttragen wollten in ein Land, in dem ein Jäger keinen Durst leiden oder eine Mutprobe bestehen musste, um seinen Hunger zu stillen, sondern in Frieden musizieren und die Bilder vergangener Zeiten an die Felswände malen konnte.
Einst war unser Jagdgebiet solch ein Land gewesen, bis die Sonne es verbrannt und mein Vater Xei uns in die Ferne geführt hatte, um in einem Berg Schutz vor der Dürre zu suchen. Außer Xei wusste keiner aus unserem Clan, wo sich der geheimnisvolle Berg im Land der wasserlosen Flüsse befand, denn als Xei ihn entdeckte, hatte er noch nicht der Sippe meiner Mutter angehört.
Xei war ein guter Jäger, und es gab niemanden, der an seinen Worten zweifelte, doch ein Weg wird mühsam, wenn nirgendwo ein Baum wächst, den man kennt und der einem sagt, dass man bald am Ziel ist!
Und nun lagen wir in einer langen Reihe hinter der Düne. Ich überlegte, wie ich die Angst überwinden könnte. Das Schlimme an dieser Art von Jagd ist das Warten. Sie gibt einem zu viel Zeit zum Nachdenken. Ich glaube, hätten wir den Löwen sofort vom Aas vertrieben, wäre ich weitaus mutiger gewesen. Aber wir mussten uns zurückhalten, bis das Raubtier gesättigt war, denn wenn man einen hungrigen Löwen von seiner Beute verjagt, geht der Kampf um das Fleisch selten ohne Tote und Verletzte aus …
Ich hätte nicht daran denken sollen! Ich hätte meinen Kopf mit einer Leere füllen sollen, wie es all die anderen Jäger auch taten, aber ich sah damals oft Bilder vor meinem Traumauge, und ich sah sie so deutlich, als gäbe es sie wirklich. Deshalb habe ich manchmal Angst vor Dingen, die noch gar nicht geschehen sind. Sosehr ich mich nach diesen Bildern beim Malen sehne, weil sie mir bei der Arbeit helfen, so sehr verabscheue ich sie in einer gefährlichen Lage wie dieser, in der ich mich vor vielen Regenzeiten befand.
Ich bin kein guter Jäger, das gebe ich zu, doch niemand konnte dem kleinen Musikbogen klangvollere Töne entlocken oder geschickter eine Elenantilope an die Felswand malen als ich. Mein Ansehen innerhalb der Sippe war groß, denn die anderen bewunderten meinen Lendengurt, an dem mit Farben gefüllte Steinbockhörner baumelten, aber in der Trockenheit ist selbst dem gutmütigsten aller Schwiegerväter ein Jäger lieber, der ihn im Alter mit Fleisch versorgt, als ein Musikant oder Maler, der von den Gaben anderer lebt. Obwohl keiner ein Wort darüber verloren hatte, wusste ich, dass es von dieser Jagd abhing, ob ich das Lager mit Xamnoa teilen durfte.
Xamnoa war ein junges Mädchen. Sie hatte mehr Regenzeiten erlebt, als Finger an meinen Händen sind, und war gerade alt genug, mit ihrem zukünftigen Jäger in derselben Hütte zu schlafen. Und dieser Jäger wollte ich sein, denn Xamnoa hatte mir hin und wieder geholfen, den hellen und dunklen Ocker zu sammeln, ihn im Feuer zu brennen, um den Kalk mürbe zu machen und die Farben zum Leben zu erwecken, dann hatte sie die Masse mit Blut oder der Flüssigkeit eines Straußeneis verrührt, damit meine Felszeichnungen die Sonne, den Wind, den Regen und die Zeit überdauern konnten. Das Malen mit der Feder und einem zugespitzten Knochen schenkte meinem Herzen Freude, aber gleichzeitig machten mich die Farben einsam, denn sie schaffen keine Freundschaften, wie es die Jagd tut. Deshalb sehnte ich mich nach Xamnoas Nähe. Mein Traumauge hatte sie oft an meinem Kochfeuer sitzen sehen, einen Sohn an der Brust und ein Lied auf den Lippen, dessen Worte und Klänge ich selbst erdacht hatte …
»Katuma!«
Ich wandte erschrocken den Kopf. Mein Vater Xei lag eine Armlänge von mir entfernt hinter einem Strauch. Auf seiner Stirn glitzerte der Schweiß wie Tau auf einem verwitterten Stein, und seine Augen, dunkel und wie im Fieber glänzend, musterten mich, keineswegs ängstlich, sondern sorgenvoll. Ich erkannte, dass sein Herz meinetwegen voller Kummer war. Ihm wäre es lieber gewesen, ich hätte mich zu den Weibern gesellt, die hinter uns in Sicherheit warteten. Aber das war nicht möglich: Wenn ich Xamnoa an mein Feuer holen wollte, musste ich mich auf der Jagd bewähren, um den gutmütigsten aller Schwiegerväter zu beruhigen.
Xeis Blick ermahnte mich, gleichzeitig versuchte er, mir etwas von seinem Mut einzuflößen. »Sieh ihn dir an«, flüsterte er, denn er wollte, dass ich mich an den Anblick des Löwen gewöhnte und nicht erschrak, wenn ich ihm gegenübertreten musste.
Ich presste die Hände auf den Boden und stemmte mich aus dem Sand. Mein Magen verkrampfte sich, und die Arme drohten unter mir wegzuknicken, als ich durch die Grashalme zu dem Baum, der einsam im Dünental stand, hinunterblinzelte und den Löwen in seinem Schatten kauern sah: Die Mähne umzüngelte sein Haupt wie Feuer, und das Haar sträubte sich, wann immer er seinen Kopf hinabbeugte und die Reißzähne in das leblose Gnu grub. Über ihm sickerte Sonnenlicht durch das Geäst und malte tanzende Muster auf sein vernarbtes Fell.
»Hast du ihn gesehen?«, fragte Xei. »Seine Zähne sind so stumpf, dass er den Hyänen die Beute stehlen muss!« Die Zunge meines Vaters sprach die Wahrheit, aber er erwähnte nicht, dass der Löwe noch kräftig genug war, um einen Menschen zu töten. »Ein Löwe, der andere für sich jagen lässt, ist kein Löwe mehr! Sieh, er ist allein, weil ihm ein junger Löwe die Weiber weggenommen hat. Hau, wir werden ihn wie einen feigen Geparden verjagen!«
Ich ließ mich rasch wieder auf den Boden sinken, aus Furcht, der Löwe könnte Xeis Stimme vernehmen und mich im Gras entdecken. Xei stieß mich an, dann erhob er sich in die Hocke. Die anderen Jäger folgten seinem Beispiel. Ich warf einen Blick zur anderen Seite, wo mein Bruder Hagao hinter einem Grasbüschel hockte und den Löwen anstarrte. Hagao war jünger als ich, aber Pfeil und Bogen, womit er bisher nur Vögel gejagt hatte, lagen ruhig in seiner Hand. Sein Gesicht verriet nicht, was in ihm vorging, nur die Muskeln in seinem bis auf den Lendenschurz nackten Körper spannten sich: Er wurde selbst zu einem Raubtier, das sich zum Sprung bereit machte!
Der Mut verließ mich wieder, denn mein Traumauge hatte den Löwen nicht nur im Schatten kauern, sondern ihn bereits auf mich zuspringen und mit blutigem Maul und wirbelnden Pranken töten sehen. Erst als Xei mich ein zweites Mal anstieß, diesmal mit einem bohrenden Zeigefinger, rappelte ich mich auf und umklammerte Halt suchend meinen Jagdbogen. Im selben Augenblick sprang Xei auf, und die Jäger stürmten schreiend in das Tal.
Ich wurde mitgerissen. Die Flut der nackten Leiber spülte mich aus meinem Versteck auf den Löwen tief unten in der Senke zu. Der Schmetterling in meinem Inneren erstarrte vor Schreck, als das Raubtier herumwirbelte. Sein Maul und das Haar an seinem Kinn waren blutverschmiert. Der Löwe reichte mir bis an die Brust, so riesig war er, und als sich seine Mähne sträubte, wurde er noch einmal so groß.
Und dann brüllte er. Es hörte sich wie ein hustendes Grunzen an und übertönte das Geschrei der Jäger. Ich hatte das Gefühl, sein Atem schlüge mir wie eine Faust ins Gesicht. Unser Angriff geriet ins Stocken, doch mein Vater stieß einen anfeuernden Schrei aus und trieb die Jäger erneut dem Tod entgegen.
Der Löwe war zwar alt, aber die vielen Regenzeiten in der Großen Dürre hatten sein Herz in einen Stein verwandelt, der keine Angst kennt. Ein zorniges Funkeln erglomm in seinen Augen, und seine Schwanzspitze fegte über den Boden: Ehe ich wusste, was geschah, rannte ich davon. Dabei wollte ich stehen bleiben und den Platz zwischen Xei und Hagao wieder einnehmen, denn jeder Schritt, den ich in meiner Angst tat, trug mich weiter von Xamnoa fort und der ewigen Einsamkeit entgegen.
Der Löwe hatte die Lücke, die ich in der dicht gedrängten Reihe hinterlassen hatte, entdeckt und dahinter mich: einen Feigling! Er warf den Schwanz steil in die Luft. Dann stürzte er in lang gestreckten Galoppsprüngen auf die Lücke zu, bevor Xei und Hagao sie wieder schließen konnten.
Unterdessen rannte ich, den Kopf nach hinten gewandt, die Düne hinauf und sah zu meiner Erleichterung und zu meinem Entsetzen, dass mein Bruder stehen geblieben war. Hagao hob den Bogen. Als der Löwe ihn fast erreicht hatte, schoss er einen Pfeil ab. Gebrüll, Geschrei; keuchend fiel ich in das Gras und blickte zurück: Der Löwe lag von Krämpfen geschüttelt im Sand. Und dicht über der Nasenwurzel ragte Hagaos Pfeil wie ein eigentümliches Horn aus seinem Schädel! Wahrscheinlich war es nur ein Glückstreffer gewesen, doch wer war ich, um die Schießkünste meines Bruders anzuzweifeln? Ich, der fortgerannt war und die anderen in Lebensgefahr gebracht hatte! Die Stille trug die Verachtung der anderen Jäger zu mir herauf. Ich barg mein Gesicht in den Händen und verfluchte das Traumauge, das mich oft Dinge sehen ließ, die mir Angst machten, solche Angst, dass ich meiner Familie Schande angetan hatte. Ich überlegte, was ich tun sollte.
Da ertönte plötzlich ein dumpfes Pochen. Mein Vater stieß einen vogelartigen Schrei aus: das Zeichen für Gefahr!
Hinter mir stürzten die Frauen und Kinder aus dem Versteck. Wir rannten gemeinsam in das Tal hinunter und verschmolzen dort unten mit dem Gras. Nur mein Vater starrte über die Halme hinweg in die Richtung, in der die Sonne untergeht. Das Hufgetrampel kam stetig näher. Kurz darauf sah Xei zwei hellhäutige Riesen über der Bodenwelle auftauchen. Sie hockten auf dunklen Zebras und hielten seltsame Grabstöcke in ihren Händen.
»Götter!«, rief mein Vater, denn er hatte noch nie zuvor einen weißen Riesen gesehen.
5
Johan Ecksteen war ein hagerer Bursche mit einem sommersprossenübersäten Gesicht. Er hatte ernste, blaue Augen, abstehende Ohren und feuerrotes Haar, das in schweißverklebten Büscheln unter dem schwarzen Schlapphut hervorlugte. Trotz der Hitze trug er lange Kakihosen, dazu ein kurzärmeliges Buschhemd. Seine kuduledernen Schuhe steckten bis zu den Absätzen in den Steigbügeln und schaukelten im Takt der stampfenden Hufe hin und her. Manchmal stieß er mit den Schuhspitzen an die Flanken seines Reitpferdes, dann fiel der braune Wallach in einen kurzen, holprigen Passgang. Jeder Schritt entlockte der Wüste einen knirschenden Laut, und die lose herabhängenden Zügel schabten dabei über den unermüdlich nickenden Pferdehals.
Der Junge ließ sich treiben. Sein Blick ruhte auf der Feldflasche, die an einem Karabinerhaken vom Vorderzwiesel baumelte: Er überlegte, wie er einen Schluck Wasser trinken könnte, ohne dass ihn der Alte ertappte. Im nächsten Augenblick biss ihm eine Reitpeitsche in den Rücken. Und als er erschrocken den Kopf hob, blickte er in das zerfurchte Gesicht seines Vaters, der auf einem Rappen wie ein Turm neben ihm aus der Wüste ragte.
»Dein Gaul kommt vom Kurs ab, Johan!«
»Verzeih, Pa!« Der Junge nahm rasch die Zügel auf und schwenkte den Pferdekopf in die östliche Richtung. »Ich habe einen Moment nicht aufgepasst.«
»Träumen gehört in der Kalahari zu einem Luxus, den sich noch nicht einmal ein Narr leisten kann!« Zu seinem Erstaunen schob ihm Johan trotzig das Kinn entgegen. »Passt dir was nicht, Junge?«
»Ich bin durstig, Pa!«
»Auf Duineveld verrecken die Schafe und Rinder wie die Fliegen, und du klagst über Durst?«
»Ich habe seit heute Morgen nichts …« Es klatschte erneut. Der Staub flog in einer roten Wolke von seinem Kakihemd.
»Wir sind nicht zum Saufen hier!«, rief Ecksteen. »Mann, Johan, wie alt bist du eigentlich?«
»Ich werde im Januar siebzehn, Pa!«
»Das habe ich auch angenommen, als du gestern den Springbock mit einem Schuss erlegt hast, aber jetzt, weiß Gott, jetzt denke ich, es wäre besser gewesen, wenn ich dich bei deiner Ma gelassen hätte!«
Johan rieb sich grinsend den Rücken. Er konnte dem alten Mann, der seit ein paar Monaten wie ein vermummtes Ungewitter über jeden hereinzubrechen pflegte, nicht böse sein.
»Pa, darf ich Pa was fragen?«
»Meinetwegen«, brummelte der Alte und schulterte seinen Karabiner.
»Sehnt sich Pa oft nach den Leuten im Dorf?«
»Was?« Ecksteen wandte verblüfft das Haupt. »Was redest du da, Johan?«
»Wir farmen nun schon fast ein Jahr, aber mir ist immer noch, als gehörten wir ins Dorf und nicht in die Kalahari«, gestand ihm der Junge. »Wenn ich die Augen schließe, sehe ich unseren Laden in Gochas vor mir.«
»Es ist das verdammte Vorrecht der Jugend, dummes Zeug zu reden!«, brüllte Ecksteen. »Ich hatte die Plackerei satt und wollte auch mal auf der Veranda stehen, meine Pfeife rauchen und Mas Kaffee trinken!«
»So habe ich das nicht gemeint, Pa!«, sagte Johan. Hastig fügte er hinzu: »Das Farmleben gefällt mir.«
Ma gefällt es nicht, dachte Ecksteen und starrte bekümmert seine unfähigen Hände an. Er konnte sich kaum noch an Mas perlendes Lachen entsinnen, das ihn wohlbemerkt damals zu einer Heirat mit der blonden, dürren Jungfer angestachelt hatte, die meist bis auf die Fußknöchel fallende und eng ihren Hals umschließende Kleider und einen strengen Dutt trug, um seine sehnsüchtigen Blicke abzuwehren. Doch die glücklichen Tage waren unterdessen so tief in seiner Erinnerung vergraben, als hätte es sie nie gegeben. Dafür war der Tag, an dem sich das geruhsame Leben der Ecksteens grundlegend geändert hatte, bis in das kleinste Detail in seinem Hirn eingebrannt …
»Ich habe Angst, Pa.«
»He?« Der Alte schreckte aus seinen Gedanken. »Was hast du gesagt, Johan?«
»Vielleicht hat Benjamin uns angelogen, Pa? Vielleicht ist der Berg nichts weiter als ein Hirngespinst?«
»Jetzt fang du nicht auch noch zu zweifeln an!«, rief der Alte. »Die Buschleute kennen keine Berge, außerdem ist ihre Sprache begrenzt. Sie würden selbst einen Dreckhaufen Berg nennen. Deswegen sind wir ja hinter ihnen her, verstehst du?«
»Aber wieso hat kein anderer die Höhle vor uns entdeckt?«
»In der Kalahari ist kein Platz für Angsthasen, wie sie zu Dutzenden in Gochas herumlungern!«
»Ich dachte nur …«
»Du sollst nicht denken, sondern die Augen aufmachen!«
»Ja, Pa.«
»Ja, Pa, ja, Pa! Hör doch endlich mit diesem ewigen …« Er brach unvermittelt ab, und seine Augen weiteten sich hinter den runden Brillengläsern. »Buschmänner!«
»Wo?« Johan wandte sich suchend im Sattel um. Er gewahrte eine flüchtige Bewegung zu seiner Rechten, dann sah er den Jäger fünfzig Schritte entfernt grüßend eine Hand heben.
»Pass auf, dass dir der Gaul nicht durchbrennt!«, zischte der Alte. »Dort liegt ein toter Löwe. Den Geruch eines Buschmannes mögen die Pferde wahrscheinlich auch nicht leiden.«
»Sieh nur, Pa! Der Jäger hat den Löwen mit einem Pfeil erlegt!«
»Allein bestimmt nicht.« Der Alte nahm bedächtig seinen Karabiner von der Schulter. »Ich schätze, der gelbe Hund hat eine Menge Flöhe mitgebracht.«
Kaum waren seine Worte verklungen, da tauchte der zweite Buschmann aus dem Gras auf. Er war ausgemergelt und wie der erste nur mit einem Lendenschurz bekleidet. Ecksteen hörte ihn etwas sagen. Immer mehr zottige Köpfe hoben sich daraufhin aus dem Gestrüpp, bis schließlich ein gutes Dutzend Buschleute beisammenstanden und abwartend zu den Reitern herüberstarrten.
Der braune Wallach blähte die Nüstern und begann, nervös zu tänzeln. Der Rappe dagegen war es gewohnt, dass Ecksteen von seinem Rücken aus auf fast alles schoss, was sich in der Kalahari bewegte. Und so stand er wie aus Bronze gegossen im Sand, doch diesmal fiel kein Schuss, denn der Alte konnte nirgendwo einen auf ihn gerichteten Pfeil entdecken.
»Sie haben ihre Weiber und Kinder dabei«, murmelte er und ließ den Gewehrlauf etwas sinken. »Jetzt wollen wir doch mal sehen, was sich die Knollenfresser einfallen lassen.«
Ein Jäger löste sich von der Sippe und ging zögernd, mit nach außen gekehrten Handflächen, auf die Reiter zu.
»Er ist wahrscheinlich der Sippenälteste. Behalt ihn gut im Auge, Junge!«
»Ja, Pa.« Seine Stimme schwankte vor Erregung – der Jäger war nicht viel größer als Johan, nur älter. Auf seinem dichten, nach allen Seiten abstehenden Haarpelz lag der Schnee harter Winter, und die Entbehrungen hatten unzählige Falten in sein Gesicht gezeichnet, doch er bewegte sich mit der Anmut eines Leoparden. Plötzlich stieß er schnatternde Laute aus, die weder Johan noch der alte Ecksteen verstanden.
Um die Fremden vollends von seinen friedlichen Absichten zu überzeugen, klatschte er in die Hände und entblößte eine Reihe elfenbeinfarbener Zähne, die wie seine regen, braunen Augen nicht zu dem ausgezehrten Körper passten.
»Was sollen wir tun, Pa?«
Der Alte kicherte. »Kack dir bloß nicht in die Hosen, Junge«, flüsterte er. »Lass ihn ruhig kommen. Mein Gewehr ist geladen.«
Der Buschmann blieb abrupt stehen, die Beine leicht gebeugt, um bei dem kleinsten Anzeichen einer Gefahr wie ein verschrecktes Tier das Weite zu suchen.
»Der Hund hat gute Augen – muss etwas in meinem Gesicht gesehen haben, was ihm nicht gefällt«, flüsterte der Alte und lenkte den Rappen unauffällig mit den Schenkeln vom Buschmann fort. »Halt dich bereit, Johan!«
»Wozu, Pa?«
»Mann, bist du dumm!«
Ehe Johan protestieren konnte, hatte der Alte seinen Hengst mit den Zügeln angepeitscht und jagte, tief über den Pferdehals gebeugt, auf die Sippe zu. Sein schwarzer Hut flatterte im Wind, und die Mantelschöße wehten wie eine Kriegsfahne hinter ihm drein. »Ja!«, schrie er. »Ja! Ja!«
Der Sippenälteste warf sich herum. Im Laufen verteilte er flinke Handzeichen, worauf sich die Sippe teilte und in alle Richtungen davonrannte. Ecksteen kümmerte sich nicht um die Frauen, Kinder und Jungjäger, die zu beiden Seiten an dem Rappen vorüberstürzten: Er hatte es auf den Sippenältesten abgesehen! Mit einem Mal fiel der Jäger in einen Trott, und Ecksteen kam auf seinem Hengst angeflogen, um dem Buschmann den Gewehrkolben zwischen die Schultern zu stoßen – da bückte sich der Sippenälteste und hob seine Waffen aus dem Gras.
Damit hatte Ecksteen nicht gerechnet. Er war so verblüfft, dass er sekundenlang wie gelähmt im Sattel hockte. In der Zeit zog der Jäger einen Pfeil aus dem Baumrindenköcher und legte ihn auf die Bogensehne.
Er will mich umbringen!, dachte Ecksteen und duckte sich hinter den Pferdehals. Während der Hengst schräg an dem Sippenältesten vorbeijagte, versuchte Ecksteen, den Karabiner mit der freien Hand zu entsichern. Dabei verfluchte er seinen Sohn, der weit hinter ihm mal hier-, dann dorthin ritt und anscheinend nicht wusste, was er tun sollte.
»Schieß, Junge, schieß!«, schrie Ecksteen.
Endlich krachte in der Ferne ein Schuss. Als sich der Alte nach einer Weile wieder im Sattel aufrichtete, waren die Buschmänner wie vom Erdboden verschwunden. Nur ein Knabe floh schattengleich durch das Gestrüpp.
»Pa!«, rief Johan, das Gewehr in der erhobenen Faust. »Vorsicht, Pa, sie haben Giftpfeile!«
Ecksteen lachte. Es war ein ungestümes, befreites Lachen, das weit über die Wüste schallte. »Ja!«, rief er. »Ja!«, und trieb das Pferd mit sausenden Hieben an, sodass es in einer geraden Linie über die Sträucher sprang und der Sand in hohen, roten Fontänen unter den Hufen aufspritzte.
Der junge Buschmann warf einen Blick über die Schulter. Ecksteen erkannte eine Angst in den Augen des Jungen, die er bisher nur in den Lichtern von Antilopen wahrgenommen hatte – einen Moment war er geneigt, mit der Erinnerung an ein aufregendes Abenteuer von dannen zu reiten. Er ließ unentschlossen die Zügel sinken, da stiegen die Bilder der Dürre und der hoffnungslosen Ma wieder in ihm hoch: Ecksteen gab dem Rappen die Hacken. Wie ein Wirbelwind tauchte er neben dem Buschmann auf, fegte ihn von den Beinen und trug ihn mit sich fort.
6
Sie zügelten die Pferde am Abend unter einer Ringelhülsenakazie, wo im Schatten der weit ausladenden Baumkrone ihre Deckenrollen und das Kochgeschirr lagen. Ein Karakalpaar hatte sich jedoch nicht vom fremden Geruch abschrecken lassen und war über den Springbock hergefallen, den Johan tags zuvor zerlegt und zum Trocknen in den Wipfel gehängt hatte.
Der alte Ecksteen saß missmutig ab, zerrte den Gwi-Buschmann vom Pferd und nagelte ihn neben der Feuerstelle mit seinem Schuh am Boden fest. »Fessel den Jungen!«, befahl er. Es waren die ersten Worte, die er seit dem Überfall auf die Sippe äußerte. »Nun mach schon, Johan, ich kann nicht die ganze Nacht hier herumstehen!«
Während Johan dem Buschmann mit einem Lederriemen die Handgelenke zusammenband, starrte sie der Knabe wie ein ängstliches Tier an.
»Mann, kann der gucken!«, sagte Ecksteen und drehte sich um – angeblich um auszuspucken –, dann murmelte er beiläufig: »Wenn du fertig bist, siehst du mal nach, was die verdammten Karakals von dem Springbock übrig gelassen haben, ja?«
Ein Teil der Schulterblätter, die Rippen und der Hals waren von den scharfen Zähnen und Krallen der Katzen unversehrt geblieben. Johan häufte das Fleisch auf einen Drahtrost.
»Ja, brats einfach, das geht am schnellsten.« Der Alte reichte Johan den Riemen. »Halt ihn mal, ich werde mich um die Pferde kümmern und Holz holen.«
»In Ordnung, Pa.«
Johan hockte sich an die Feuerstelle. Ohne den Knaben anzusehen, knotete er eine Schlinge in den Lederriemen und streifte sie sich über das Handgelenk. Es war ihm unbehaglich, auf diese Weise mit dem Buschmann verbunden zu sein, wie mit einer Nabelschnur, die ihm die Angst des Jungen vermittelte.
Obwohl sie etwa gleich alt waren, hatte Johan das Gefühl, keinen Gwi, sondern eher ein scheues Raubtier an sich gekettet zu haben, denn von dem Buschmann ging eine natürliche Ungezähmtheit aus, sodass er ihn am liebsten freigelassen hätte, gleich einem Vogel, den man fliegen lässt und der sich seiner wiedergewonnenen Freiheit erfreut.