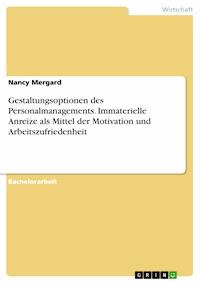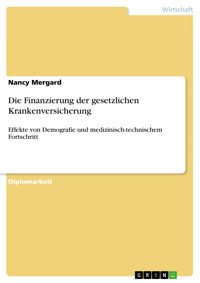
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Gesundheitsökonomie, Note: 2,0, Hanseatische Verwaltungs- und Wirtschafts- Akademie VWA gemeinnützige GmbH, Studienzentrum Hamburg, Veranstaltung: BWL - Wirtschaftspolitik,Gesundheitspolitik,Gesundheitsökonomie, Sprache: Deutsch, Abstract: 1 Einleitung Begriffe wie, Generationenvertrag, Solidarprinzip und Sozialstaatsprinzip bestimmten das deutsche Sozialsystem des vergangenen Jahrhunderts. Die Absicherung eines jeden Einzelnen galt weltweit als Vorreitermodell, niemand brauchte sich Sorgen um seine Existenz zu machen. Durch das Vorhandensein verschiedenster Fürsorgemodelle, entwickelte sich Deutschland immer mehr zum Wohlfahrtsstaat. Das über Jahrzehnte an-haltende Wachstum der deutschen Wirtschaft trübte allerdings die Sicht auf die wahren Zusammenhänge, da die Allgemeinheit sich längst an diese Annehmlichkeiten gewöhnt hatte und diese als selbstverständlich ansah. Zu dieser Zeit suggerierte vor allem das Gesundheitswesen den Beitragszahlern, „Gesundheit kostet nichts“ und förderte das Verständnis einer Vollkaskomentalität. Im Herbst 2004 prangerte der damalige Bundeskanzler Schröder diesen Zustand in aller Öffentlichkeit an und warf den Deutschen eine sogenannte „Mitnahmementalität“ vor. Empörungen folgten, blieb doch der Aspekt unberücksichtigt, dass letztlich die Politiker entsprechend ihrer Entscheidungen diese Vollkaskomentalität erst ermöglichten. Schon Ende der 70er machten Vereinzelte auf die ersten Risse in der „Sozialstaatsfassade“ aufmerksam, genaueres Hinschauen aber vermied die politische Verantwortlichkeit zu dieser Zeit. Erst langsam, dann zunehmend schneller, entwickelte sich ein gesetzlicher Marathon der Kostendämpfungen, welcher bis heute versucht insbesondere im Gesundheitswesen, durch kleine Korrekturen das lieb gewonnene Gesamtsystem aufrecht zu erhalten. Dieser unabänderliche Zustand und die immer tieferen Risse im Fundament des Sozialstaats, erschwerten es geeignete Maßnahmen einzuleiten, um die längst notwendige Reform des Sozialsystems voranzutreiben. Im Duden wird „Reform“ als „Umgestaltung“, „Neuordnung“ und „Verbesserung des Bestehenden“ definiert. Von den verabschiedeten Gesetzen in Verbindung mit dem Gesundheitswesen konnte bislang keines für sich den Anspruch erheben, für eine Umgestaltung oder Neuordnung im Sinne eines notwendigen Strukturwandels zu stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Page 1
Page 4
Aus stilistischen Gründen wird in dieser Arbeit auf eine Verwendung des weiblichen neben dem männlichen Singular bzw. Plural verzichtet. Selbstverständlich sind auch in der konsequenten Verwendung des maskulinen Singulars bzw. Plurals die femininen Substantivformen mitgedacht.
Page 5
Page 1
- 1 -1Einleitung
Begriffe wie, Generationenvertrag, Solidarprinzip und Sozialstaatsprinzip bestimmten das deutsche Sozialsystem des vergangenen Jahrhunderts. Die Absicherung eines jeden Einzelnen galt weltweit als Vorreitermodell, niemand brauchte sich Sorgen um seine Existenz zu machen. Durch das Vorhandensein verschiedenster Fürsorgemodelle, entwickelte sich Deutschland immer mehr zum Wohlfahrtsstaat. Das über Jahrzehnte anhaltende Wachstum der deutschen Wirtschaft trübte allerdings die Sicht auf die wahren Zusammenhänge1, da die Allgemeinheit sich längst an diese Annehmlichkeiten gewöhnt hatte und diese als selbstverständlich ansah. Zu dieser Zeit suggerierte vor allem das Gesundheitswesen den Beitragszahlern, „Gesundheit kostet nichts“ und förderte das Verständnis einer Vollkaskomentalität2. Im Herbst 2004 prangerte der damalige Bundeskanzler Schröder diesen Zustand in aller Öffentlichkeit an und warf den Deutschen eine sogenannte „Mitnahmementalität“3vor. Empörungen folgten, blieb doch der Aspekt unberücksichtigt, dass letztlich die Politiker entsprechend ihrer Entscheidungen diese Vollkaskomentalität erst ermöglichten. Schon Ende der 70er machten Vereinzelte auf die ersten Risse in der „Sozialstaatsfassade“ aufmerksam, genaueres Hinschauen aber vermied die politische Verantwortlichkeit zu dieser Zeit. Erst langsam, dann zunehmend schneller, entwickelte sich ein gesetzlicher Marathon der Kostendämpfungen, welcher bis heute versucht insbesondere im Gesundheitswesen, durch kleine Korrekturen das lieb gewonnene Gesamtsystem aufrecht zu erhalten4. Dieser unabänderliche Zustand und die immer tieferen Risse im Fundament des Sozialstaats, erschwerten es geeignete Maßnahmen einzuleiten, um die längst notwendige Reform des Sozialsystems voranzutreiben. Im Duden wird „Reform“ als „Umgestaltung“, „Neuordnung“ und „Verbesserung des Bestehenden“ definiert. Von den verabschiedeten Gesetzen in Verbindung mit dem Gesundheitswesen konnte bislang keines für sich den Anspruch erheben, für eine Umgestaltung oder Neuordnung im Sinne eines notwendigen Strukturwandels zu stehen5. Werden die finanziellen Auswirkungen der so genannten Reformen beurteilt, ist auch die „Verbesserung des Bestehenden“ gegenwärtig, als fragwürdig zu
1Ludwig Erhard erkannte die Zusammenhänge bereits 1957 bei Einführung der dynamischen Rente durch Konrad Adenauer und kommentierte diese mit „zu sozial wird unsozial“.
2Vgl. ERNST & YOUNG (2005a) S. 8.
3Vgl. Kruse, N. (2006) o.S..
4Vgl. ERNST & YOUNG (2005b) S. 8.
5Vgl. ERNST & YOUNG (2005c) S. 6.
Page 2
2 Problemstellung
Steigende Beiträge, leere Kassen und die in regelmäßigen Abständen immer wiederkehrenden Gesundheitsreformen des Gesetzgebers, verunsichern die Bürger zunehmend und bedrohen das Image der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bzw. des deutschen Gesundheitswesens. Die seit Jahren vorherrschenden Defizite auf der Einnahmen-und Ausgabenseite konnten auch durch verbesserungslobende Reformen, waren es von 1977 bis 2004 siebzehn an der Zahl6, nicht abgebaut werden. Geht es um die Finanzierung der Kassen, also um das Bezahlen von Gesundheitsleistungen, werden der demografischen Entwicklung, dem medizinisch-technischen Fortschritt sowie der Anspruchshaltung der Bevölkerung eine zunehmend einflussnehmende Rolle zugeschrieben. Gleichzeitig werden damit auch die Herausforderungen deutlich, welche für die gesetzliche Krankenversicherung in Zukunft unabwendbar sind. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Hinblick auf die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung mit den Auswirkungen der demografischen Bevölkerungsentwicklung und des medizinisch-technischen Fortschritts und diskutiert darüber hinaus, mögliche Lösungsansätze für eine sichere Gestaltung in der Zukunft. Als Leitfrage ergibt sich auch die folgende Formulierung: „Welchen Einfluss haben die demografische Entwicklung und der medizinisch-technische Fortschritt auf die zukünftige Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung?“ Hierzu werden zunächst einige wichtige Prinzipien der GKV erläutert um eine Grundlage der Funktionsweise dieses Systems zu schaffen. Des Weiteren erfolgt eine Darstellung aus ökonomischer Sicht hinsichtlich der Gesundheit als Faktor
6Barmenia (o.J.a) o.S..