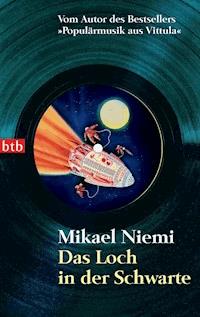2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie würdest du dich verhalten im Angesicht einer Katastrophe?
Hoch oben im Norden Schwedens regnet es schon fast den ganzen Herbst. Und dann zeigen sich im obersten Staudamm des Lule älv tatsächlich Risse. Keiner kann sich vorstellen, dass er brechen könnte. Doch dann geschieht genau das - die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Das Wasser kommt in gigantischen Massen. Ein Tsunami im eigenen Land. Inmitten des Infernos eine Gruppe von Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die nun aufeinander angewiesen sind, wollen sie überleben: Der Hubschrauberpilot, der kurz vor einem Selbstmord stand. Die Künstlerin, die mit ihrer Malgruppe in den Wäldern umherstreift. Die Schwangere, die an einen Schornstein geklammert um ihr Überleben kämpft und von einem anderen Schiffbrüchigen ins Boot gezerrt wird. Zwei Ingenierinnen, die schon lange vor der Gefahr gewarnt haben. Sie alle stehen vor einer gewaltigen Herausforderung: Sie kämpfen nicht nur ums Überleben, sondern auch um ihre eigene Menschlichkeit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
MIKAEL NIEMI
DIE
FLUT
WELLE
Roman
Aus dem Schwedischen von Christel Hildebrandt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die schwedische Originalausgabe erschien 2012unter dem Titel Fallvatten bei Piratförlaget.Dieses Buch ist ein Roman. Das Beschriebene hat sich so nicht wirklich ereignet. Ähnlichkeiten zu lebenden oder verstorbenen Personen oder zu bestehenden Unternehmen sind nicht beabsichtigt, aufgrund der Natur der Sache nicht immer vermeidbarund von der grundgesetzlich geschützten Freiheitder Kunst umfasst.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2012 by Mikael Niemi
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-12157-0V002www.btb-verlag.de
Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen.
1. Mose 6:17
Die Flut schoss von den Felsen herabDas Wasser strömte von den Bergen
Antti Keksis Ballade über die Torneälven-Schmelze 1677
Wozu brauchst du Auto und Haus,Wenn es dir doch so verdammt dreckig geht?
Peps Persson, schwedischer Reggae- und Bluessänger
1
ADOLF PAVVAL WÜRDEeinen richtig schlechten Tag erleben. Tatsächlich sollte der Tag schlimmer werden, als er es sich je hätte vorstellen können. Noch ahnte er nichts und war deshalb guter Dinge und zugleich ein wenig wehmütig, als er in seinem Arbeitsgerät saß, einem Saab 9000 Coupé mit allerlei Sonderausstattung und getönten Seitenscheiben. Der Fahrersitz war ein Traum: ein Sportsitz, der für seinen Körper maßgeschneidert zu sein schien und mit seinem glänzenden schwarzen Kalbsleder gleichzeitig klassische Eleganz ausstrahlte. Seine Hände verschmolzen mit dem Lenkrad; Mensch und Maschine bildeten eine organische Einheit. Genau dieses Gefühl hatte ihn damals den Kredit aufnehmen und zuschlagen lassen.
Im Augenblick fuhr er ein paar Kilometer westlich von Gällivare durch die Landschaft seiner Kindheit, eine der weitläufigsten Wildnisse Nordeuropas. Die Verbindungsstraße wurde »der Weg in den Westen« genannt, aber Adolf Pavval war momentan in östlicher Richtung unterwegs. Die Nacht hatte er oben in seinem goahte bei Kirjaluokta verbracht, er hatte Feuer gemacht, Kaffee gekocht und die Londoner Hektik langsam von sich abfallen lassen. Freunde von ihm nannten das »die Akkus aufladen«. Er selbst meinte, es verhalte sich eher umgekehrt: Ziel war es doch, die Akkus zu entladen, all die angestaute Energie wieder loszuwerden, die Tag und Nacht die Stadt durchpulste. In die Berge zu gehen war, als wüsche man seine Seele. Als spülte man die eigene Unruhe mit dem letzten unbelasteten, reinen Wasser der Erde fort.
Mit einer fließenden Bewegung bog er auf einen Parkplatz mitten in der riesigen Waldlandschaft ab. Hoch gewachsene Kiefern mit herabhängenden Flechten, feuchtes Moos, Findlinge, dahinter das Stuor Lulejaure oder Stora Lulevatten, wie die Schweden es getauft hatten: eine Wasserader, die sich durch die weitläufige Provinz Norrbotten bis zu den zerklüfteten Fjorden der Bottenwiek schlängelte. In aller Ruhe löste er den Sicherheitsgurt, öffnete die Tür und entstieg der angenehmen Wärme der Fahrgastzelle.
Draußen regnete es leicht, fast wie Nebel – eher dunstige Feuchtigkeit, die herumwaberte, als einzelne Tropfen. Er machte ein paar Schritte auf den Randstreifen des Parkplatzes zu und öffnete den Hosenschlitz. Eine zerdrückte Coladose lag halb versteckt im Gras. Adolf pinselte sie mit seinem Strahl, und es klimperte leise, als er versuchte, die Dosenöffnung mit der eingedrückten Lasche zu treffen. Gleichzeitig stieg ein wenig Dampf im Regen auf. Als er fertig war, holte er die Thermoskanne mit dem frischen Kaffee heraus und schenkte sich einen Becher voll ein. Die schwarze heiße Flüssigkeit rann in ihn hinein wie Öl, direkt in seinen Motorblock. Welch ein Genuss, verglichen mit der gefilterten Brühe, die er sich in der City kaufen und durch ein Loch in einem Plastikdeckel schlürfen musste. Das war unwürdig. Aber dort war nun mal das Geld. Noch ein paar Jahre, dachte er, dann hab ich’s geschafft. Dann kann ich anfangen zu leben.
Inmitten dieses Gedankens hört Adolf Pavval das Geräusch. Zuerst meint er, es wäre ein Lkw. Ein dumpf brummender Schwertransporter, der sich nähert. Dann nimmt er an, der Regen würde stärker. Vielleicht ein herannahender Schauer, der auf die Baumkronen niedergeht. Verwundert sieht er sich um. Das Geräusch kommt immer näher. Hinten an der Straßenbiegung sieht er, wie die Kiefernwipfel schwanken, obwohl es windstill ist.
Dann hebt sich die Straße. Nein, es geschieht über der Straße. Ein braungrauer Bergrücken. Er zischt. Schwere, zähflüssige Finsternis. Sie kommt mit irrwitziger Geschwindigkeit auf ihn zu. Wälzt sich heran, verschlingt alles.
Erst jetzt erkennt er die Gefahr.
Adolf Pavval rennt zu seinem Wagen. Er schafft es kaum, rutscht auf den warmen Sportsitz und zieht die Tür hinter sich zu. Der Motor springt an. In einer einzigen eingeübten Bewegung legt er den Gang ein, reißt das Lenkrad herum und gibt Gas. Die Räder drehen durch. Der Berg, voll mit allem Unrat des Waldes, nähert sich wie ein Albtraum. Die Reifen suchen kreischend nach Halt. Als er in den Rückspiegel sieht, ist es hinter ihm vollkommen dunkel.
2
EIN STÜCK NÖRDLICH von Porjus saß Vincent Laurin in seinem Büro in der schlichten Holzhütte, die er vor vierzehn Jahren hatte bauen lassen, als alles noch lief wie geschmiert. An der Front hing immer noch das »Helitours«-Schild. Er hatte davon gelebt, Touristen zu den abgelegensten Gebirgsseen und den Bächen mit den Lachsforellen zu fliegen. Im Herbst waren die Schneehuhnjäger dran. Und das ganze Jahr über die Samen: Transporte zu den Sommerweiden, zur Kälbermarkierung und zum Schlachten. Manchmal war er sogar mit einem frisch erlegten Elch an den Landekufen geflogen. Freiberufler. Freie Zeiteinteilung. Und wenn das Wetter es zuließ, die schönsten Aussichten, die Nordeuropa zu bieten hatte.
Das Schild würde bald abmontiert werden, dafür hatten Hennys Anwälte und Handlanger gesorgt. Aber Vincent Laurin hatte ohnehin nicht vor zu bleiben, um das mit anzusehen. Bald würde er sich auf seinen letzten Flug begeben, der ihn zum Pårtemassiv führen sollte, einem Ort, der ihm viel bedeutete. Dort gegen eine der steilen Felswände würden die Rotoren schlagen und zerbrechen, während er in dem empfindlichen Flugkörper saß. Dieses Ende war das beste, das er sich hatte ausdenken können. Das schönste. Wie ein Königsadler aus den Wolken stürzen, ein Ikarus. Ein paar Sekunden Angst, ja, er würde eine brennende Angst verspüren. Mehrere hundert Meter trudelnden Falls zwischen den Felsen. Dann würde es um ihn herum schwarz werden, eine Lampe, die gelöscht wurde, und alles, was blieb, war eine mit Schrott übersäte Felswand. Rettungsleute in Overalls würden irgendwann dort herumklettern und Spuren sichern. Aber sie würden keine Antworten auf ihre Fragen finden. Kein technisches, kein menschliches Versagen. Kein Alkohol im Körper des Toten. Vielleicht Seitenböen. Oder schlechte Sicht. Sie würden mit ihren Thermoskannen im Schutz der Felsklippen sitzen und überlegen, wie es sich hatte zutragen können. Ein paar Sekunden Unaufmerksamkeit, und dann war er zu nahe dran. Dass ausgerechnet ihm so etwas passieren konnte! Bei seiner Erfahrung!
Es waren bestimmt solche Worte, die bei der Beerdigung fallen würden. Seine Erfahrung. Die unzähligen Flugstunden bei Wind und Wetter. »Die Luft war sein Zuhause.« Die Todesanzeige mit Foto sowohl in der Norrländskan als auch im Kuriren. Und dann all die Zeitungsartikel in Zusammenhang mit dem Crash. »Der bekannte Gebirgspilot Vincent Laurin verunglückte bei einem Hubschrauberabsturz im Pårtemassiv. Seine Leiche wurde gestern geborgen, die Angehörigen sind mittlerweile informiert.«
Die Angehörigen. Lovisa. Sie würden Lovisa anrufen.
Vincent spürte die Kopfschmerzen wie ein pochendes Geschwür direkt unter dem Stirnbein. Am Ballpunkt – genau über dem Augenbrauenbogen, dachte er, mit dem man nach einem präzisen Eckstoß das Leder unhaltbar an Notvikens dümmlich grinsendem Torhüter vorbeiköpft. Es war Jahre her, seit er zuletzt Fußball gespielt hatte – und das längst unter Vereinsniveau. Jetzt war es der Schlafmangel, der dort festsaß. Alte, graue Erschöpfung; Stunden, in denen er sich in dem leeren Doppelbett gewälzt und auf das Morgengrauen gewartet hatte, bis er aufstehen und sich einreden konnte, dass ein neuer Tag begann. Obwohl der alte doch nie ein Ende genommen hatte. Wenn man nicht schlief, gab es keine Zeichensetzung im Leben. Der Tag ging einfach so weiter – ein unendlich langer Satz, der nie unterbrochen wurde. Ein dahinströmendes Wasser, das einfach nur weiterfloss, das niemand aufzuhalten vermochte. Wenn er in sich nur einen Damm hätte bauen können. Die Schleusentore des Nachts schließen. Damit es still wurde.
Die wenigen Momente, in denen es ihm gelang einzudösen, waren göttlich. Wie eine sanfte Nonnenhand auf seiner Fieberstirn. Eine Kühle, die ihm einige Minuten lang Trost spendete. Bis er wieder hochfuhr, ganz so als wäre er verflucht. Ein gefauchter Befehl während eines Wintermanövers, jemand, der herumrannte, der gegen sein Zelt trat, trampelte und herumschrie.
Ab und zu musste man doch aufhören können zu denken. Diese Flut stoppen. Den Film anhalten, einen Punkt setzen, einen Hauch dessen empfinden, was Gnade genannt wurde. Sonst wurde man … ja, verrückt.
Der Schmerz pochte und brummte. Vielleicht sollte er eine Tablette nehmen. Oder sich einen ordentlichen Schluck genehmigen. Oder losschreien, den Mund zu einem Brunnen werden lassen und alles herausspeien, bis der Druck nachließ. Oder bis irgendetwas passierte. Irgendeine Veränderung, was auch immer – nur nicht noch eine weitere Stunde dieser Art.
Henny würde keine Ruhe geben, bis sie ihm alles genommen hatte. Er würde das Haus verlieren. Er würde es sich nie leisten können, sie auszuzahlen, er würde ausziehen und es verkaufen müssen. Ihr Anwalt hatte ihm das erklärt, mit knarrender Stimme, und es war so gewesen, als schnitze man ein Scheit Holz. Stück für Stück war zu Boden gerieselt. Das Auto sollte geteilt werden. Wollte er es behalten, musste er dafür bezahlen, ebenso für die Möbel, den Computer, den Fernseher, die Ferienhütte. Das Schlimmste hatte er sich bis zum Schluss aufgehoben. Die Firma. Henny sollte auch die halbe Firma bekommen. Alles, was er sich aufgebaut hatte, würde sie ihm wegnehmen, wenn sie ging. Noch bevor er überhaupt anfing zu rechnen, hatte er es bereits glasklar vor Augen. Liquidation. Er würde die Firma verlieren und mit ihr sein Leben.
Draußen regnete es, wie es schon den ganzen Herbst geregnet hatte. Es war schon lange kaum möglich gewesen zu fischen. Die Gebirgsbäche waren fast wie zur Frühjahrsschmelze angestiegen. Sie waren reißend und trüb geworden, und die Fische wollten nicht beißen. Auch die Wanderer blieben angesichts des Wetters fort. Im strömenden Regen zu zelten war nun mal kein Vergnügen, wenn man überdies noch nicht einmal die Aussicht genießen konnte. Die Bergkämme lagen hinter tief hängenden Wolken, die Herbstfarben waren verwaschen und grau.
Vincent Laurin trat aus der Holzhütte, stellte sich neben den Hubschrauber, der startbereit am Ufer stand, und schaute über den Luleälven. Er führte Hochwasser – ungewöhnlich viel für den Herbst. All dieses Wasser, dachte er, würde das denn nie ein Ende nehmen? Dann überlegte er, ob er nicht wieder anfangen sollte zu rauchen. Etwas Warmes in der Hand zu halten. Glut. Gesellschaft.
Er holte sein Handy heraus, zögerte aber noch. Lovisa. Er musste einfach ihre Stimme hören. Ein letztes Mal.
»Hallo, ich bin’s«, sagte er, als sie sich meldete.
»Papa! Bist du nicht in der Luft?«
»Doch, gleich. Was machst du gerade?«
»Ich lerne. Wir haben bald Prüfungen.«
»Betriebswirtschaft, oder?«
»Rechnungswesen. Und du, was machst du?«
»Ich bin draußen in der Firma. Ich stehe gerade am Fluss.«
»Ich hab gehört, dass er immer noch ansteigt. Sie machen jetzt sogar die Staubecken auf.«
»Wirklich?«
»Das müssen sie, aus Sicherheitsgründen. Damit es kontrollierbar bleibt.«
»Lovisa … Du solltest wissen …«
»Ja?«
»… dass ich … dass ich so glücklich bin, dich bekommen zu haben.«
»Ach …«
»Dass du zur Welt gekommen bist. Genau du.«
»Das hast du schön gesagt, Papa.«
»Und ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Mit allem.«
»Also … Ich dir auch. Dir auch, Papa.«
So schnell er konnte, beendete er das Gespräch. Sie sprachen normalerweise nicht so miteinander. Womöglich glaubte sie, er wäre betrunken. Erst hinterher, wenn sie die Nachricht erhielt, würde sie sich an ihr Gespräch erinnern. Dann würde sie jedes einzelne Wort wiederholen können und in sich aufbewahren. Weil es seine letzten Worte an sie waren.
»Er hat mich lieb gehabt. Trotz allem. Er war mir nicht böse.«
3
LOVISA LAURIN LEGTE das Telefon beiseite und versuchte, sich wieder ihren Büchern zu widmen. Vielleicht hätte sie es ihm sagen sollen, da er ja ohnehin schon angerufen hatte. Aber sie und Ole Henrik hatten beschlossen abzuwarten. Es war noch zu früh. Es konnte noch zu viel passieren; es könnte sich ablösen. Herausfließen. Es war besser, noch ein paar Wochen zu warten. Sich die Zeit zu nehmen, sich an das Wunder zu gewöhnen.
Jetzt aber zusammenreißen. Kontierungen. Rumpfgeschäftsjahr.
Der Küchentisch war übersät mit Lehrbüchern, Schreibblocks, einer Obstschale und einem Hundekalender. Sie glaubte an eine Art multisensorische Lerntechnik. Je mehr Stimuli, umso mehr Rezeptoren, an denen sich das Wissen festsetzen konnte. Zuerst Querlesen, mit Textmarkern in verschiedenen Neonfarben. Die Schlüsselbegriffe laut in unterschiedlicher Tonlage vor sich hersagen. Sie mit etwas Angenehmem verbinden – Rückstellungen beispielsweise waren ein frisch geschorener Pudel mit weißen Fellpuscheln. Bei Wirtschaftsprüfern sah sie Lapphunde vor sich: wie sie die Rentiere bewachten, an einem Knochen nagten, von einem Schwarm Schneehühner abgelenkt wurden, am Feuer lagen und schliefen, die Pfote über der Schnauze, das Fell nach einer Fahrt hinten auf dem Schneescooter nach Abgasen stinkend. Bei richtig schwierigen Themen schälte sie eine Mandarine, hielt sich die Schale unter die Nase und schnupperte daran. Oder sie biss in eine Banane, am besten in eine richtig überreife: braun und weich mit malzigem, gärigem Geschmack. Oder der Duft, wenn man in einen Rucksack hineinschnuppert: dieses vielschichtige Aroma aus Ruß, Leder, Nadelhölzern, Butter und Fleisch, das in der Frühlingssonne getrocknet wurde.
Verdammt, jetzt bekam sie Lust auf einen Kaffee. Es war der Gedanke an den Rucksack, der Duft einer geöffneten Kaffeepackung, das weckte Erinnerungen. Sie musste eine Kanne Kaffee kochen. Sie konnte gar nicht anders.
Mit einer fließenden Bewegung kippte sie den Rest vom Morgen aus und stellte den Kessel an.
Während sie darauf wartete, dass das Wasser zu kochen begann, dachte sie noch einmal über das Telefonat nach. Der gute alte Papa. Dass er trotz allem angerufen hatte. Auch wenn sie ihm anhören konnte, wie es ihm ging. Mama war wirklich zu hart zu ihm gewesen. Aber auch er selbst hätte es anders angehen müssen, er hätte sich nicht derart darin verrennen dürfen. Das Leben geht weiter, Papa. Es gibt andere Frauen. Du kannst die Welt bereisen, dich wieder dem Leben öffnen. Steig aus diesem verfluchten Hubschrauber.
Erst recht jetzt, da er Großvater wurde. Vielleicht hätte sie es ihm trotz allem sagen sollen. Aber dann wäre Mama sauer gewesen, weil sie es nicht als Erste erfahren hätte. Sie musste vorsichtig zwischen all dem Hass hindurchmanövrieren, mit lang ausholenden Schlittschuhschwüngen die tiefen Furchen im Eis vermeiden. Die Scheidungsfurchen. Sie durfte für keinen der beiden Partei ergreifen.
Wie immer trank sie ihren Kaffee schwarz. Die dunkle Oberfläche glänzte von den Kaffeeölen wie von einer hauchfeinen Dieselschicht. Das Koffein strömte in ihren Körper, und ihre Sinne schärften sich. Warum hatte er überhaupt angerufen? Nur um ihr zu sagen, dass er sie lieb hatte? Sonst nichts? Warum sagte er ihr das ausgerechnet jetzt, wo er es doch nie zuvor gesagt hatte?
Da war irgendetwas nicht in Ordnung. Das Gefühl wurde immer stärker. Irgendetwas stimmte da nicht.
Ich muss zu ihm, dachte sie. Ins Büro. An den Fluss.
4
DAS LETZTE, WAS Henny Laurin in ihrer Ehe getan hatte, ihre allerletzte hausfrauliche Tätigkeit: Sie hatte Salzschnecken gebacken. Zuerst wie üblich ein Teig aus Milch, Butter, Zucker und Weizenmehl. Gehen lassen, ausrollen, mit Butter bestreichen und Zimt darüberstreuen. Und dann, als Tüpfelchen auf dem i, eine ordentliche Handvoll grobes Meersalz darauf. Zusammenrollen und in Scheiben schneiden, als wäre alles wie immer, die Scheiben wie Zimtschnecken aufs Blech legen und mit Ei bepinseln. Dann noch ein bisschen Salz obendrauf. Es sah richtig gut aus, genau wie Hagelzucker. In den Ofen damit, die richtige Backzeit, sie mussten perfekt aussehen, goldene Meisterwerke, sodass einem das Wasser im Mund zusammenlief. Der Schneckenduft verbreitete sich im ganzen Haus, und siehe da, schon kam mit einem Dackelblick der Gatte angetrottet.
»Hast du gebacken?«, murmelte er, obwohl er das ja sehen konnte.
Kein Lob, kein Dankeschön, nichts, was ihr Selbstwertgefühl hätte stärken können. Sie schob das noch heiße Backblech mit den Schnecken neben seinen Kaffeebecher. Lovisa war auch gekommen, sie streckte sich danach, aber Henny hielt sie zurück. »Zuerst Papa.«
Maul auf, Maul zu. Knirschen. Der Duft von Schnecken in der Nase. Es dauerte einen Moment. Dann schienen die Kiefer zu erstarren.
»Aber was zum … Henny?«
Der Blick zum Backblech. Zu Henny. Er suchte nach einer Erklärung, dann nach einer Möglichkeit auszuspucken. Keine Chance, es blieb nur die Handfläche. Seine Miene, sein Hundeblick, einfach unbezahlbar. Und Lovisa, die dasaß und nicht die Bohne verstand.
»Good bye«, sagte Henny.
Das war ihre Abschiedsformel. Auf Englisch. Es war nicht so geplant, es ergab sich einfach. Good bye. The end. Und dann hinaus in die Garage, in der die Taschen bereits fertig gepackt bereitstanden. Sie rief Einar an, er kam mit dem Pick-up, es dauerte nur eine halbe Minute, er hatte hinter der nächsten Ecke gewartet. Eine weitere halbe Minute, dann lagen die Taschen auf der Ladefläche, während Vincent am Küchenfenster stand und zusah. Wie in einem Film, einfach perfekt. Inklusive Abschiedsformel.
»Good bye«, zitierte sie sich selbst immer wieder gern für Einar, und dann lachte er, dass sein Bauch bebte.
Sie teilten den gleichen Humor, Einar und sie. Es war anders als mit Vincent. Dem war so etwas vollkommen fremd. Was immer Leben für ihn war – auf jeden Fall kein Vergnügen. Und an so einem sollte sie kleben bleiben, an einer fleischfressenden Pflanze mit klebrigen Tentakeln.
Sie musste noch ihre Pfingstrosen holen. Die gehörten ihr. Sie war es gewesen, die Kataloge gewälzt und lange Fahrten zu den Großgärtnereien gemacht hatte. Die sie ausgesucht, gekauft und eingepflanzt hatte. Hier oben am Polarkreis konnte man schließlich nicht irgendwelche Pfingstrosen pflanzen, auch wenn sie einen besonders gut geschützten Standort für sie ausgesucht hatte. Die Sarah Bernhardt hatte es leider nicht geschafft. Shirley Temple und die Sibirische hingegen schon. Die Coral Flame überlebte den Winter nur mit Müh und Not, ebenso wie die schwefelgelbe Kaukasuspäonie. Und auch ihr ganzer Stolz, die tapfere, dunkelrote Schmalblättrige Pfingstrose. Ihr hatte sie Jahre ihres Lebens gewidmet. Sie wuchs aber auch grässlich langsam. Es konnten Jahre vergehen, ehe sie überhaupt anfing zu blühen, aber dann wurde sie immer nur noch größer und kräftiger. Königinnen des Gartens, daran bestand kein Zweifel. Pfingstrosen waren sogar schöner als Rosen. Eine gerade erst erblühte, schäumende Pfingstrose, die aus dem seidenfeinen Gewimmel von Blütenblättern nach frisch aufgehängter Wäsche und Honig duftete, während die Ameisen sich an den noch nicht geöffneten Knospen festsaugten. Sie liebte sie wie Kinder. Sie durften nicht kaputt gehen. Vincent war der Pfingstrosen nicht würdig. Das Einzige, was er von Gartenarbeit verstand, war Rasenmähen.
Henny fuhr langsam am Haus vorüber, für den Fall, dass er daheim war. Aber es stand kein Wagen in der Einfahrt, sicher war er an diesem Vormittag zur Arbeit gefahren. Sie musste es riskieren, schnell sein. Käme er doch nach Hause und beschwerte sich, würde sie damit drohen, Einar anzurufen, das wirkte immer. Auch wenn Einar im Augenblick nicht wirklich zu sprechen war. Aber das konnte Vincent ja nicht wissen.
Henny parkte vor der Garage und holte das Werkzeug aus dem Kofferraum. Spaten, Handschuhe, Eimer. Ein Blick zum Küchenfenster – alles schien still zu sein. Sie spähte in die Garage. Kein Mercedes, die Luft war also rein.
Der Regen kam und ging, ein dichter, dunkelgrauer Nebel lag über Porjus. Es war ein elender Herbst gewesen.
Henny betrachtete den Garten. Er war regenschwer und nass. Der Rasen war seit Wochen nicht mehr gemäht worden, jetzt da niemand sich mehr darum kümmerte. Nicht ihr Problem. Der Verfall war nur weiter fortgeschritten.
Sie begann mit den Beeten an der Südseite, den besten, wo es die Pflanzen bis Winterhärte 5 schafften, manchmal sogar bis Winterhärte 4. Überall stand Unkraut und verteilte seine Samen. Wie schnell man doch ein Beet zerstören konnte. Im nächsten Jahr würde das hier eine Wiese mit Vogelmiere und Löwenzahn sein. Mit Feuerkraut und Vogelwicke und ihren unausrottbaren, tiefen Wurzeln. Vincent hatte die Invasion geschehen lassen, ohne einen Finger zu rühren. Noch sahen die Eindringlinge klein und ungefährlich aus, aber schon zum Frühling hin würden sie sich festbohren.
Das Unkraut verhinderte, dass sie das Drama sofort entdeckte. Ihre Augen waren darin nicht geübt. Doch dann blieb sie abrupt stehen. Sah noch einmal hin, verstand es nicht.
Dann schrie sie. Nein, es war kein Schrei, eher ein Wimmern, das Gefühl unerträglich. Wie eine Klinge in den Eingeweiden, die immer wieder gedreht wurde. Ihr sackten die Knie weg, sie streckte die Hände aus, wühlte in der Erde. Ein Friedhof. Verwüstung. Er hatte sie alle getötet.
Der Schmerz war überwältigend. Ihr war schwindlig, sie bekam keine Luft. Das Beet war leer. Keine einzige Pfingstrose war mehr da. Ausgegraben, deportiert, hingerichtet.
Oder gab es noch ein Fünkchen Hoffnung? Konnte er sie tatsächlich alle weggeschafft haben? Sie durchsuchte den ganzen Garten, aber er hatte auch die anderen ausgegraben. Nicht eine einzige Pfingstrose war mehr da. Lagen sie vielleicht auf dem Kompost? Sie wühlte vergebens im Gartenabfall, aber er hatte wohl geahnt, dass sie dort suchen würde. Er musste sie in den Wald geschafft, sie neben einem Waldweg weggeworfen haben. Und jetzt lagen sie dort und starben.
Ihr Körper wurde von Krämpfen geschüttelt, sie schlug die Arme um sich, als wäre ihr eiskalt. Wenn er ihr hatte schaden wollen, dann war ihm das gelungen. Dieser Teufel … Sie waren doch ihre Kinder! In den letzten Jahren hatte sie den Pfingstrosen mehr Zeit gewidmet als Lovisa. Jahre der Fürsorge, der Liebe. Er hatte sie alle niedergemetzelt.
Oder … Vielleicht ja doch … Es war Herbst, die Ruhephase der Pfingstrosen hatte begonnen. Außerdem hatte es ja reichlich geregnet, an Feuchtigkeit mangelte es also nicht. Wenn er sie irgendwo in einen Graben geworfen hatte, hatte sie noch eine Chance. Einige konnten es geschafft haben. Zum Beispiel die English Royal. Sie lag jetzt irgendwo und litt. Verwundet, aber noch nicht tot. Vielleicht lagen sie ja alle beisammen und raunten einander zu: »Haltet durch! Haltet durch! Bald kommt Henny, gebt nicht auf …«
Sie musste sie nur finden, bevor der Frost kam. Bevor die Kälte sie zerbrach. Pfingstrosen waren zäh, es gab noch Hoffnung. Sie musste aus ihm herauspressen, wo er sie hingeworfen hatte.
Zitternd vor Wut setzte sie sich in den Pick-up und drehte den Zündschlüssel um. Vincent war garantiert im Büro. Sie würde verdammt noch mal aus ihm herauspressen, wo sie waren. Sonst würde sie sich rächen. Irgendetwas kaputt schlagen, was auch immer. Seinen geliebten, verfluchten Hubschrauber.
5
BARNEY LUNDMARK DRÜCKTE den Hebel der Pumpthermoskanne herunter und füllte seinen Plastikbecher zu drei Vierteln mit Kaffee. Sobald er morgens zur Arbeit kam, kochte er sich immer eine große Thermoskanne, die den ganzen Tag halten sollte. Den Mythos von dem Kaffee, der ganz frisch sein musste, hatte er bereits als Schüler während seines ersten Ferienjobs in einem Café als Irrtum verworfen. Der Cafébesitzer war ein Geizkragen gewesen und hatte Barney angewiesen, den Kaffee, der am Ende des Tages noch in der Maschine war, am nächsten Tag einfach wieder aufzuwärmen und auszuschenken. Über Nacht abgestandener Kaffee, und die Gäste merkten keinen Unterschied. Im Gegenteil: Sie hatten Stammkunden, die ihren Frühstückskaffee nur deshalb in diesem Café tranken, weil sie meinten, er schmecke dort besonders gut. Dabei ging es eigentlich nur um das Porzellan. Wenn die Tassen nur teuer genug aussehen und mit scheißuntertäniger Miene hinausgetragen wurden, dann ging sogar die Brühe vom Vortag ohne Proteste runter.
Hier bei Vattenfall trank er Kaffee aus einem Plastikbecher. Die Zentrale in Luleå hatte ihnen Recycling und Porzellantassen verordnet, die nach irgend so einer Umweltauflage gespült werden sollten, aber das war ihm egal. So etwas konnten sie seinetwegen in der Stadt machen. Aber im Fall eines Außeneinsatzes konnte er die Thermoskanne problemlos in seinem Transporter mitnehmen. Im Türfach befand sich ein Stapel mit Bechern für ihn selbst und irgendwelche dankbaren Streckenarbeiter. Kein Herumgerede. Volle Kraft voraus. »Willste’n Kaffee?«, konnte er dann fragen. »Der ist mit dem frischesten Strom in ganz Schweden gekocht.«
Und in gewisser Weise stimmte das ja. Der Strom wurde aus den Wassermassen im Suorvaspeicher gewonnen und kam über die Turbinen in Vietas bis in die Steckdose im Aufenthaltsraum. Dort draußen lag es, das riesige Wasserkraftwerk. Einen winzigen Tropfen Elektrizität hatte er für seine Kaffeemaschine abgezapft, als hätte er einen Teelöffel voll Wasser aus den Niagarafällen geschöpft. Der Rest der Kraft rauschte durch die mächtigen Leitungen, die von einer paradierenden Soldatenreihe von Strommasten in schnurgeraden Trassen hochgehalten wurden, bis hinunter in die fernen Ballungsregionen Südschwedens.
Bald würden sicher die Mädchen kommen und Kaffeepause machen. Wie hießen sie noch, Carina und Carolina, oder war es Carola und Catrin? Sie blieben lieber für sich. Typisch, da hatte er endlich mal Damengesellschaft hier draußen, und dann waren sie sich zu fein, um mit gewöhnlichen Arbeitern zu verkehren. Sie trieben sich oben am Staudamm herum und steckten Röhrchen mit irgendwelchen Kabeln in die Erde, telefonierten mit ihren Handys und tippten auf ihren Laptops. Zugegeben, momentan war es ein bisschen kritisch. Dieser Regen. Jedes Gebirgsbächlein rauschte gerade kräftiger als beim schlimmsten Frühlingshochwasser, obwohl es doch schon Mitte September war. Der Speicher war randvoll, obwohl sie nach und nach die Überlaufschleusen im ganzen Tal geöffnet hatten. Was wirklich ärgerlich war, schließlich war es verdammt viel Elektrizität, die da einfach rausgelassen wurde. Damit hätten im Winter ganze Vororte beheizt werden können. Aber das war früher schon vorgekommen und würde immer wieder passieren. Mit so einem nassen Herbst musste man einfach rechnen. Das gehörte dazu. Jahrhundertfluten, ja sogar eine Jahrtausendflut – der Damm war so gebaut, dass er auch der schlimmsten Katastrophe standhielt. Und sobald die Herbstkälte einsetzte, würde sich alles ohnehin wieder beruhigen.
Die Tür ging auf. Catharina, oder wie immer sie hieß, kam nass wie ein Pudel herein. Es tropfte von ihrem Plastikhelm auf den Frühstückstisch.
»Es gibt Kaffee«, sagte er, »gekocht mit dem frischesten Strom …«
»Keine Zeit.«
Na klar, dachte er. Und warum bist du dann verdammt noch mal hergekommen?
Er versuchte es anders. »Regnet’s stark?«
»Mhm.«
»Läuft das mit den Messungen?«
»Du, kann ich mir dein Handy leihen? Meins funktioniert nicht.«
»Liegt sicher an der Nässe«, sagte Barney.
»Ja, bestimmt. Kann ich deins haben? Ich muss Kontakt mit Luleå halten.«
»Wenn du mich ganz lieb darum bittest.«
»Entschuldigung?«
»Wenn du mich ganz lieb darum bittest.«
»Ja, ja, kann ich jetzt dein Handy haben? Please.«
»Nein.«
»Doch.«
»Nein«, wiederholte er. »Ich brauche mein Handy selbst, außerdem gehört es mir. Aber du kannst einen Kaffee haben.«
»Das Handy gehört Vattenfall«, sagte sie.
»Ach, scheiß doch drauf.«
»Gib mir jetzt gefälligst das Telefon. Das ist eine dienstliche Anweisung.«
Barney betrachtete sie mit wachsendem Interesse. Ha, ha, die wütende Fotze. An sich nichts Ungewöhnliches, aber hier war er offensichtlich auf ein Prachtexemplar gestoßen. »Nicht einmal, wenn du mir einen bläst«, sagte er und lachte.
»Was hast du gesagt?«
Er grinste übers ganze Gesicht. Schlürfte Kaffee und konnte es nicht lassen. »Und – machst du dir jetzt in die Hose?«
»Das werd ich melden. Sexuelle Belästigung, das wird so viel Wirbel geben, dass du eine Glatze kriegst.«
»Aussage gegen Aussage«, sagte er beiläufig.
»In so einem Fall glauben sie immer der Frau.«
»Hui, da kommt schon das Pipi. Tropf, tropf.«
Und in der Tat zitterte sie. Sie würde jeden Augenblick explodieren. Waren die heutzutage alle so empfindlich, wenn sie frisch von der Uni kamen? Lernten die dort denn gar nichts? Jeder Vorarbeiter und Gruppenleiter wusste ja wohl, dass man einen Kaffee nicht ablehnen durfte, der ihm von einem einfachen Arbeiter angeboten wurde. Man nahm sich die Zeit, zeigte sich von seiner menschlichen Seite.
»Du«, sagte sie, »draußen ist die Lage kritisch, ich muss sofort telefonieren.«
»Die Lage ist kritisch?«
»Es geht um den Staudamm.«
»Den Damm?«
Barney stellte sich dumm. Seit damals im Café hatte er sicher an die dreißig verschiedene Jobs gehabt, inklusive Bereitschaftsdiensten und sogenannte Arbeitsmaßnahmen. Er wusste genau, wie das mit den Hierarchien funktionierte. Dein Chef hat auch einen Chef. Probleme werden möglichst schnell nach oben geschafft. Er zog sein Handy aus dem wasserdichten Gürtelfutteral, hielt es in die Höhe, sie griff danach, er zog es im letzten Moment weg.
»Nimm es doch! Hol es dir doch!«
Sie griff erneut ins Leere. Dann gab sie resigniert auf.
Wenn er es schon mal in der Hand hielt, konnte er auch gleich darauf herumspielen. Keine neuen Nachrichten. Aber ein verpasster Anruf. Wer konnte das denn sein?
Wie eine Kobra schnappte sie es sich. Entwand es seiner Hand mit überraschender Kraft. Er reagierte instinktiv, konnte gar nicht so schnell denken, merkte kaum, wie er ausholte. Die flache Hand traf sie über dem Ohr, am Rand ihres Helms, sie stolperte seitwärts zur Tür, schlug mit dem Rücken dagegen, fing sich aber wieder.
»Gib das sofort zurück!«, schrie er.
Aber sie war schon verschwunden. Die Hand tat ihm weh, er hatte das harte Plastik des Helms getroffen. Verdammte Schlampe! Barney schnappte sich seine Jacke und wollte schon hinter ihr herlaufen, als er plötzlich stehen blieb. Er spürte etwas. Ein Murmeln stieg ihm die Beine hinauf. Dazu eine Bewegung, ein Ruck. Als würde etwas Großes, Schweres das Gewicht verlagern. Dann hörte es wieder auf.
Eine Person mit mehr Fantasie hätte es vielleicht als ein Erdbeben gedeutet. Es erinnerte ihn an die Zeit, als er vor ein paar Jahren in Malmberget gewohnt hatte: diese leisen Warnlaute in der Erdkruste. Böden, die Risse aufwiesen, Kellertüren, die sich plötzlich nicht mehr schließen ließen. Grubenschächte, die zusammenstürzten trotz Ausbauten und Stützelementen.
Hätte er sein Handy gehabt, er hätte sofort Baudin angerufen und Alarm geschlagen. Verdammtes Weib, er musste sie sich schnappen. Er hatte sie ja nicht verprügeln wollen, es war eine reine Reflexbewegung gewesen. Schließlich hatte sie ihn provoziert.
Barney trat hinaus in den Nebel und machte sorgfältig seine Regenjacke zu, er hörte, wie die dicken Tropfen auf seinen Helm trommelten. Dahinten lief sie. Zum Damm hinauf, auf dem Weg, der dem Bergkamm in einem langen, sanften Bogen folgte. Sie sah über die Schulter, entdeckte ihn und beschleunigte ihre Schritte. Auch er wurde schneller, aber seine Kondition war nicht die beste. Der Sprint ging über in einen Dauerlauf, dann in einen strammen Fußmarsch. Früher oder später würde er sie erwischen. Schließlich war das sein Handy, sie konnte doch nicht einfach aus Luleå daherkommen und es ihm klauen. Genau das war es, Diebstahl. Es konnte nichts schaden, sich schon mal ein bisschen was zurechtzulegen, falls sie ihr kleines Handgemenge wirklich melden wollte.
Als er den Damm erklommen hatte, blieb er abrupt stehen. Vor ihm, quer durch den Asphalt, verlief ein gewundener Riss. Ziemlich breit, einige Zentimeter. Er war sich ganz sicher, dass der am Morgen noch nicht da gewesen war. Barney Lundmark ging in die Knie und schob einen Finger hinein. Innendrin war es trocken. Es hatte also noch nicht in den Riss hineingeregnet, er musste ganz frisch sein. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Das Handy, jetzt brauchte er es wirklich. Diese verfluchte diebische Fotze!
6
DAS LEBEN, DAS Dasein an sich – was vermochte es besser zu gestalten als das Wasser. Lena Sundh ließ sich davon erfüllen, überwältigen, wurde eins mit dem Fluss. Spürte das innerste Wesen des Wassers, den immerwährenden Tanz der Wassergeister vor ihren Augen.
Stora Luleälven. Allein der Name machte sie demütig. Er stammte eigentlich aus dem Samischen, Stuor Julevädno. Sie spürte, wie in ihr etwas zu klingen begann, wie eine Art Resonanz entstand. Die Fasern der Wurzeln ähnelten Saiten, man konnte sie zum Klingen bringen, wenn man sie berührte. Ein inneres Instrument, das man zum Leben erweckte. Sie fühlte die Nähe ihrer Großmutter. Lena war überzeugt davon, sie konnte die Wärme spüren. Ein geistiges Wesen stand hinter ihr, die Hände erhoben wie zu einem Segen, zu einer Geste der Heilung. Die liebe, kluge, runzlige Großmutter bei dem kleinen Mädchen, das inzwischen erwachsen war. Zwei Frauenseelen an dem mächtigen Fluss. Lena spürte, wie sich das Wasser Stück für Stück in kleine, schwimmende Föten verwandelte. Ein reißender Strom schmächtiger Körper, die ihre Babyarme ausstreckten. Sie suchten nach einem Schoß, wollten in sie hinein. Kleine, ungeborene Kinder. Sie musste eine Pause einlegen. Die Sehnsucht tat einfach zu sehr weh. Vorsichtig streckte sie ihren schmerzenden Rücken.
Die Gruppe sah lustig aus unter ihren kunterbunten Regenschirmen. Ein Teil saß vornübergebeugt auf Sitzunterlagen aus Plastik, andere hatten Campingstühle dabei. Ein Stück weiter hatte Sussie sich den Regenschirmgriff um den Oberkörper geschnallt, um die Hände frei zu haben, während Madeleine mit ein paar Stöcken eine wacklige Konstruktion gebaut hatte. Die Regenschirme wehten hin und her und drohten die ganze Zeit umzukippen. Wie Pilze aus einem Buch von Elsa Beskow waren sie über das Flussufer verstreut. Darunter hockten die Kursteilnehmer mit ihren Aquarellkästen und mit Klebeband befestigten Papierbogen und versuchten, die Bewegung einzufangen.
Dies war die Aufgabe des Vormittags. Die Bewegung des Wassers. Sowohl die des Flusses als auch die des Aquarellpinsels. Wasser mit Wasser zu malen, das war wie eine Art Taufe. Ein Ritual. Als Erstes war Lena hinunter ans Ufer gegangen und hatte ihren Pinselbecher mit Flusswasser gefüllt. Sie malte den Fluss mit dem Fluss, Julevädno lief über ihr Papier. Und rundherum von den Rändern des Regenschirms tropfte ununterbrochen der Regen. Ein Kreis aus Regen um ihr viereckiges Aquarell, Yin und Yang, Himmel und Erde, weiblich und …
»Ein Biber!«
Die Frauen schauten auf. Natürlich war es Laban. Lena versuchte, ihn zu ignorieren, wie sie es seit Beginn des Kurses getan hatte. Jede Gruppe musste wohl ihren Laban haben, ihren Narzissten, ihre Schlange im Paradies, das hatte sie während vieler Jahre in zahlreichen Konferenzen lernen müssen. Laban wusste genau, wie man sich in Szene setzte. Zunächst einmal war er mit Abstand der Jüngste im Kurs, gerade mal Anfang zwanzig, mit langem, strähnigem Haar, das ihm am Rücken klebte. Außerdem war er ein Mann, und das ärgerte sie. Eine Gruppe, die nur aus Frauen bestand, wäre ihr lieber gewesen. Am meisten jedoch störte sie sein … Gehabe. Heute zum Beispiel lief er mit nacktem Oberkörper herum, obwohl es kühl war. Oder vermutlich gerade deshalb, um an ihre Mutterinstinkte zu appellieren. Und um sein Tribal zu zeigen, das wie ein blauer Wasserfall über seine Schulter verlief. Laban war auch der Einzige, der sich weigerte, einen Regenschirm zu benutzen. Er wollte unter freiem Himmel malen, obwohl es in Strömen goss. Dabei war doch allen klar, dass das unmöglich war, und entsprechend zerknüllte er schon bald sein Papier und warf es auf die Erde. Was er mit »Biber« hatte sagen wollen, war unklar. Hatte er einen Biber gemalt? Oder war das ein Slangausdruck, irgendwas aus Luleå? Auf jeden Fall würde sie darauf achten, dass er das Papier nicht liegen ließ, wenn sie hier fertig waren, das würde sie ihm deutlich zu verstehen geben. Man verschmutzte Mutter Erde nicht, das sollte er wissen.
Jetzt streckte Laban sich und begann mit einer Art barfüßigem Eingeborenentanz, bei dem er das Haar herumwarf und irgendetwas vor sich hin summte. In seinen Ohren steckten Stöpsel mit lautstarker Musik, als würden die Geräusche der Natur nicht genügen. Wenn er sich wenigstens im Hintergrund halten würde. Aber nein, er musste sich im Blickfeld aller befinden, die Blicke aller auf sich ziehen. Er war einer dieser Menschen, die immer nur haben wollten. Er wollte alles in sich aufsaugen wie ein Baby, ohne einen Gedanken an die Bedürfnisse der anderen zu verschwenden. Ein typischer Suchtmensch, dachte sie. Er hatte bestimmt schon diverse Drogen ausprobiert und glaubte, sie würden helfen. Drogen stellen den Menschen schließlich ins Zentrum unseres riesigen Universums, genau in den Mittelpunkt. Aber dort stand man allein. Da war kein Publikum, das er um sich scharen konnte, sondern nur kosmische Strahlung. Er würde daran zugrunde gehen.
»Du spritzt!«, schimpfte Madeleine, die ihm am nächsten saß.
Durch seine Ohrstöpsel hörte er nichts, schüttelte einfach weiter sein nasses Haar. Madeleine versuchte vergebens, ihr Aquarell zu schützen, drehte ihm den Rücken zu, doch so konnte sie ihr Motiv nicht mehr sehen. Schließlich seufzte sie demonstrativ, packte ihre Sachen zusammen und zog zehn Meter weiter.
Typisch Frau, dachte Lena. Einfach aufzugeben. Sie selbst würde … Ja, was würde sie getan haben? Was auch immer. Mit einem Erdklumpen nach ihm werfen. Ein lehmiger Klumpen, zack, in die Fresse. Eine Sahnetorte voll auf Labans Ego.
Aber vielleicht hätte ihn das nur angestachelt. Es hätte ihm Aufmerksamkeit beschert. Er hätte eine Szene gemacht und versucht, ihr Aquarell zu bespucken. Oder er hätte mit verzweifelter Berechnung losgeheult, bis er die ganze Gruppe gegen sie aufgebracht hatte. Womöglich hatte Madeleine es genau richtig gemacht, man sollte sich mit Idioten nicht beschäftigen. Man sollte einfach aufstehen und gehen und es von sich abprallen lassen. Dem Narzissten einen Spiegel vorhalten und sich selbst einer anderen Sache zuwenden. Sich wieder dem eigentlichen Ziel widmen, dem Wasser. Der Bewegung des Wassers. Die Schichten ineinander übergehen zu lassen. Dem Pigment Schwung zu geben, den Widerstand zu spüren, mit dem Pinsel über die Oberfläche zu streichen. Und dann die Selbstzweifel beiseitezuschieben, mit denen sie am meisten zu kämpfen hatte, seit sie mit der Kunst begonnen hatte. Dieses Analysieren, diese trockene, nagende Stimme, die ihr einredete, dass alles, was sie tat, nur eine Lappalie war. Bereits vor dem ersten Pinselstrich konnte sie es hören: »Willst du wirklich damit anfangen? Warum denn das? Warum malst du immer auf die gleiche Art und Weise? Du hast anscheinend nur eine einzige Ausdrucksform. Du versuchst nie, dich weiterzuentwickeln, du gibst dich zu schnell zufrieden, bleibst beim geringsten Widerstand stehen, du strengst dich nicht ausreichend an, das genügt niemals …«
Papa. Oder das, was noch von ihm übrig war, sein ewiges Genörgel. Es ging darum, das Herzchakra zu öffnen. Sich von der Energie überschwemmen zu lassen und sich mit dem zu füllen, was er selbst nie zugelassen hatte.
»Hast du gekörntes Papier dabei?«
Atemlos nach seinem hektischen Tanz schob Laban sich unter ihren Regenschirm. Das Haar troff, und es gelang ihr nur mit Mühe, ihr Bild zu schützen.
»Nein«, sagte sie.
»Dann nehme ich normales.« Er schob seine nassen Finger in ihre Tasche und wühlte darin herum.
Das darf doch nicht wahr sein, dachte sie.
»Ich kann doch nicht alles Mögliche mit mir herumschleppen«, erklärte er, »nicht, wenn ich schöpferisch tätig sein soll. Dann muss man sich von allem befreien, was stört, zurück zum Körper gehen, weißt du, der Körper lügt nie.«
»Na hör mal, Vorsicht …«
»Ich benutze nie eine Staffelei. Der Regen, der ist ein Freund, weißt du, das ist Leben geradewegs aus dem Himmel. Ich möchte das Wasser auf der Haut spüren.«
Laban riss ein paar Bogen von ihrem Block ab und drückte ihn dann zurück in die Tasche.
»Und Klebeband, meins habe ich in der Hütte gelassen. Ist es in der Seitentasche?«
Mit einer entschlossenen Bewegung riss sie die Bogen an sich, die er sich zwischen die Zähne geklemmt hatte, knüllte sie zusammen und stopfte sie in die Tasche. Verwundert hielt er inne, die Hand immer noch tief in ihrer Tasche vergraben. Sie hob den Fuß, stellte ihn auf seine nackte Schulter und drückte. Es kam für ihn vollkommen unvorbereitet. Das war das Letzte, was er erwartet hatte. Er verlor das Gleichgewicht und taumelte rückwärts wie eine Birne. Ohne sich abzustützen, schlug er einen Purzelbaum, und sie hörte es knacken, als er auf einen Stein traf. Wie ein Ei.
Lena tat so, als finge sie wieder an zu malen. Der Pinsel zitterte. Laban lag da, er rührte sich nicht. Die Lider halb geöffnet, starr. Es regnete auf das Weiße in seinen Augen. Sekunden vergingen, der Fluss stockte vor ihr, der Strom hielt inne. Nur noch Glas, graues Glas. Ultramarin. Und dann plötzlich ein leuchtender Tropfen Rot.
Er war wieder auf die Füße gekommen. Schüttelte den Kopf, Blut spritzte von den Haaren. Er würdigte sie nicht eines Blickes, sagte nichts, schwankte nur hinunter zum Fluss und watete hinein. Als er knietief im Wasser stand, blieb er stehen, beugte sich vor und benetzte sich den Schädel. Die langen, dünnen Finger umrundeten einen Punkt am Hinterkopf, kreisten den Schmerz ein. Dann richtete er sich wieder auf und breitete die Arme aus wie ein Turmspringer. Wie zu einer Sonnenanbetung, zu einem Ritual.
Mittlerweile hatten alle das Blut gesehen. Es lief über sein Schulterblatt hinab, rot und reichlich. Lena merkte, wie ein Ruck durch die Kursteilnehmerinnen ging, alle Blicke waren starr auf die Szene gerichtet. Und dann, wie in stillschweigender Übereinkunft, zückten alle einen neuen Bogen Papier und fingen an, sie zu malen. Den Jüngling und den Fluss. Die ausgestreckten, geradezu flehenden Arme. Und dann das, was das Motiv überhaupt erst vollendete, das Blut. Er war Jesus. Er wusste es, er stand Modell. Und die Damen, die Weibsbilder waren natürlich voll und ganz in ihrem Element. Frauen und Blut. Menstruation. Abendmahl. Der Mann, der die Sünden auf sich nimmt, der sich aufdrängt und alles ausradiert, was unser Eigen war, was echt war, und der alles verdrängt.
Lena spülte den Pinsel aus und packte zusammen. Die Tasche war innen ganz feucht von seinen wühlenden Händen, sie würde sie später trocknen müssen. Den Regenschirm legte sie über die Tasche, dann fing sie an, in den Boden zu treten. Um sie herum wuchsen Kräuter und Gestrüpp, sie musste die Ferse tief in die Erde bohren, bis sie ein Loch zustandegebracht hatte. Schließlich hatte sie eine lehmige Grassode freigelegt. Entschlossen ging sie zum Fluss hinunter und stellte sich ein Stück hinter Laban. Dann löste sie einen Erdklumpen heraus und warf. Traf ihn mitten auf dem Rücken. Warf noch einen Klumpen. Und noch einen. Braune Flecken auf weißer Haut. Flecken zwischen Blutstreifen. Und jetzt, jetzt endlich wachten die Damen aus ihrer Trance auf.
»Was machst du denn, Lena?«
»Geh weg, du verdeckst das Motiv!«
»Hör auf, Lena!«
Laban hörte die Rufe. Würdevoll drehte er sich um, watete langsam und mit einem unergründlichen Lächeln auf den Lippen zurück ans Ufer. Jetzt wollte er wieder das Heft in die Hand nehmen. Trotzig und aufgebracht ließ Lena die letzten Erdklumpen zu Boden fallen. Sie dachte gar nicht daran beiseitezutreten.
»Du verdeckst das Motiv«, wiederholte er mit einem Lächeln.
Labans nackter, magerer Brustkorb hob sich. Das Regenwasser vermischte sich mit dem Lehm und dem Blut und lief ihm wie eine Lasur über die Haut. Er musterte sie, suchte ihre Schwachstelle. Und dann schoss seine Hand vor und griff nach ihrem Handgelenk. Fest und entschlossen. Immer noch das gleiche starre Lächeln. Sein Blick war kalt, echsenhaft, und sie erkannte sofort seine Absicht. Er wollte sie in den Fluss hineinziehen. Sie hineinwerfen und untertauchen, sodass sie unter Schreien und Kreischen herumplanschen würde, als wäre dies alles ein Spiel. So würde er wieder zum Motiv werden. Und sie zu seinem Spielzeug. Ja, jetzt kam der Ruck, jetzt sollte es geschehen.
Nur mit Mühe gelang es ihr, ihn abzuwehren. Sie suchte Halt zwischen den Steinen am Ufer und lehnte sich zurück. Aber er war überraschend stark. Einen Kopf größer als sie selbst, mit der Energie eines Jünglings. Gleichzeitig lachte er laut, um den anderen zu signalisieren, wie lustig das alles sei und dass es ihm nichts ausmache. Die Frauen saßen am Ufer aufgereiht wie auf einer Tribüne. Ein paar von ihnen machten sich Skizzen und versuchten, das Schauspiel einzufangen. Laban würde sie ins Wasser zerren. Die anderen sahen zu, niemand griff ein. Sie war es schließlich, die ihn provoziert hatte. So kann es gehen, wilden Katzen wird das Fell zerzaust.