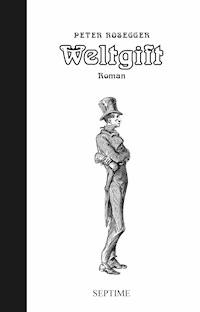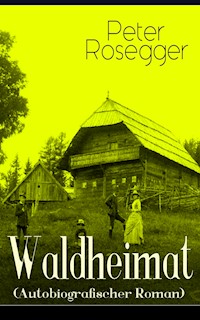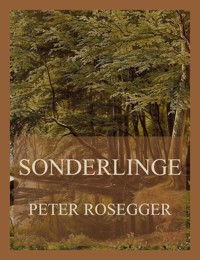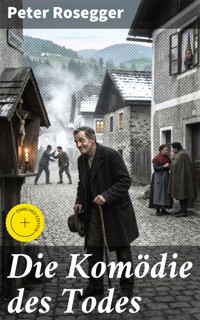1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Die Försterbuben: Ein Roman aus den steirischen Alpen" entführt Peter Rosegger den Leser in die malerische und zugleich raue Landschaft der steirischen Alpen. Durch die Augen der Försterbuben erleben wir nicht nur die Herausforderungen des Lebens im Gebirge, sondern auch die tief verwurzelten Traditionen und die enge Verbindung zur Natur. Roseggers klarer, realistischer Stil und sein tiefes Verständnis für das alpine Leben schaffen eine authentische Atmosphäre, die den Leser in die alpine Idylle eintauchen lässt und gleichzeitig die sozialen und ökologischen Themen des 19. Jahrhunderts beleuchtet. Peter Rosegger, geboren 1843 in der Steiermark, war ein prominenter Vertreter der österreichischen Literatur und ein leidenschaftlicher Verfechter der alpinen Kultur. Seine eigene Kindheit in den Bergen prägte seine Erzählweise und sein Engagement für die ländliche Lebensweise. Rosegger setzte sich zeitlebens für die Belange der ländlichen Bevölkerung ein und nutzte seine Werke, um auf deren Schwierigkeiten und Schönheiten aufmerksam zu machen. Diese persönliche Verbindung zur Thematik spiegelt sich in seinem Werk wider und verleiht ihm eine besondere Authentizität. "Die Försterbuben" ist nicht nur ein fesselnder Roman, sondern auch eine Hommage an die alpine Kultur und die Herausforderungen der Natur. Leser, die sich für die Dynamik zwischen Mensch und Natur interessieren, werden in die eindringliche Welt des Romans eintauchen und die emotionalen sowie philosophischen Werte, die er verkörpert, zu schätzen wissen. Dieses Buch ist ein wertvoller Beitrag zur österreichischen Literatur und ein Muss für alle, die die Liebe zur Natur und zur ländlichen Lebensweise entdecken möchten. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Försterbuben: Ein Roman aus den steirischen Alpen
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen den schattigen Fichtenhängen der steirischen Alpen und dem wachsenden Bewusstsein junger Menschen, ihren Platz in einer strengen, von Arbeit und Brauch geprägten Welt zu finden, spannt sich in Die Försterbuben jene leise, doch beharrliche Spannung, in der Natur zur Lehrmeisterin, Pflicht zur Prüfung und Heimat zur Frage wird, deren Antwort nicht im großen Aufruhr, sondern in Geduld, Gewissen und dem aufmerksamen Blick für das Kleine liegt, die in jedem Schritt auf dem knarrenden Steig, in jedem Tausch zwischen Wald und Dorf, in jeder Geste der Fürsorge und Strenge spürbar bleibt, während die Jahreszeiten ihre Kapitel schreiben und die Wege der Jugend tastend, aber unbeirrt in Verantwortung und Selbstkenntnis übergehen.
Die Försterbuben: Ein Roman aus den steirischen Alpen gehört zur heimatverbundenen Erzähltradition der österreichischen Literatur und führt in Wälder, Almen und Dörfer, die als lebendige Bühne wie als moralischer Resonanzraum fungieren. Peter Rosegger, selbst in der Steiermark verwurzelt, gestaltet daraus ein realistisches Sittengemälde, dessen Aufmerksamkeit der Arbeit im Forst, dem Dorfzusammenhalt und den leisen Rissen im Alltäglichen gilt. Der Roman verortet sich klar im Gebirge und in seiner Kultur, ohne Exotik zu suchen, und schöpft aus Beobachtung, Erfahrung und Sprache einer Region, die mehr als Kulisse ist: Sie ist Bedingung, Herausforderung und Verheißung zugleich.
Im Ausgangspunkt begegnen wir dem Alltag eines Försterhauses und der Welt um es herum: Wege, die in den Wald führen, Werkzeuge, die den Rhythmus der Tage bestimmen, und junge Menschen, die ihren Blick schärfen, indem sie mitgehen, mithelfen und mitdenken. Die ersten Kapitel erschließen diese Lebenswelt nicht durch spektakuläre Ereignisse, sondern durch Handgriffe, Beobachtungen, kleine Prüfungen, die Charakter formen. Aus dieser Nähe entsteht ein stilles Fragen nach Zugehörigkeit und Verantwortung: Was bedeutet es, im Wald zu arbeiten, in einer Gemeinschaft zu bestehen, zwischen Tradition und persönlichen Neigungen zu wählen, ohne das Gefüge zu stören?
Roseggers Erzählen verbindet Anschaulichkeit mit Ruhe: Landschaften entfalten sich in klaren Linien, die Arbeitsschritte werden präzise benannt, doch über allem liegt ein Ton menschlicher Wärme, der nie sentimental wird. Der Stil favorisiert Episoden, in denen Dialoge und Beobachtungen ineinandergreifen; gelegentlich schimmern mundartnahe Wendungen durch, die Kolorit geben, ohne das Verständnis zu hemmen. Das Tempo ist maßvoll, der Blick geduldig, und so gewinnt das Kleine Gewicht. Wer sich darauf einlässt, spürt eine Erzählstimme, die zugleich vertraulich und prüfend wirkt und über die Oberfläche hinaus auf Haltung, Maß und innere Bewährungsproben zielt.
Zentral ist das Verhältnis von Mensch und Natur, nicht als dekorative Kulisse, sondern als Gegenüber, das Arbeit, Demut und Kenntnis verlangt. Daraus erwachsen Fragen nach Verantwortung, Gerechtigkeit und Zusammenhalt: Wie wird Hilfe organisiert, wie wird Wissen weitergegeben, wie wird Konflikt geschlichtet, wenn Ressourcen knapp und Wege weit sind? Bildung erscheint dabei nicht nur als Schulwissen, sondern als Einübung in Wahrnehmen und Abwägen. Ebenso präsent sind Tradition und Wandel: Verbürgte Regeln geben Halt, doch neue Bedürfnisse melden sich an. Der Roman prüft diese Spannungen ohne Polemik und sucht nach tragfähigen, alltagsnahen Formen des Fortschritts.
Für heutige Leserinnen und Leser öffnet Die Försterbuben einen Raum, in dem ökologische Sensibilität und soziale Verantwortung selbstverständlich zusammengehören. Wer nach Geschichten sucht, die Nachhaltigkeit nicht als Schlagwort, sondern als gelebte Praxis zeigen, findet hier Anschauung: sorgfältiger Umgang mit Ressourcen, Reparieren statt Ersetzen, Wissen als Gemeinschaftsgut. Zugleich lädt der Roman zur Entschleunigung ein und erinnert daran, wie Wahrnehmung Tiefe gewinnt, wenn Arbeit, Zeit und Ort aufeinander bezogen sind. Er bietet damit nicht Nostalgie, sondern eine präsente Frage: Welche Formen des Miteinanders tragen heute, wenn Bindungen lockerer, Wege schneller, Ablenkungen lauter geworden sind?
Wer sich diesem Roman nähert, darf keine grellen Effekte erwarten, sondern eine fein abgestimmte Bewegung, in der Figuren durch Handeln, Beobachten und Aushalten wachsen und die Landschaft ihnen den Takt gibt. Die Lektüre belohnt mit stillem Staunen, mit Einsichten in die Ethik des Alltags und mit Bildern, die lange nachhallen. So wirkt Die Försterbuben als Erzählung über Herkunft und Haltung, über das gegenseitige Tragen in schwierigen Lagen und über das Lernen im offenen Raum der Natur. Es ist ein Buch, das mehr mitteilt, als es behauptet, und dadurch Bestand gewinnt.
Synopsis
Peter Roseggers Die Försterbuben: Ein Roman aus den steirischen Alpen eröffnet den Blick auf eine abgelegene Bergwelt, in der Alltag und Natur ineinandergreifen und die Jugend zweier Burschen im Umfeld des Forstwesens geprägt wird. Die Anfänge skizzieren das Milieu: einfache Arbeit, klare Jahreszeiten, ein strenges, aber fürsorgliches Zuhause und eine Dorfgemeinschaft, die Sicherheit und Kontrolle zugleich bedeutet. Rosegger entfaltet dies mit genauer Beobachtung für Sprache, Sitten und Landschaft. Früh wird spürbar, dass das Aufwachsen in den Bergen mehr ist als Idylle: Es formt Charakter, schärft Gewissen und stellt unausgesprochene Regeln auf, an denen sich das Handeln messen muss.
Der Roman begleitet die Buben auf ihren ersten Wegen in den Wald, wo sie Regeln kennenlernen und Fähigkeiten erwerben, die für das Überleben entscheidend sind. Unter Anleitung erfahrener Erwachsener lernen sie, Spuren zu lesen, Grenzen zu respektieren und Verantwortung zu tragen. Die Faszination der Freiheit lockt jedoch über bekannte Pfade hinaus. Kleine Mutproben, Begegnungen mit Nachbarsleuten und das Bedürfnis, sich zu beweisen, erzeugen leise Spannung. Ein frühes, einschneidendes Erlebnis – unspektakulär, aber folgenschwer – markiert den Übergang von spielerischer Neugier zu einer ernsteren Wahrnehmung von Pflicht, Vertrauen und den Folgen des eigenen Tuns.
Mit zunehmendem Alter erweitert sich ihr Horizont: Dorfregeln, Traditionen und ungeschriebene Vereinbarungen geraten ins Verhältnis zu den Anforderungen einer geordneten Forstwirtschaft und den Erwartungen der Gemeinschaft. Aus dem Tal dringen neue Vorstellungen von Bildung, Erwerb und Fortschritt herauf, während auf den Almen Bewährtes verteidigt wird. Die Buben beginnen, zwischen Loyalität und Selbstbehauptung abzuwägen. Ein weiteres, deutliches Wendemoment entsteht, als die vermeintliche Stabilität der Verhältnisse brüchig wirkt und die Frage aufkommt, wie weit man für Zusammenhalt gehen darf, ohne das eigene Gewissen zu beschädigen.
Die Beziehung der beiden – in Verbundenheit gewachsen, in Temperament und Blick auf die Welt nicht deckungsgleich – wird zum Prüfstein. Eine Belastung der Vertrauensverhältnisse zwingt Familie und Umfeld, sich zu positionieren: Bewahren sie den inneren Kreis oder bekräftigen sie die Ordnung, der alle unterstehen? Rosegger zeichnet die entstehenden Spannungen ohne grobe Schwarz-Weiß-Malerei. Er zeigt, wie Zuneigung, Stolz und Angst miteinander ringen und wie leicht gut gemeinte Entscheidungen Konsequenzen nach sich ziehen. Aus Andeutungen und Zwischentönen wächst das Bewusstsein, dass die Buben nicht nur die Natur, sondern auch die Komplexität menschlicher Bindungen zu lesen lernen müssen.
Die Natur der steirischen Alpen bleibt dabei nicht bloße Kulisse, sondern wirkt als Spiegel und Gegenkraft: Wetterwechsel, karge Böden und weite Wälder verschärfen oder mildern Konflikte. Ein markantes Ereignis – getragen von Gefahr, Entschlossenheit und stiller Solidarität – zwingt die jungen Figuren, über sich hinauszuwachsen. Ohne das Ergebnis vorwegzunehmen, führt die Erzählung an einen Punkt, an dem Mut und Maß entscheidend werden. Die Spannung entsteht weniger aus dramatischen Überraschungen als aus der Frage, welche Werte in einer Grenzsituation tragen: Pflichtgefühl, Menschlichkeit, Wahrheit oder Schutz des Nächsten.
Aus der Zuspitzung erwachsen Nachwirkungen, die die Dorfgemeinschaft ebenso betreffen wie jeden Einzelnen. Gerüchte, Schuldgefühle und das Bedürfnis nach Rechtfertigung treffen auf das Bestreben, Frieden zu wahren. Rosegger nutzt diese Lage, um Spielräume zwischen Gesetz und Gewissen auszuloten, ohne abschließende Urteile zu sprechen. Figuren reifen, indem sie lernen, Verantwortung anzunehmen und die Konsequenzen ihrer Wahl zu tragen. Die leisen Veränderungen in Haltung und Blick zeigen, wie Reife in kleinen Schritten entsteht und wie Erinnerungen an Fehltritte, Hilfen und Versöhnungen zu einem inneren Kompass werden.
Am Ende steht weniger eine spektakuläre Auflösung als eine nachhaltige Einsicht in das Gefüge aus Natur, Gemeinschaft und persönlicher Moral. Die Försterbuben verbindet Heimatroman und Sozialbeobachtung zu einem Bild ländlicher Lebenswirklichkeit, das die Würde einfacher Arbeit ebenso betont wie die Ambivalenz strenger Regeln. Rosegger lässt die Leserinnen und Leser mit einer Vorstellung zurück, was es heißt, in einer rauen Umgebung aufrecht zu werden: Verbundenheit ohne Blindheit, Pflicht ohne Härte, Selbstbehauptung ohne Selbstgerechtigkeit. Die Wirkung des Buches liegt in seiner ruhigen Klarheit, die Fragen offenhält und menschliche Haltung erprobt.
Historischer Kontext
Der Roman Die Försterbuben: Ein Roman aus den steirischen Alpen spielt im 19. Jahrhundert in den steirischen Alpen, einer ländlichen Region der Habsburgermonarchie (nach 1867 Cisleithanien). Prägende Institutionen sind die katholische Pfarre, die Gemeinde mit Bürgermeister und Gemeinderat, die k.k. Bezirksverwaltung sowie der staatlich regulierte Forstdienst, der Gemeindewälder und Privatforste beaufsichtigt. Der Alltag dreht sich um Kleinbauernwirtschaft, Holzarbeit und die Volksschule. Die alpinen Täler, Almen und ausgedehnten Wälder bestimmen Erwerb, Wege und sozialen Rang. Der Schauplatz spiegelt eine Region, die an Zentren wie Graz und Wien angebunden ist, aber im Bewusstsein vieler Bewohner peripher bleibt.
Zentraler Hintergrund ist der Umbruch nach 1848. Die Revolutionen führten in den österreichischen Erblanden zur Aufhebung der grundherrlichen Lasten und zur Neuordnung ländlicher Abhängigkeiten. Bauern erhielten Eigentumsrechte, zugleich wurden jahrhundertealte Nutzungsrechte an Wald und Weide (Servituten) durch Kommissionen neu geregelt oder abgelöst. Für Berggemeinden bedeutete das Konflikte um Holz, Weidegänge und Zäune, die oft vor Bezirksbehörden oder Schiedsstellen endeten. Forstschutzorgane gingen gegen Wilderei und unerlaubte Holzschläge vor. Der Roman spiegelt diese Konstellation, indem er den Forstdienst als Träger staatlicher Ordnung und als Schnittstelle zwischen Gemeinwohl, privaten Ansprüchen und überlieferten Gewohnheitsrechten zeigt.
Im 19. Jahrhundert professionalisierte sich die Forstwirtschaft im Habsburgerreich. Der Staat etablierte Forstverwaltungen, Dienstprüfungen und Schutzbestimmungen für Aufforstung, Hangstabilisierung und Jagd. Forstbeamte trugen Uniform, führten Reviere, maßen Bestände und setzten Einschlagspläne durch. Die forstliche Ausbildung wurde ausgebaut; 1872 entstand in Wien die Hochschule für Bodenkultur, die auch Forstleute ausbildete. Der Diskurs über nachhaltige Nutzung, Erosionsschutz und Wildschadensvermeidung prägte Amtsführung und Dorfalltag. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Förster im Roman als fachkundige, oft distanzierte Autoritäten, die ökologische Vorsicht und fiskalische Interessen vertreten und im Spannungsfeld zwischen gemeinschaftlichen Bedürfnissen und administrativen Vorgaben handeln.
Die Bildungssituation im Alpenraum veränderte sich grundlegend. Seit 1774 galt im Habsburgerreich allgemeine Schulpflicht; mit dem Reichsvolksschulgesetz von 1869 wurde der achtjährige Pflichtschulbesuch modernisiert, der Einfluss der Kirche in Schulangelegenheiten begrenzt und die Lehrerbildung vereinheitlicht. In abgelegenen Tälern blieb der Unterricht oft in einklassigen Dorfschulen, mit langen Schulwegen und strengen Disziplinformen. Die wachsende Alphabetisierung erweiterte Lesestoff und Horizonte, ohne ländliche Lebensbahnen sofort aufzubrechen. Der Roman zeigt Kinder- und Jugendjahre im Spannungsfeld von Schule, Arbeit und Katechese, wodurch soziale Mobilität denkbar, aber durch Familienpflichten und geographische Abstände zugleich eingeschränkt erscheint. Prüfungen und Zeugnisse gewannen an Bedeutung für Berufswahlen.
Die steirische Wirtschaft war im 19. Jahrhundert eng mit Waldnutzung verknüpft. Die Südbahn verband seit den 1850er Jahren Wien, Graz und Triest und öffnete neue Absatzmärkte für Rundholz, Bauholz und weitere Holzprodukte. Die Eisenindustrie am Erzberg und in den Tälern hatte lange mit Holzkohle gearbeitet und hinterließ spürbare Nachfrage nach Holz und Transportleistungen. Saisonale Holzarbeit, Flößerei und Sägewerke prägten Erwerbsbiografien; viele Holzknechte pendelten zwischen Almen, Schlägerungen und Baustellen. Der Roman veranschaulicht die schwere, gefährliche Arbeit im Wald und die Abhängigkeit ländlicher Haushalte von wechselhaften Preisen, Witterung und Konjunkturzyklen. Unfälle und Krankheiten bedrohten die Existenz.
Der Katholizismus prägte den Rhythmus des Dorflebens mit Festtagen, Prozessionen, Beichte und kirchlichen Vereinen. Zugleich veränderten liberale Reformen die Rechtslage: Die Dezemberverfassung von 1867 garantierte Grundrechte, und die Maigesetze von 1868 stärkten staatliche Zuständigkeiten in Schule und Ehewesen. Priester blieben dennoch zentrale Autoritäten in Seelsorge, Armenhilfe und Moralfragen. Volksmissionen, Marienbruderschaften und Abstinenzbewegungen fanden auch in der Steiermark Resonanz. Im Roman erscheinen Frömmigkeit, Gewissen und soziale Kontrolle als Ordnungskräfte, innerhalb derer familiäre Entscheidungen und Erziehungsfragen getroffen werden. Dadurch wird religiöse Bindung nicht polemisch, sondern als gegebene Alltagsmatrix sichtbar. Kirchliche Feste strukturierten zudem Arbeits- und Schulzeiten.
Die Steiermark lag in einem mehrsprachigen Kronland; insbesondere in Untersteiermark lebten viele slowenischsprachige Untertanen, während Obersteiermark überwiegend deutschsprachig war. Nach dem Ausgleich von 1867 wurde die Region dem cisleithanischen Teil der Doppelmonarchie zugeordnet; das Wehrgesetz von 1868 führte allgemeine Dienstpflicht ein und band junge Männer an Armee und Landwehr. Gendarmerie, Bezirksgerichte und Steuerämter machten staatliche Präsenz im Alltag spürbar. Im Roman rahmen solche Institutionen das Heranwachsen: Loyalität zur Familie, Respekt vor Amt und Gesetz sowie Sorge um Ruf und Ehre werden plausibel, ohne den lokalen, alpinen Charakter der Gemeinschaft zu überblenden.
Peter Rosegger (1843–1918), in Alpl in der Obersteiermark geboren, wurde durch Dorfgeschichten, Zeitungsfeuilletons und die von ihm 1876 gegründete Zeitschrift Heimgarten bekannt. Seine Prosa zählt zur Heimatdichtung und zum realistischen Sittenbild; sie dokumentiert Bräuche, Dialekte und den Wandel ländlicher Ökonomien. Die Försterbuben fügt sich darin ein, indem das Leben eines Forsthaushalts als Brennglas für Gemeindesitten, Erziehung und Autorität dient. Als Kommentar zu seiner Epoche macht das Buch sichtbar, wie Modernisierung – Schule, Verwaltung, Markt – mit Naturbindung, religiöser Praxis und Nachbarschaftshilfe kollidiert und sich zugleich in den steirischen Alpen alltagstauglich einrichtet.
Die Försterbuben: Ein Roman aus den steirischen Alpen
Ullstein & Co Berlin-Wien
Die Bestattung des Prinzen
»Juch! Juch!« Hell jauchzend sprang er vom Waldrande herab auf den Weg. Ein junger Mann – schwang seinen hochbefederten Hut: »Juch! Juch!«
»Das ist ja Försters Fridolin!« lachten die Leute, die in bewegten Gruppen daher kamen. »Friedl, gehst du auch zu der Leich?«
»Wohin denn sonst?« lachte er, »freilich geh ich auch zu der Leich! Juchhe!«
Viele jauchzten mit.
Es waren zumeist junge Mannsleute in halb feiertägiger Bauerntracht. Jeder auf dem grünen Hut stramm befedert. Weiße flaumige Stoßfedern, schwarze sichelkrumme Birkhahnfedern, fächerförmig oder pinselartig gefaßter Gemsbart[1], und lauter solche Zeichen, daß sie aufgelegt sind heute zu jeglicher Unternehmung, sei es zum Raufen oder zum Schuldenmachen oder zum Weiberleutfoppen! Man konnte ihnen schon etwas zutrauen, diesen derben, urfrischen »Alpenjodeln«. Das Liebste, was sie taten, war freilich Singen und Jauchzen; und so jauchzten sie auch in allen Glockentönen. Ein anderes Geläute gab es nicht bei diesem Begräbnisse.
Von den Einzelhöfen kamen sie herbei. Aber dort am Eschbaum, wo der Weg sich zweigt – der eine ins Kirchdorf Ruppersbach, der andere zu den Häusern von Eustachen – bogen sie gegen Eustachen ein.
Hinterher waren auch ein paar alte Bäuerinnen gekommen, schwarz und schlapp gewandet, in Filzhüten mit breiten Krempen. Fäuste machten sie, als sie das Treiben der Burschen sahen, und um die Fäuste hatten sie Betschnüre gewunden.
An der Wegscheide rief dieser Matronen eine mit scharfem Zünglein den jungen Leuten zu: »Ihr vergeht euch ja! Die Kirchen, die steht nit in Eustachen, die steht in Ruppersbach.«
»Aber in Eustachen steht das Wirtshaus!« rief einer der Burschen lustig herüber.
»Laßt euch lieber Staub und Aschen auf die Schädel streichen!« rief die Alte. »Oder wollt ihr am heiligen Aschermittwoch auch noch Faschingtag halten? Gleichschauen tät’s euch, ihr Fleischkrapfenjodeln, ihr fürwitzigen. Aber denkt nur darauf: Werdet auch einmal sterben müssen!«
»Ja, nachher haben wir Aschermittwoch genug,« gab der Bursche zurück.
»Laß dich nit auslachen, Seppel, daß du mit alten Weibern wortelst!« rief des Försters Fridolin.
»Derselbig ist auch so einer!« eiferte die Alte, ihre Faust nach dem Burschen drohend, »der alleweil heilig Sach tut verspötteln. Euch wird’s schon noch heimkommen, werd’t es schon sehen, wie sie werden zwicken, die Spitzhörndel-Teufelein!«
Sie verstanden sich nicht mehr, die Wege gabelten schon zu weit.
Die Weiber trippelten hinab zur Kirche, wo an diesem Tage nach kirchlichem Brauch der Priester den Gläubigen der Reihe nach Asche an die Stirn rieb: »Du bist von Staub und Aschen und wirst zu Staub und Aschen!«
Anders ging’s her zu Eustachen.
Dort vor dem Straßenwirtshause, genannt »Zum schwarzen Michel«, hatte sich allerlei Volk zusammengefunden. Mitten auf dem Platze war bereits der Kondukt aufgestellt: ein dicker, wuppiger Sarg, mit schwarzem Tuche eingehüllt, vorn und hinten die Bahrstangen, der Träger harrend. Über den Köpfen flatterten blaue Fahnen. Aus dem Wirtshause trat, von zwei Jungen mit Stallaternen begleitet, eine Trauergestalt. Man hätte mögen meinen, ein fürnehmer russischer Pope wäre es, wie hinter ihm her zwei Knaben in langen Nachthemden die Schleppe seines Mantels trugen. Schwarz war sein Haar und schwarz sein langer Bart. Und das Schwärzeste daran sein großes Auge mit dem glosenden Feuer. So leuchtet in der Kohle die Glut.
Die würdige Gestalt stellte sich vor der Bahre auf und hob beide Arme empor. Da dämpfte sich in der Menge der Lärm, und der Schwarze begann in feierlichem Trauerbasse also zu sprechen:
»Liebe lustige Leidtragende!
Öffnet die geehrten Ohren! Wir haben einen großen Verlust verloren. Gestern um diese Stund noch frisch und gesund, die Wangen rot, gesungen, gesprungen, geloffen, gesoffen – und heut schon mausetot. Unser liebster Freund! Eine Trauerred sollt ich halten, aber mein! Mir fallt nix ein. Gehn ma weiter, sein ma heiter und tun ma weinen ohne Wein, leicht fallt uns unterwegen was ein.«
Die Träger heben den verhüllten Sarg, der Zug ordnet sich unter dem Geheule der Trauergäste. Voran dem Zuge geht Försters Fridolin, auf einer senkrecht gehobenen Stange ein verhülltes Heiligtum tragend. Hinter ihm Musikanten mit Hafendeckeln, Pfannen, Feuerzangen und anderen Musikinstrumenten. Hinter diesen ein hagerer langer Mann mit einer segeltuchenen Mütze, an deren wulstigem Rande ringsum runde Schellen hängen, ihrer sieben, weshalb ein Teil der Leute im Litaneienton ausruft: »Heiliger Schellsiebener!« und der andere Teil beisetzt: »Bitt für uns!« – Diesem nach kommen die Buben mit den Laternen, der Pope mit den Mantelpagen, die blauen Fahnen und dann der Sarg. Hinter diesem das wirbelnde, johlende Volk, worunter mancher torkelnd und lallend oder mit verglasten Augen schlaftrunken dreingrinsend. Und doch wollen auch diese Invaliden des Prinzen noch mittun.
Er stirbt ja nur einmal – alle Jahre[1q].
Der Pope ruft in singendem Tone: »Nun stimmt an ein schönes Gesang, aber nit lang, nit lang, aber nit lang!«
Darauf beginnen die Burschen:
Männer, Weiber, Kinder, Hunde aus der ganzen Umgebung, aus den Wäldern, Gräben und ferneren Ortschaften – alles durcheinander, singend, grölend, lachend, bellend – so wirbelt’s und trudert’s hinaus, über die lehmigen Felder hin gegen den Ruppersbacher Friedhof. Vor dem Tore desselben biegt der Zug ab in die bestrüppte Schlucht, alldorten ist aufgetan das Grab. Unter hohlem Gedröhne wird der Sarg hinabgelassen und der Pope hält die Grabrede:
»Königliche Hoheit, Prinz Karneval!
Was du hast getrieben, das war ein Skandal! Aber komm doch bald wieder einmal. Wir werden dich nimmer vergessen. Bei dir haben wir gut getrunken und gegessen. Tanzende Dirnlein hast uns gebracht, hast uns unterhalten Tag und Nacht, den Kopf hast uns schwer, die Taschen leichter gemacht. Aschen, Aschen! sonst haben wir heut nix mehr zu naschen. Fleischliche Hoheit, so heißt es jetzt scheiden. Dein Denkmal steht beim Wirt auf der Tür mit der Kreiden. Rekiskart in bazi – wer’s nit glaubt, den kratz ih!«
Die Menge stimmt neuerdings Lieder an, hier: »O du lieber Augustin!« dort: »Alleweil fideel, fideel!« weiter hinten: »In Ruppersbach ist’s lustig, in Ruppersbach ist alles frei, da gibt’s ka Polizei!«
Derweil werden am Grab die Stallaternen ausgelöscht und von den Fahnenstangen die Weiberschürzen herabgerissen. An Fridolins Stab wird das Symbolium enthüllt: Im Strohkranz eine leere Brieftasche, beim Lederläppchen an der Stange festgenagelt. Vom Sarge ziehen sie das schwarze Tuch weg, ein altes Faß mit gähnendem Spundloch. Und im Fasse ist aller Sinnenlust Geheimnis enthalten – es ist leer. Oder wäre Prinz Karneval schon wieder unterwegs? Ist das nicht der ewige Jude in der Narrenkappe? Ein König, in dessen Reich die Sonne nicht untergeht.
Der Pope schüttelt seinen mit Ruß geschwärzten Küchentopf vom Haupte, daß er auf der Erde zerschellt, und wirft die dunkle Pferdedecke ab. Steht einer da, der nicht hätte vermutet werden können unter den Trauergewändern. Ein kleiner, schlanker, behendiger Mann in Steirergewand, an dem von aller schwarzen Zier nichts übrig geblieben als der lange schwarze Bart und das schöne schwarze Auge, das jetzt so klug und schalkhaft ernst in die Welt blickt. Und ist’s der Michel Schwarzaug, genannt der Wirt »Zum schwarzen Michel« in Eustachen.
Die Narrheit ist abgetan, begraben – und wohl gar lebendig begraben, maßen sie, wie genugsamlich bekannt, unsterblich ist.
Die Leute sind ruhig und sittig geworden und plaudern miteinander, als ob nichts gewesen wäre. Dann zerstreuen sie sich und gehen gelassen heim, mit einer rechten Befriedigung, auch dies Jahr den Aschermittwochsbrauch redlich mitgespaßt zu haben.
Försters Fridolin, der die leere Brieftasche getragen, dem wäre noch ums Singen. In dem hübschen, blondköpfigen Jungen zuckt das warme Leben. Aber jetzt ist Fastenzeit geworden, ganz plötzlich, frostig – wie ein Reif im Mai. Er sieht, wie die anderen Burschen ihre grünen Hüte abziehen und die Federn aus dem Bande reißen. Auch er nimmt sein Lodenhütlein ab, hält es vor sich in die Luft hinaus und schaut das schöne Gefieder an – vom Wildhahn, den er im vorigen Frühjahre geschossen hat auf der Seealm. Soll auch er dieses Zeichen junger Mannhaftigkeit wegwerfen? Ist nicht die krumme Hahnenfeder wie ein Fragezeichen: Dirndel, bist du zu haben?
In einem Schnaderhüpfel singt er den Gedanken hinaus. Da lacht ein anderer Bursche: »He, he, der braucht erst ein Fragezeichen!« Und wies auf den hochstehenden Federstoß seines Hutes: »Schau den an! Das ist kein Fragezeichen, das ist ein Ausrufungszeichen, wer’s von der Schul her noch weiß, was das ist. Ja, mein Lieber!«
Der Friedl stellte sich gerade einmal so hin vor diesen jungen Mann mit den schlaffen Wangen und den langen plumpen Kinnbacken und schaute ihn munter an und rief:
»Du ein Ausrufungszeichen? So ein kreuzsauberen Kerl wird sich doch nit erst ausrufen müssen!«
Der andere, der Wegmachergehilfe Kruspel war’s, stutzte ein wenig und erwog, ob das gelobt oder gefoppt sein sollte, und zupfte mit scharfen Fingernägeln am Mundwinkel, wo ein zartes falbes Schöpfchen war.
»Wart, Kruspel!« sagte der Försterische lachend und schlug ihm zärtlich die flache Hand auf den Nacken, »auf dem Mittfastenmarkt demnächst kauf ich dir ein Zangerl, daß du dir dein’ Schnurrbartel besser kannst herausziehen.«
Jetzt wußte der Kruspel schon, wie er dran war. »Du!« drohte er. »Keine Amtsbeleidigung! weißt du, ich bin kaiser-königlicher Straßenschotterer! Ja, mein Lieber!«
»Wohl, wohl,« sagte der Friedl. »Du bist ein Kaiser-königlicher, du. Aber weil du für einen Soldaten viel zu schön gewachsen bist zum Derschossenwerden, so laßt dich der Kaiser bei der Straßenschotterei.« Harmloses Lachen milderte den Spott. »Aber jetzt, Buben,« er wendete sich an die übrigen, denn sein Fußsteig zweigte hier ab gegen das Forsthaus, »behüt euch Gott und am Sonntag nachmittag! Rodeln! Vergeßt nit drauf!«
»Ja, rodeln, wenn kein Schnee mehr ist!«
»Auf der Siebentaler-Leiten Schnee genug. Laßt euch Zeit miteinander und laßt euch’s Fasten schmecken!«
Als er oben am Rande des Lärchenwaldes hin ging gegen das Hochtal, hörte man ihn noch singen und jodeln. So läutet undämpfbare Jugendlust die Fastenzeit ein.–
Dem Wirt »Zum schwarzen Michel« war bei der Heimkehr von diesem Leichenbegängnisse der Pfarrer von Ruppersbach begegnet, dessen Talar mit den beiden schwarzen Schleifen im Winde flatterte. Er war ein Benediktiner.
»Mir scheint, bei euch Eustachern muß man auch manchmal ein Auge zudrücken,« so grüßte der Pfarrer den Wirt.
»All zwei, Hochwürden, wenn wir dürften bitten. Und hübsch fest zudrucken.« Er sagte es mit Bedacht. »Ist mir schon selber ein bissel uneben aufgefallen heut, wie ich die alten Sprüchlein so hab hergesagt. Sapperlot, so was kunnt fuchsfeuerfaul sündig auch noch sein! der Teuxel noch einmal! Aber halt abkommen lassen tut man’s doch nit gern, die alten Sitten. Wenn man die lustigen Bräuch all tät abbringen, wollt’s doch ein bissel gar zu traurig werden auf der Welt.«
»Na, na, Michel, wenn’s einmal auf euer Faschingbegraben ankommt, daß ihr die Welt wieder lustig macht, dann laßt euch nur schnell auch selber mit begraben, ’s ist die höchste Zeit. Ihr seid mir schon auch die Rechten, ihr!«
Schmunzelte der Wirt, zupfte den Pfarrer am Talarflügel und flüsterte vertraulich: »Nit giften, Herr Pfarrer, schauns, in der Stadt drin tuns den Fasching nit begraben, dort lassens ihn leben bis schier in die Palmwochen hinein, und noch um Mittfasten fliegen die Kittel und blädern die Hosen auf dem Tanzboden. Bei uns da kunnt er auch so lang leben, der Lump, wenn wir ihn nit am Aschermittwoch so sorgfältig täten begraben. Seins froh, Herr Pfarrer, daß wir eine Lustbarkeit draus machen. Täten wir ihm nachweinen, dem Galgenstrick, das wär gar noch schlimmer. Ist’s nit wahr?«
»Du hast recht, da ist’s mir schon lieber, ihr begrabt ihn beizeiten und lacht dazu,« sprach der Pfarrer, »wenn den Leuten bei diesem Faschingbegraben nur auch einmal was Rechtes einfallen wollte.«
»Viel Gescheites kann einem dabei freilich nit einfallen.«
»Zum Beispiel, was am Ende denn so eigentlich recht übrig bleibt von aller Weltlust!«
»Weiße Ziffern auf der schwarzen Tafel, Herr Pfarrer.«
»Und ein – hohles Faß. Gleichnisweise genommen.«
»Versteh schon, versteh schon. Daß die ganz Welt eine hohle Nuß ist oder ein hohles Faß. Ist mir auch schon eingefallen. Und jetzt derohalben möcht ich schier meinen, weil inwendig nix ist, sollt man auswendig bissel was machen. Kommens doch bald wieder einmal auf Besuch, Hochwürden.«
»Wenn der Michelwirt nicht wieder gar zu gescheit wird. Da kann unsereiner nicht mit. Aber singen, das wohl. Wann wird denn wieder gesungen?«
»Wann der Will. Allzeit aufgelegt. Heißt das, wenn der Baß nit bei den Bären ist.«
Der Baß, das war der Förster Rufmann, dessen Amt es freilich weniger sein konnte, im Wirtshause zur Zither zu brummen als in den Wäldern bei den Holzknechten. Mußte manchmal das letztere, tat aber lieber das erstere.
Von Michels Haus- und Lebensgenossen
Der kleine schwarze Michel war noch nicht heimgekehrt in sein Wirtshaus. Da war’s wie ein Weltgericht – in diesem Wirtshaus. Mägde scheuerten in der Gaststube die Tische, die Bänke und den Fußboden. Da gab’s noch viel Fasching hinauszuschwemmen. Die letzten drei Tage und Nächte waren üppig gewesen!
Diese Gedenkschrift hatte einer hinterlassen, mit Kreide verewigt auf dem braunen Brette des Uhrkastens. Und nicht weniger bedeutsam waren die Reihen der Namen und Ziffern, die auf der Tür standen.
Die Pipen im Keller tröpfelten nur mehr in die untergestellten Holznäpfe, der säuerliche Weingeruch durchatmete noch das ganze Haus. In der Küche war das Herdfeuer ausgegangen. Das Küchenmädel hatte unter den Tischen und Bänken einen großen Korb voll Knochen gesammelt und dieselben draußen im Viehhof ausgeschüttet auf den Dunghaufen.
Frau Apollonia, die Wirtin, siebte in der Küche Fisolen[2]. Das wird von jetzt ab das tägliche Brot sein bis zum Ostersonntag, da wieder die Fleischtöpfe brodeln werden. Sieben Wochen lang Fisolen! Der Frau war das recht. Sie, die am Herde fast allein vom Speisenduft satt wurde, konnte nie begreifen, wie die Leute denn so viel zusammenessen und trinken könnten. Und sterben doch nicht dran. Sie war indes überzeugt, daß viel mehr Leute sich zu Tode essen als zu Tode hungern. Aber das sagte die Wirtin nicht. Sie sagte überhaupt nichts von all den tausend Dingen, die nicht gerne gehört werden. Und da unter Umständen nichts gerne gehört wird als das, was man sich selber sagt, so fand Frau Apollonia alles Reden für eine überflüssige Ausgabe und sagte am liebsten gar nichts. Sie war eine ruhige, schlanke Frau, bei der die Küchenschürze hinten zusammenlangte. Ihr Auge hatte – wenn man in einem musikalischen Wirtshause auch von Farben musikalisch sprechen dürfte – einen lichtgrauen Ton, nicht allzutief gestimmt. Sie war nicht seicht und nicht tief, sie war praktisch. Ihr schon grauendes Haar über dem schmalen Gesicht war in der Mitte gescheitelt; sie sah eher wie eine Mädcheninstitutsvorsteherin aus als wie eine Dorfwirtin. Ihr Schweigen nahm sie so ernst, daß man sie auch nie zanken hörte; ein Blick, ein Wink, und die Mägde wußten, wie sie daran waren.
So ging in der Küche alles stets friedlich ab, und die Mägde, die Frau Apollonia einmal aufgenommen, wurden alle bei ihr alt; keine wollte fort, außer wenn der Freier kam, und da gab es einen Kasten voll Flachs oder Leinwand als Heiratsgut.
Niemals kam jemand geradehin betteln zur Michelwirtin. Bisweilen wohl humpelte ein Armer zur niederen Küchentür herein, setzte sich im Winkel auf eine Bank und seufzte ein Erkleckliches. Nichts weiter. Dann kam die Wirtin und fragte nach dem Anliegen, teilte eine Gabe, und den Dankesworten winkte sie mit der Hand ab. Kein Mensch in Eustachen lobte die Frau Apollonia, im stillen geehrt war sie von allen. Es war auch schon selbstverständlich, wer ein Anliegen hat, der geht zur Frau Apollonia.
Manch einer oder eine ist freilich umsonst gegangen, und zu solchen redete sie: »Du lieber Mensch, du! Gern, daß ich dir was wollt geben, aber schau, du bist halt ein Lump. Wenn du brav wirst, nachher darfst schon kommen.« Und das sagte sie so freundlich und mütterlich, daß die Abgewiesenen schier wie geehrt davongingen und es weiter sagten, was die Michelwirtin für ein »gutes Leutel« ist. Manch einer kam später wieder mit der Nachricht, er glaube sich beim Lumpbleiben doch besser zu stehen als mit der Freundschaft der schweigsamen Michelwirtin.
Unter einer solchen Frau und Mutter war auch das einzige Kind aufgewachsen, die schlanke blonde Helenerl. An Gutmütigkeit und Schweigsamkeit war sie ihrer Mutter ganz ähnlich geworden. Ob der Mutter jedoch die Freudigkeit je einmal so aus den Augen gelacht hat wie dieser Tochter? Wo es lieblich und froh herging – war es im Garten bei dem gedeihenden Gemüse oder bei den still brennenden Blumen, oder im Hofe bei den regen Hühnern und Küchlein, oder bei den tollenden Nachbarskindern, oder war es bei harmlosen Sängern in der Gaststube – da war sie gern in der Nähe. Aber womöglich im Hinterhalte. Ausgeben mochte sie sich nicht, nur immer in sich aufnehmen, von den Blumen das Blühen, von der Sonne das stille Lachen, von den Kindern die unschuldige Lust. Es war, als ob sie aller Welt Frohheit in sich sauge und davon schon einen so großen Vorrat gesammelt habe, daß er einmal explodieren wird, wenn der rechte Zunder dazu kommt. Es gab freilich auch Meinungen darauf hin: Explodieren würde an diesem Mädel nie etwas, das werde, wie die Mutter ist, immer klug, gelassen und freundlich sein. Vielleicht als Zugabe ein bißchen schalkhafte Trutzigkeit vom Vater. So wie sie vom väterlichen Schwarzaug und vom mütterlichen Grauaug das schönste Blauaug erhalten hatte, so durfte man wohl auch in ihrer Seele die Sanftmut und Gleichmäßigkeit der Mutter, gleichwie künftig noch die überschwengliche Lustigkeit und die zeitweilige traumhafte Wehmut des Vaters zu finden hoffen.
Da zum Wirtshause auch eine größere Landwirtschaft gehörte, so gab es nebst der bewegsamen Kellnerin und dem derben Hausknecht auch noch Alt- und Jungknechte, Mägde und halbwüchsiges Volk. Das Gesinde hielt im nahen Wirtschaftsgebäude seine Ständigkeit.
Das waren nun die Hausgenossen Michels, des kleinen Wirtes mit den kurzen, stets emsigen Beinen, mit dem schwarzen langen Bart und den dunklen Augen, in denen immer Kohlenglut gloste, manchmal auch sprühte.
Zwischen dem Michel und seiner Frau schien eine Gegensätzlichkeit vorhanden zu sein, deren Tiefe nicht ergründet war. Da es nie einen Sturm gab, wie solcher auf seichten Gewässern leicht vorkommt, so riet man auf eine große Tiefe. Michels Abstand zu dem stillen, blühenden Töchterlein war gerade so groß, daß er sie mit einer Art frommen Wohlgefallens betrachten und mit einer zarten Verschämtheit anbeten konnte. Er ahnte es kaum, daß er sie anbetete, hatte es noch nicht einmal so weit gebracht, ihr offen zu sagen, wie sehr er sie lieb hatte. Zu jedem Gast konnte er »mein Lieber« sagen, zu der schönen Gastin erst recht »meine Liebe!«. Geschätzte und liebe Muhmen und Schwägerinnen hatte er eine Menge; aber eine »liebe Tochter«, ein »liebes Kind« gab es nicht, dafür hatte er sein Helenerl zu lieb.
Mit Frau Apollonia stand das insofern anders, als er sie in früheren Jahren wirklich etlichemale mit: »Ja, meine Liebe!« angesprochen hatte. Weil solches aber zumeist nur bei größeren Meinungsverschiedenheiten und in gereiztem Tone geschah, so kam der Ausdruck in eine zweifelhafte Stimmung. Und als sie mit der Zeit in allem ganz einig geworden, weil eins das andere hatte verstehen und behandeln gelernt, so ist das Wort »lieb« endlich gar nicht mehr ausgesprochen worden oder höchstens vielleicht in Augenblicken, da die Zunge nicht mehr weiß, was sie spricht und ihr Stammeln auch gleichgültig ist.
Die Ehegatten hatten übrigens ihr getrenntes Bereich auch in der Wirtschaft. Frau Apollonia kam gar selten aus ihrer Küche hervor. Er ließ sie im Haushalte gewähren und war froh, der Sorgen enthoben zu sein und sich seinen Gästen heiter oder auch ernsthaft widmen und sich seinen Liedern und Büchern hingeben zu können. Er hatte so seine Passionen, mit denen er der Frau Apollonia allerdings nicht kommen durfte: ihr war alles Nachdenken über Himmel und Erden zum mindesten unnütz, wenn nicht Frevel. Der Michel hingegen war manchmal wie eine Spinne, die ihre Fäden spinnt und wartet, wohin der Wind sie tragen wird; dorthin nahmen dann seine Gedanken ihren Weg, gleichgültig, ob in Höhen oder Tiefen, nur fort ins Ungemessene und Traumhafte.
Für solche Ausflüge in unbekannte Welten hatte er einen Freund, der ihn nicht ungern begleitete. Das war der Förster Paul Rufmann. Mitdenken und mitreden konnte zwar auch der nicht viel, um so erstaunter jedoch zuhören, wenn der Michel seinen jetzt tiefsinnigen, jetzt wieder krausen Gedanken freien Lauf ließ. Am besten verstanden diese Freunde sich – im Singen. Kamen sie im Wirtshause zusammen, so sangen sie ihre Volkslieder nach der Zither; kamen sie im Forsthause zusammen, so sangen sie nach der Laute, und waren sie im Walde selbander, so sangen sie ohne Begleitung – der Michel in Tenor, der Paul in Baß. Übermütige Gesänge aus dem Wald- und Almleben, aber auch uralte Weisen, in denen jauchzende Lust oder blutiges Leid oder inniges Gebet der Ahnen zu uns herüberhallen.