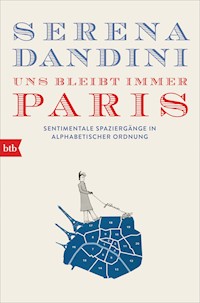9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf den Spuren von Lee Miller - Fotografin, Kriegsreporterin, leidenschaftliche Reisende.
Sie gilt als eine der modernsten Frauen der Welt: Die Amerikanerin Lee Miller (1907 -1977). Berühmt geworden als Model und Muse erfolgreicher Männer wie Man Ray und Pablo Picasso, lebte sie schon bald ihre eigene Berufung: als erfolgreiche Fotografin, Kriegsreporterin und leidenschaftliche Reisende. Ihre für die amerikanische Vogue verfassten Reportagen über das Naziterrorregime in Deutschland gingen um die Welt. Nachdem sie Zeugin der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau geworden war, fotografierte David Sherman Lee Miller im April 1945 in der Badewanne der Münchner Wohnung Adolf Hitlers. Das Foto sowie weitere Zeugnisse ihres aufregenden Lebens wurden erst nach dem Tod Millers auf dem Dachboden ihrer Farm in Sussex, England, wiederentdeckt. Serena Dandini würdigt Lee Miller als eine der außergewöhnlichsten Frauen des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Die Amerikanerin Lee Miller (1907–1977) gilt als eine der modernsten Frauen der Welt. Berühmt geworden als Model, Geliebte und Muse erfolgreicher Männer wie Man Ray und Pablo Picasso, lebte sie schon bald ihre eigene Berufung: als erfolgreiche Fotografin, Kriegsreporterin und leidenschaftliche Reisende. Ihre für die amerikanische Vogue verfassten Reportagen über das Nazi-Terrorregime in Deutschland gingen um die Welt. Nachdem sie Zeugin der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau geworden war, fotografierte David Sherman Lee Miller im April 1945 in der Badewanne der Münchner Wohnung Adolf Hitlers. Das Foto sowie weitere Zeugnisse ihres aufregenden Lebens wurden erst nach dem Tod Millers auf dem Dachboden ihrer Farm in Sussex, England, wiederentdeckt. Serena Dandini würdigt Lee Miller als eine der außergewöhnlichsten Frauen des 20. Jahrhunderts.
Zur Autorin
SERENADANDINI (Jahrgang 1954) ist eine der bekanntesten italienischen Fernsehmoderatorinnen und Journalistinnen. Sie ist die Autorin verschiedener Sachbücher und Romane.
Serena Dandini
Die Frau in Hitlers Badewanne
Aus dem Italienischen von Franziska Kristen
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »La vasca del Fuhrer« bei Giulio Einaudi editore s.p.a., Turin.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2023,
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2020 by Serena Dandini
Published by arrangement with S&P Literary – Agenzia letteraria Sosia & Pistoia
Illustrationen © Andrea Pistacchi
Covergestaltung: Semper Smile nach einem Entwurf von Ricardo Falcinelli für Enaudi unter Verwendung eines Covermotivs gestaltet von den Illustratoren Ale+Ale
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
SL · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-28769-6V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Elia
»In seiner Badewanne habe ich mir den Dreck aus Dachau abgewaschen.«
LEE MILLER
Prinzregentenplatz 16, München, 30. April 1945
Die Kacheln des Badezimmers sind glatt und kalt. Alles ist blitzblank, wie in einem Hotelzimmer, das für irgendwelche Kunden vorbereitet ist. Die makellos weißen Handtücher hängen der Größe nach an den verschiedenen Haltern und warten darauf, vom nächsten Gast benutzt zu werden. Es sind dieselben, die den Körper jenes monströsen Mannes umhüllt und bedeckt haben, dessen Namen Lee nicht einmal auszusprechen vermag. Nur das Monogramm »A. H.« auf dem Silberzeug verrät die Identität des Besitzers.
Während sie in diese anonymen, nichtssagenden Räume eindringt, wird immer und immer wieder eine Frage in ihrem Kopf laut. Eigentlich ist es eher ein unterdrückter Schrei als eine Frage: Weshalb ist nirgendwo das Böse sichtbar, das in diesen Zimmern wohnte? Schlichte bürgerliche Ehrbarkeit spricht aus jedem Detail. Wie ist es möglich, dass das dezente Mobiliar, die blauen Damastvorhänge und die dunklen Holztischchen nichts von dem teuflischen Wesen erzählen, das so lange unbehelligt zwischen diesen Wänden gelebt hat? Lee läuft durch eine Wohnung, die dem bescheidenen Wohlstand eines städtischen Angestellten oder eines pensionierten Prälaten mit einer Vorliebe für klassische Kunst und deren wertlose Reproduktionen hätte entsprechen können. Kann man Millionen von Menschen grausamen Schmerz zufügen und gleichzeitig leben wie »anständige Leute«, billigen Nippes und bestickte Sofakissen sammeln?
Lee hatte es geschafft, ihre Übelkeit beim Anblick des Grauens von Dachau zu unterdrücken. Nun, angesichts der Wohlanständigkeit des Bösen, spürt sie, dass sich ein Abgrund unter ihr öffnet. Den ganzen Tag lang hat sie mit ihrer Rolleiflex Fotos geschossen, hat keine Zeit verloren und sich nicht von ihren Gefühlen überwältigen lassen, hat in hektischer Eile einen Film nach dem anderen verbraucht: Sie gehört zu den wenigen Frauen unter den Fotografen, denen man gestattet hat, ein deutsches Konzentrationslager zu betreten. Sie hat gegen Vorschriften und Vorurteile angekämpft, um dorthin zu gelangen, hatte nicht klein beigeben dürfen. Sie musste das dokumentieren, was ohne den direkten Beweis der Bilder niemand für real halten würde. Zusammen mit den Filmen hat sie ein Telegramm mit den schlichten Worten »Glaubt mir, es ist alles wahr!« an die Vogue geschickt. Sie bezweifelt, dass ein Modemagazin den Mut aufbringen wird, jenen Albtraum, deren Zeugin sie geworden ist, auf Hochglanzpapier zu drucken: Berge von Körpern, die bereits vor dem Tod Skelette waren, ohne Namen, ohne Würde, mühsam mit dem Bagger in ein Gemeinschaftsgrab verfrachtet, um Seuchen abzuwenden. Aber die Fotos würden nicht ausreichen, sie würden höchstens andeutungsweise jene Szenen zeigen, mit denen sich die 45. Infanteriedivision der 7. US-Armee konfrontiert gesehen hatte. Niemals würden die Aufnahmen den Geruch der Leichen wiedergeben, die sich auf den Güterzügen stapelten, jenen heftigen Gestank, der den Soldaten bereits in etlicher Entfernung vom Lager entgegengeschlagen war. Anfangs hatten sie geglaubt, es handle sich um Giftgas, das die Deutschen zur Abwehr der Alliierten einsetzten. Sie ahnten nicht, dass dieser unerträgliche Geruch von dem verwesenden Fleisch Hunderter lebloser menschlicher Körper stammte, die sich selbst überlassen im Sonnenlicht verfaulten.
Der Widerstand, den sie in Dachau gegen den Schmerz geleistet hat, ist in der Wohnung, in der der Teufel lebte, gebrochen. Niemand hat das Recht, nach der Hölle zu überleben. Auch sie nicht.
Sie ringt nach Atem in dem makellosen Badezimmer, zwei Tränen, schwer wie Glasperlen, haften auf ihren versteinerten Wangen, genau wie auf dem Porträt, das Man Ray etliche Jahre zuvor von ihr aufgenommen hat: eine surrealistische Szene, die sich in Realität verwandelt hat. Und wieder ist es ein Aufflackern der Vergangenheit, das sie rettet: Sie ist kurz davor zusammenzubrechen, doch sie vertraut auf ihre Lebenskraft, die sie in düsteren Momenten stets geleitet hat.
Einem kindlichen Impuls folgend, dreht sie den Hahn auf. Nach Monaten in Feldlagern und notdürftigen Unterkünften ist sie hingerissen von der Wärme des Wassers. Der Krieg klebt an der Uniform, die ihr zur zweiten Haut geworden ist. Sie zieht sich aus und entblößt einen lebendigen Körper, den zu besitzen sie ganz vergessen hatte; mühsam entledigt sie sich der schweren, schlammverkrusteten Stiefel, die das unschuldige Weiß dieses Ortes verunreinigen. Ein Ort, so falsch wie ein Filmset, das nicht mehr gebraucht wird.
Der Film ist zu Ende, und mit der ihr eigenen Dreistigkeit taucht Lee in die Badewanne des Führers ein.
Woran denkt diese so schöne und sinnliche Frau, während sie sich die Schultern einseift und darauf wartet, dass ihr Kollege David Scherman endlich jenes unerhörte Foto schießt? Ich kann meine Augen nicht von dem Bild losreißen und versuche, den undurchdringlichen, fast abwesenden Blick der Kriegsreporterin Lee Elizabeth Miller zu ergründen, die während des Zweiten Weltkrieges für das Militär der Vereinigten Staaten tätig war. Diese Fotografie, die ich wie hypnotisiert anstarre, ist bis ins kleinste Detail durchdacht.
Die Uniformhose liegt zusammengefaltet auf dem Schemel neben der Wanne; die Stiefel, an denen der Schlamm aus Dachau klebt, liegen achtlos auf dem Boden: Bevor sie sich ihrer entledigt hat, hat Lee sie, zum Zeichen der Schmähung, auf dem schneeweißen Läufer abgestreift und ist dann langsam eingetaucht. Jemand klopft an die Tür. Sie müssen sich beeilen, nach der Befreiung der Stadt haben die Alliierten die Wohnung beschlagnahmt, und alle wollen in dieses Badezimmer, denn in Kriegszeiten sind warmes Wasser und saubere Handtücher kostbarer als Benzin und Zigaretten. In der Wohnung und in ganz Bayern herrscht Ausgelassenheit, aus den Geheimkellern des Führers kommt flaschenweise Markenchampagner zum Vorschein, und man stößt auf das nahe Ende des Konflikts an. Die Russen sind in Berlin einmarschiert, und die Kapitulation wird schneller kommen, als man glaubt. Zu genau der Zeit, als Lee ihre profane Waschung vollzieht, nehmen sich Hitler und Eva Braun, nachdem sie am Vorabend geheiratet haben, im Bunker der Reichskanzlei das Leben. David und Lee wissen noch nichts davon. Es ist eine der vielen so typischen Koinzidenzen im Leben dieser faszinierenden und geheimnisvollen Frau, mit der gemeinsam sich der amerikanische Fotoreporter David Scherman auf das Abenteuer an der Front eingelassen hat. Er ist schüchtern, nicht gerade hübsch, aber intelligent und geistreich; sie ist kühn, wunderschön und scheint vor nichts Angst zu haben. Beide verbindet eine aufrichtige Freundschaft, die durch die tagtägliche Gefahr an vorderster Front, angesichts der permanenten tödlichen Bedrohung, um die man sich nicht mehr schert, nur noch gestärkt wird. Sie haben auch eine Liebesaffäre, aber das ist nur ein Detail.
Während Lee ihr Bad vorbereitet, vertreibt sich Scherman die Zeit damit, Sergeant Arthur E. Peters zu fotografieren, der, ausgestreckt auf Hitlers Bett, in die Lektüre von »Mein Kampf« vertieft ist. Vermutlich handelt es sich um eines jener signierten Exemplare, die der Führer seinen Gästen freundlich überreichte. Der Schnappschuss landet unter der Überschrift Get your Feet out of my Bed auf der Titelseite des Magazins Life und macht Scherman nach der Befreiung zu einem der bekanntesten Kriegsberichterstatter. Es ist das perfekte Foto, um den Sieg der Alliierten zu besiegeln, mit genau dem richtigen Maß an Witz und Verspieltheit.
Das Bild von Lee in der Badewanne des Führers lässt einen dagegen erschaudern. Nach Kriegsende verschwindet die Aufnahme auf dem Dachboden ihres Hauses in Sussex in einem Pappkarton, zusammen mit Negativen, Briefen und persönlichen Gegenständen. Nach ihrer Heimkehr von der Front vollzieht die Fotoreporterin eine ihrer zahllosen Metamorphosen und entledigt sich akribisch jeder Spur der eigenen Vergangenheit. Alles, was sie betrifft, einschließlich des Fotos in Hitlers Badewanne, wäre für immer in Vergessenheit geraten, wenn es der Zufall nach ihrem Tod nicht anders gewollt hätte.
Die Aufnahme in der Badewanne ist auf den 30. April 1945 datiert, und scheinbar hat sie nichts mit all den anderen zu tun, die Lee Miller in den Konzentrationslagern von Buchenwald und Dachau aufgenommen hat. Bei der Durchsicht der Bilder jener dramatischen Tage stößt man auf eine ununterbrochene Kette des Grauens: Leichen, die sich wie Abfall übereinandertürmen, Gefangene, die ihre ausgemergelten Gesichter dem Objektiv zuwenden, Schädel, in denen als einziges Zeichen von Leben ungläubige, verängstigte Augen funkeln. Es sind die Bilder, die die Deutschen jahrelang verfolgen werden und die uns in Schwarz-Weiß ins Gedächtnis rufen, was tatsächlich geschah in den Todesfabriken. Lee dokumentiert auch die auf die Knie gesunkenen SS-Wachen, die vergeblich um Gnade flehen, ohne Stolz und mit von Schlägen geschwollenen Gesichtern. Als »wohlgenährte Bastarde« bezeichnet Lee sie in dem Artikel für die Vogue. Den eleganten Leserinnen, die sicher nicht damit rechnen, in ihrer Lieblingszeitschrift zwischen Werbung für Feuchtigkeitscreme und der neuesten Hutmode derart krasse Augenzeugenberichte zu finden, bleibt nichts erspart.
Doch das Foto in der Badewanne, das mich nach wie vor nicht loslässt, ist mehr als nur ein Kriegszeugnis, es scheint ein privates Porträt zu sein, das Lee eher für sich selbst als für historische Zwecke hat aufnehmen lassen. Der Bildaufbau ist bis ins Detail durchdacht, wie bei den zahlreichen von Lee stammenden Modereportagen: Licht und Schatten sind professionell aufeinander abgestimmt, die Gegenstände kunstvoll arrangiert, fast wie bei der Komposition eines Gemäldes. Aber es handelt sich nicht um eine Inszenierung. Lee Miller badet tatsächlich in der Wanne des Führers, in Bayern, in der Wohnung am Prinzregentenplatz, derselben, die der oberste Befehlshaber des Dritten Reiches mit seiner Geliebten Eva Braun und zuvor mit seiner jungen Nichte Angelika Raubal, genannt Geli, geteilt hat, über die Hitler sagte, er habe sie mehr als alles andere auf der Welt geliebt. Die junge Frau wurde am 18. September 1931 genau hier tot aufgefunden; offiziell war es Suizid: ein Herzschuss mit der Walther, der Pistole ihres Onkels Adolf. Ihr Ende bleibt geheimnisumwittert. Jemand hat geschrieben, dass Staatsanwalt Franz Gürtner die Ermittlungen im Sande verlaufen ließ und, welch merkwürdiger Zufall, Jahre später zum Justizminister des Reichs ernannt wurde.
Während der Nürnberger Prozesse erklärte Hermann Göring: »Gelis Tod hatte solch verheerende Auswirkungen auf Hitler. Es hat seine Beziehung zu allen anderen Menschen verändert.« Zur Bewältigung dieses Traumas hätte Hitler besser daran getan, einen namhaften Arzt wie Sigmund Freud aufzusuchen – der übrigens, ebenso wie Hitler, Wien zu seiner Wahlheimat erhoben hatte –, statt den Vater der Psychoanalyse zusammen mit Millionen anderer Juden zur Flucht zu zwingen. Wobei diese noch zu den Glücklicheren gehörten, da es ihnen wie durch ein Wunder gelang, sich der »Endlösung« zu entziehen, die die systematische Vernichtung aller Juden zum Ziel hatte. Doch nach dem, was Lee und ihre Kollegen gesehen und fotografiert hatten, konnte niemand mehr behaupten, das seien bloß an den Haaren herbeigezogene Behauptungen, um den Nationalsozialismus zu verunglimpfen: Auch die Bewohner des freundlichen Städtchens Dachau, die man dazu zwang, das Grauen des Lagers mit eigenen Augen anzuschauen, konnten das Offenkundige nicht länger bestreiten. »Das Lager liegt so nahe am Stadtrand, dass die Einwohner ohne jeden Zweifel gewusst haben müssen, was hier vor sich ging«, heißt es in dem Artikel, den Lee auf ihrer Hermes-Schreibmaschine für die Vogue verfasste. Schreiben war für Lee eine Qual, eine unumgängliche Tätigkeit, die ihr körperliches Unbehagen verursachte, so als müsste sie Wort für Wort aus dem Felsgestein ihres Gedächtnisses meißeln. Um einen Artikel fertigzustellen, brauchte sie oft eine ganze Nacht und mindestens eine Flasche irgendeines an der Front verfügbaren alkoholischen Getränks. Wohingegen das Fotografieren ein ganz natürlicher Akt war, wie das Atmen. Die Bildsequenzen mit ihrer Rolleiflex entstanden wie von selbst, fast ohne Ausschuss, und jede Aufnahme brachte eine verborgene Seite zum Vorschein. Es gab keine Filter, keine Distanz zwischen dem Objektiv und dem, was Lee sah. Sie hatte sogar das Visier ihres Uniformhelms abmontiert, damit nichts sie daran hindern konnte, die Realität unmittelbar zu erfassen. Die namhafte Fotografin für Life, Margaret Bourke-White, hatte ihr erklärt, dass man, um an vorderster Front arbeiten zu können, eine Art Nebelwand zwischen den persönlichen Gefühlen und der Grausamkeit der festzuhaltenden Szenen errichten müsse. Es bedürfe einer Barriere, um nicht zusammenzubrechen. Doch eine derartige Rationalität und innere Ausgeglichenheit hat Lee nie gekannt, und in ihr einst so engelsgleiches Gesicht ist nun aller Schmerz der Welt eingeschrieben, endgültig, wie bei einem Negativ.
Ich starre weiterhin beharrlich auf dieses ungewöhnliche Foto, das so gar nicht der typischen Kriegsberichterstattung entspricht, und versuche zu begreifen, inwiefern es uns noch heute etwas über unsere Geschichte verrät.
Ein gerahmtes Hitler-Porträt lehnt an den Kacheln neben dem Seifenhalter. Mit missbilligendem Blick, einem ohnmächtigen Zeugen gleich, mustert der Führer die Nacktheit Lee Millers, die mit einem schamlosen Akt sein Badezimmer entweiht. Als Kontrast dazu hat Lee am rechten Bildrand eine kleine Marmorstatue nach dem Vorbild einer griechischen Venus aufgestellt, eine der zahlreichen billigen Reproduktionen aus dem Besitz des Führungskopfes des Dritten Reichs. Hitler war ein eifriger Verfechter des klassischen Stils, der in seinen Augen die ästhetische Reinheit der Kunst verkörperte, im Gegensatz zu der gefährlichen Dekadenz der Avantgardisten, die bezichtigt wurden, die Menschheit in Barbarei und Chaos zu stürzen. Der Surrealismus, zu dessen Mitstreitern Lee Miller gehört hatte, wurde ebenso wie der Expressionismus, der Dadaismus, der Kubismus und all die anderen von der Nazipropaganda abfällig als »Ismen« bezeichneten Strömungen aus den Museen des Reichs verbannt. In den Wohnungen des Führers findet sich keine Spur von Dalí, Picasso oder Kandinsky. Diese Namen gehören auf eine lange Liste verfolgter Künstler, sie sind Vertreter der sogenannten »entarteten« Kunst, die als schädlich für die gesunde Erziehung der Deutschen galt und daher beschlagnahmt und öffentlich verbrannt wurde. Oder die man heimlich zu hohen Preisen verkaufte, um den Traum eines staatlichen Museums finanzieren zu können, das dem neuen, vom Regime propagierten ästhetischen Ideal huldigen und, über den Weg der klassischen Kunst, den Mythos der arischen Rasse stärken sollte. Den jüdischen Familien und den Museen in den besetzten Ländern wurden viele Millionen Werke der Vergangenheit gewaltsam entrissen und in Erwartung des Endsieges in unterirdischen Verstecken und stillgelegten Minen versteckt. Während man die Meisterwerke der Avantgarde, die als kranker Ausdruck einer elitären Gruppe galten, vor ihrer Vernichtung in einer makabren Ausstellung der Öffentlichkeit präsentierte, auf der die Gemälde neben Darstellungen von Geisteskranken und missgebildeten Gesichtern hingen, um sie dem Gespött preiszugeben. Eine ästhetische Umerziehung, mit der alles an den Pranger gestellt wurde, das nicht in den neuen, vom Reich festgelegten Kanon passte.
Die Ausrottung des Schönen ist eine beliebte Waffe jeglicher wirksamen Propaganda. Und indem sich Lee Miller nackt in diese Wanne setzt, vollzieht sie einen persönlichen Exorzismus zur Abwendung des Bösen, einen künstlerischen Racheakt gegen die Brutalität der Macht. Wer, wenn nicht sie, einst eine der schönsten Frauen der Welt, wüsste besser, dass gerade die Schönheit das am heißesten umkämpfte Schlachtfeld ist? Seit damals sind über siebzig Jahre vergangen, doch diese Fotografie überwindet Zeiten und Ideologien und kann uns noch immer etwas sehr Wertvolles über die subversive Kraft des freien künstlerischen Ausdrucks vermitteln.
Heute werden wir mit unzähligen Bildern bombardiert. Sie prasseln aus allen Medien auf uns ein, wir sind ständig konfrontiert mit Neuem und Absonderlichem, mit dem unsere müde Aufmerksamkeit geweckt werden soll: Wir werden mit Filtern, Fotomontagen und den unterschiedlichsten Tricks verlockt, aber es wird immer schwieriger, uns tatsächlich mit etwas zu beeindrucken oder uns wirklich zum Nachdenken zu bewegen.
Die künstlerische Synthese der Aufnahme von Lee Miller ist dagegen so wirkungsvoll, dass unser Blick sofort gefangen genommen wird. Als ich entdeckte, dass es sich um die Momentaufnahme einer Berichterstatterin des Zweiten Weltkriegs handelt, war meine Neugier derart geweckt, dass ich nicht anders konnte, als in ihre Geschichte einzutauchen.
»Äußerlich wirkte ich wie ein Engel. So sah man mich. Doch innerlich war ich ein Teufel. Ich habe allen Schmerz der Welt erfahren, seit meiner Kindheit.«
LEE MILLER
Poughkeepsie, 1915
Im Metropolitan Museum in New York ist ein Gemälde ausgestellt, das 1913, als es das amerikanische Publikum unter dem Titel Matinée de Septembre zum ersten Mal zu Gesicht bekam, für großes Aufsehen sorgte. Aus unserer heutigen Sicht ist es ein ziemlich harmloses, etwas kitschiges Bild: Zu sehen ist eine nackte junge Frau, die sich an einem hellen Septembermorgen schamhaft in das Wasser eines ländlichen Sees begibt. Der Künstler, Paul Émile Chabas, hatte nicht die Absicht, gegen die allgemein vorherrschende Prüderie zu verstoßen, doch der Kampf zwischen den über die jugendliche Nacktheit empörten Sittenwächtern und den Verteidigern jeglicher künstlerischen Freiheit machte das Bild derart bekannt, dass es in allen Zeitungen gedruckt wurde und Tausende von Postkarten mit seinem Motiv verkauft wurden.
In jenen Jahren beschäftigt sich der angesehene Ingenieur aus Poughkeepsie, Theodore Miller, in seiner Freizeit mit der neuen Kunst der Fotografie, und inspiriert von dem angeprangerten Gemälde und den heftigen Diskussionen, die es berühmt gemacht haben, beschließt er an einem kalten Dezembermorgen, einer seiner Privataufnahmen den Titel December Morning zu geben. Elizabeth ist erst acht Jahre alt und posiert inmitten einer verschneiten Landschaft, die einen frösteln lässt, nackt für ihren Vater.
Dieses Foto hat etwas Anrüchiges und Ungewöhnliches, das nicht in die hergebrachte Tradition der Familienalben passt, sondern der lasziven Fotografie nahekommt, die von Liebhabern dieses Genres heimlich gesammelt wird. Doch der Blick Elizabeths, die in der Familie alle Li-Li nennen, verrät weder Verlegenheit noch Scham. Herausfordernd schaut die Kleine in die Kamera, und sie scheint stolz darauf, dem Vater bei seinen Versuchen, die er »Kunst« nennt, gefällig zu sein.
Nacktheit ist im Hause Miller kein Tabu. Auch die Mutter, Florence, eine solide bürgerliche Hausfrau, hat schon unverhüllt für den Ehemann Modell gestanden, und in der Familie praktiziert man gern im Adamskostüm die sogenannte Heliotherapie, ein neuartiges Heilverfahren, das sich die positive Wirkung der Sonneneinstrahlung auf die Haut zunutze macht. Trotz ihrer offenkundigen Fortschrittlichkeit gehören die Millers zur guten Gesellschaft von Poughkeepsie, einer kleinen amerikanischen Provinzstadt am Ufer des Hudson River. Die Winter sind streng, und oft weht ein eisiger Wind, der den Fluss gefrieren und die Bäume erstarren lässt. Doch die kleine Li-Li, die bis auf ein paar ulkige Pantoffeln an den Füßen nackt ist, scheint sich inmitten des Schnees ganz in ihrem Element zu fühlen. Sie wirkt wie ein wildes junges Tier, das nichts von dem Objektiv ahnt, das sie wie die Flinte eines Jägers im Visier behält, um sie einzufangen. Sie würde dem Vater überallhin folgen, sie bewundert ihn, er ist ihr Held. Von klein auf hat sie Teil an den Wundern der Dunkelkammer, in denen Theodore jene Gestalten zum Leben erweckt, die er mit dem sie so faszinierenden Zauberkasten festgehalten hat. Noch ahnt Elizabeth nicht, dass die Vertrautheit dieses dunklen Raums ihr eines Tages zur geliebten Gewohnheit werden soll: ein sicherer Rückzugsort, um sich zu verstecken, eine Geheimkammer, in der sich die schöpferische Kraft des Surrealismus erproben lässt. Noch ist sie nur ein kluges und lebhaftes kleines Mädchen, das, statt mit Puppen zu spielen, lieber den für Jungs typischen Beschäftigungen nachgeht, fasziniert von den wissenschaftlichen Neigungen ihres Vaters, des Ingenieurs.
In der Fabrik, in der er arbeitet, ist Mr Miller ein hochgeschätzter Manager, doch für seine Kinder ist er ein Magier, ein technisches Genie, vergleichbar mit Samuel F. B. Morse, dem Erfinder des Telegrafen. Dieser hatte unweit von Poughkeepsie auf einem Anwesen mit einer Villa im italienischen Stil gelebt, die nach seinem Tod zu einem ihm gewidmeten Museum umgestaltet worden war. Es ist ein heiliger Ort für die Familie Miller. An den Wochenenden pilgert sie oft zu der Gedenkstätte des Wissenschaftlers, um dessen Erfindungen und Zeichnungen zu bewundern.
Wissenschaft ist die Religion, die Theodore seinen Kindern beibringt. Sie sind begeistert von den Neuerungen, die ihr Vater auf ihrem Gut vornimmt, das erste in der Gegend mit fließendem Wasser, Heizung und Strom. Doch das gewaltige Vertrauen, das Ingenieur Miller in die Moderne und den Fortschritt setzt, hat in keiner Weise helfen können, den Schmerz zu lindern, den seine Tochter ein Jahr vor jenem kalten Dezembermorgen erlitten hat. Ein Freund der Familie hat sich an Elizabeth vergangen. Das unschuldige Engelchen ist von einem bösen Wolf verschlungen worden, wie in einem grausamen Märchen, das niemand in diesem Haus je erzählt hat. Theodores positive, auf eine Zukunft in Wohlstand und Harmonie gerichtete Grundhaltung wird durch die atavistische Brutalität eines Mannes zerschlagen. Das Böse bricht sich Bahn wie ein Fluch, und keine noch so geniale Erfindung kann die Zeit zurückdrehen. Die verlorene Unschuld seiner Tochter verwandelt sich in eine Wunde, die in der Familie nie wieder erwähnt wird. Der Vater fotografiert Li-Li weiterhin, in der Hoffnung, die Schönheit der Bilder könne den Makel überdecken. Doch er weiß, dass sich hinter dem scheinbar perfekten kleinen Körper ein Unbehagen verbirgt, dem er mit seinen wissenschaftlichen Kenntnissen nichts entgegenzusetzen vermag. Sie hätten sie nicht allein lassen dürfen im Haus dieser ach so vertrauten Freunde. Wie hatte ausgerechnet ihm, der stets so viel Vertrauen in die Menschheit gesetzt hat, so eine üble Geschichte passieren können?
Dem »Leiden« wird mit Vernunft und medizinischen Behandlungen begegnet: Wichtig ist, die Verletzung des Körpers von den psychischen Folgen zu trennen. Der Körper erholt sich, die Seele begräbt den Schmerz an einem unzugänglichen Ort, und das Leben geht weiter, notgedrungen. Werden auf diese Weise nicht auch defekte Getriebe wieder instand gesetzt? In der Fabrik, in der Theodore arbeitet, gibt es eine komplizierte Apparatur, die Feststoffe von Flüssigkeiten trennen kann: Gibt es inzwischen nicht auch etwas Ähnliches für menschliche Gefühle? Er muss sich unbedingt noch einmal mit den bahnbrechenden Ideen dieses Mannes aus Wien befassen, der derzeit in aller Munde ist und der in den sogenannten Tiefen der Psyche gräbt. Elizabeth muss sich wegen jenes dramatischen Vorfalls, den sie um jeden Preis vergessen soll, unangenehmen Vaginalspülungen unterziehen: auch wenn das Wort »Tripper« derart furchtbar ist, dass es sich schwerlich vergessen lässt. Ein Gefühl von Schuld und Unreinheit bleibt in ihr haften, wie ein Infekt, der sich in einem Spalt eingenistet hat und gegen den es kein Wundermittel gibt, das ihm beikommen würde. In der Absicht, sie für das Erlittene zu entschädigen, gewährt Theodore ihr die Freiheit, den eigenen Lebensweg selbst zu bestimmen. Welch andere Behandlung wäre besser für eine so eigenwillige junge Frau wie sie? Und sie wird dieses Vertrauen erwidern und ihn für immer lieben.
Ein solches Geschenk ist auch in unseren sogenannten emanzipierten Zeiten ungewöhnlich, doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist es geradezu unglaublich. Mochten die jungen Mädchen aus gutem Hause auch noch so begabt und aufgeweckt sein, hielt man sie doch von klein auf dazu an, sich den Wünschen ihres zukünftigen Ehemanns zu fügen. Andere Wege galten als tückisch und voller Gefahren.
Doch Elizabeth besitzt nunmehr die geheimnisvolle Kraft jener zarten Persönlichkeiten, die sich im Angesicht des Sturmes niemals zurückziehen und sich nur lebendig fühlen, wenn sie bis an die eigenen Grenzen gehen. Ihr herausfordernder Blick an jenem Dezembermorgen scheint bereits ihr gesamtes Schicksal in sich zu bergen. Frauen werden nicht in Heldenepen verehrt, und kein Dichter besingt ihre Taten: Noch ist die 1907 geborene Li-Li bloß ein kleines Mädchen, aber sie ist bereit, sich dem Kampf zu stellen, der sie erwartet.
Theodore fotografiert sie unablässig, in der Hoffnung, das Bild seiner Tochter, das sich in die Teile eines jener Puzzles aufgelöst zu haben scheint, mit denen sie sich an Winterabenden die Zeit vertreiben, wieder zusammenzusetzen. Es gibt immer etwas, das nicht zusammenpasst und den Gesamteindruck verhindert; die Konturen verwischen, das Bild entzieht sich dem Verständnis.
Erst Pablo Picasso wird es Jahre später gelingen, in einem Gemälde die verschiedenen Bruchstücke seiner Li-Li nebeneinanderzustellen, und in dem kubistischen Chaos dieses Porträts wird der Vater endlich das Gesicht seiner Tochter wiederfinden.
»Das Schicksal geht weiter.«
ANITA LOOS
New York, 1927
Auf der 5th Avenue herrscht viel Verkehr an diesem Wintermorgen. Die Fotos aus jener Zeit zeugen von einer entfesselten und faszinierenden Stadt: ein weit zurückliegender Anblick, der Liebhabern alter Schwarz-Weiß-Filme jedoch vertraut sein dürfte.
Aber diese Geschichte ist kein Film, auch wenn sie von einem Hollywood-Drehbuchautor auf der Suche nach einem Clou für seine schillernde Komödie stammen könnte. Eine wunderschöne Frau will zur Stoßzeit die Straße überqueren. Der Himmel schimmert graumetallisch, und die großen, an Dickhäuter erinnernden Automobile bewegen sich hektisch vorwärts. In New York ist seit jeher jeder in Eile, die Hektik ist mit der Stadt entstanden, und die junge Frau fühlt sich in diesem euphorischen Klima ganz in ihrem Element. Auch sie ist auf der Suche nach etwas, sie weiß nicht, wo ihre Träume sie hinführen, aber sie kann es kaum erwarten, das zu entdecken. Vielleicht steckt sie genau deshalb mit dem Kopf in den Wolken: Sie denkt darüber nach, wie sie ihr junges Leben umkrempeln kann, sie hat es satt, als Unterwäsche-Model für das Geschäft Stewart und Company zu arbeiten, und der Ballettunterricht hat ihr auch nur zu einer kleinen Nebenrolle in den jährlichen Revueshows der George White’s Scandals verholfen. Aus ihrer Sicht als Darstellerin ist dieses Ambiente nicht gerade aufregend, obwohl auch Louise Brooks bei den Scandals angefangen hat, um dann zum allseits bewunderten Kinostar zu avancieren. Die wunderschöne junge Frau mit dem Kopf in den Wolken hat ganze Nachmittage gemeinsam mit ihrer Freundin Minnow verbracht, um in der Zeitschrift Photoplay die Lebensläufe der Filmdiven zu studieren, doch eine Karriere als Schauspielerin reizt sie nicht, viel faszinierender findet sie das Talent von Anita Loos, die in sehr jungen Jahren einen Bestseller geschrieben und sich in einer von Männern dominierten Welt durchgesetzt hat. Sie hat den Roman »Gentlemen prefer Blondes« verschlungen und ist begeistert von der Vorstellung, dass eine Frau nun nicht nur endlich das Wahlrecht hat, sondern auch Schriftstellerin oder, was auch immer ihr in den Sinn kommt, werden kann. Alles, nur nicht diese langweiligen Schulen besuchen, von denen sie immer wieder geflogen ist, weil sich ihr Betragen für ein anständiges Mädchen »nicht geziemte«. Als ob das Rauchen einer Zigarette schon eine Straftat wäre. Sie spürt, dass sie eine künstlerische Ader hat, es ist eine diffuse Neigung, aber um den wilden Teil in sich zu entdecken, muss sie frei und unabhängig sein. Ja, dessen ist sie sich sicher. »Das Schicksal geht weiter«, hat ihr Anita Loos geschrieben, ein magischer Satz, der als Titel für diesen New Yorker Vormittag herhalten könnte.
Inzwischen hat sie die Eltern davon überzeugt, dass sie nicht länger in Poughkeepsie leben kann: Die Provinz erstickt sie und macht sie krank. Nachdem der Vater sie fiebrig und kraftlos wie ein Gespenst durch das Anwesen hat streifen sehen, hat er beschlossen, ihrem Wunsch nachzugeben: »Dann sei es eben New York.« Letztlich ist die Stadt kaum hundert Kilometer von daheim entfernt, und er kann sie besuchen, wann immer er will. Legt nicht auch seine Ehefrau Florence diese Strecke zweimal die Woche wegen ihrer Sitzungen mit Dr. Bill zurück? Der prominente Psychologe, erster Vertreter Freuds in Amerika, behandelt sie nach einem missglückten Suizidversuch, und die Ergebnisse sind fantastisch. Es heißt, die Mutter habe einen anderen, fürsorglicheren und aufmerksameren Mann als ihren Gatten kennengelernt, doch habe ihr im letzten Augenblick der Mut gefehlt, ihn zu verlassen, deshalb sei sie schließlich in Behandlung gegangen. Ein guter Ausgang für Ingenieur Miller, der nie den Glauben an seine wissenschaftlichen Illusionen verloren hat. Doch über diese Dinge wird in der Familie kaum gesprochen. Mutter und Tochter haben gelernt, besonders heikle Themen zu umschiffen: Besser, man verbringt die Nachmittage mit exzessivem Shoppen in den schicksten Geschäften der Stadt, wohingegen am Abend der Broadway mit einem glanzvollen Spielplan aufwartet. Sie sind begeisterte Theaterbesucherinnen, aber sie haben einen sehr unterschiedlichen Geschmack und diskutieren eifrig jede Vorstellung: Ibsen und Eugene O’Neill sind zu heftig für die Mutter, die sich nicht gern in den psychologischen Introspektionen der von der Tochter so geliebten Dramen widerspiegeln mag. Ist es nicht eine sinnlose Qual, ins Theater zu gehen, um die eigenen Nöte aus dem Mund von Hedda Gabler zu hören? Genügt nicht das, was sie während der langen Sitzungen mit Dr. Bill zur Sprache bringen muss?
Trotz all ihrer Anstrengungen bleibt Florence eine im 19. Jahrhundert verhaftete Frau, die in ihrer Tochter eine gelungenere Version ihrer selbst sieht: eine darwinistische Weiterentwicklung des weiblichen Wesens, würde es ihr Ehemann zufrieden nennen. Hinter dem engelsgleichen Gesicht ihres Kindes erkennt die Mutter die Charakterzüge der Kriegerin, die nur darauf wartet, sich in diese neue Welt zu stürzen, auf die sie selbst sich nicht hat einlassen können. Das hat sie begriffen, als sie gemeinsam mit Theodore nach Paris gereist ist, um sie abzuholen. Was für eine Idee, sie dort gemeinsam mit der Französischlehrerin überwintern zu lassen … Madame Kohoszyńska hat es nicht geschafft, die Begeisterung der wunderhübschen jungen Frau zu bremsen, die an diesem verführerischen Ort jene Inspiration gefunden hat, nach der sie suchte: Durch die von Künstlern und Bohémiens bevölkerten Straßen zu schlendern, hat ihr den Kopf verdreht. Und aus einem solchen Rausch führt kein Weg mehr hinaus.
Sie hatten ihrem Betteln stattgegeben – Theodore war immer derjenige, der als Erster nachgab –, und der Lehrgang an der École Medgyes pour la Technique du Théâtre schien eine gute Idee, doch die junge Frau wollte nicht mehr zurück. Und dann dieser Künstler, Ladislas Medgyes, Direktor der Schule, ein Theatergenie … wie leicht konnte sich ein junges Mädchen von einem solchen Mann blenden lassen. Aber er war derart viel älter, dass die Sache selbst für so aufgeschlossene Eltern wie sie etwas Heikles hatte.
»J’ai pensé faire une soirée pour fêter ton retour …« Manchmal spricht die wunderschöne junge Frau mit sich selbst Französisch, um die Verbindung zu der außergewöhnlichen Umgebung, in der sie sich zum ersten Mal glücklich und vor allem frei gefühlt hat, nicht abreißen zu lassen. Jetzt, inmitten des Trubels der 5th Avenue, zwischen hupenden Taxis und gehetzten Passanten, ist sie in Gedanken vielleicht gerade bei ihrem Pariser Traum. Jedenfalls ist sie derart in ihre Fantasien vertieft, dass sie nicht bemerkt, wie eine Limousine direkt auf sie zufährt: Es könnte das traurige Ende einer vielversprechenden Geschichte werden, doch das Schicksal will es anders. Sie springt zurück und landet in den Armen eines Passanten, klammert sich an diesen Mann, um nicht zu stürzen. Der Tweedmantel ihres Retters riecht nach Regen und Aftershave. Statt vor Schreck in Ohnmacht zu fallen, schaut ihm die junge Frau direkt in die Augen und bemerkt einen Herrn mittleren Alters, der sie verblüfft betrachtet.
»Excusez-moi, monsieur …«, stammelt sie angesichts des Schocks auf Französisch, eine Extravaganz, die sie nur um so faszinierender wirken lässt.
Es gehört einiges dazu, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, und Elizabeth Miller ist eine Meisterin des Zufalls. Der Unbekannte heißt Condé Nast und ist einer der einflussreichsten Männer des amerikanischen Verlagswesens. Mit großem Gespür und Geschäftssinn hat er eine kleine Wochenzeitung namens Vogue in eine Zeitschrift verwandelt, die die Mode der Upperclass diktiert, und an diesem Morgen ist dem Magnaten auf der Stelle klar, dass die junge Frau, die in seinen Armen gelandet ist, nicht nur fantastisch aussieht, sondern auch die Quintessenz moderner Eleganz verkörpert. Für ihn besteht kein Zweifel: Sie ist der weibliche Prototyp, nach dem er sucht, um den neuen amerikanischen Stil zu präsentieren.
Wenige Monate nach dieser Zufallsbegegnung erscheint Elizabeth Millers Gesicht auf der Titelseite von Vogue America, gestaltet von Georges Lepape, dem angesagtesten Illustrator seiner Zeit. Im Vordergrund sieht man das Bild einer umwerfend schicken jungen Frau in dem für das Jazzzeitalter typisch burschikosen Look, während im Hintergrund verlockend die bunten Lichter eines nächtlichen Manhattans funkeln. Das Gesicht der gerade neunzehnjährigen Elizabeth wird von einem ultramarinblauen Glockenhut umrahmt, der die weißgepuderte Haut, die roten Herzlippen und die hellblauen, gnadenlos durchdringenden Katzenaugen zur Geltung bringt. Wir, die wir dieses Bild fast hundert Jahre später betrachten, sehen darin weniger die Titelseite einer Modezeitschrift als vielmehr den Ausdruck einer mystischen Ära, wie sie uns aus den Romanen von Francis Scott Fitzgerald bekannt ist: Seine Heldinnen sind junge emanzipierte und freche Frauen, die kniefreie Kleider tragen, Charleston tanzen, trinken, rauchen und sich nicht damit zufriedengeben, nur im Auto am Steuer zu sitzen, sondern die auch ihr eigenes Leben steuern wollen und dabei ein halsbrecherisches Tempo an den Tag legen. Eine kopernikanische Wende, die sich selbst die weitsichtigsten Suffragetten nicht hätten träumen lassen und die der öffentlichen Meinung, angesichts jener ruchlosen, Flapper genannten jungen Frauen, ein Dorn im Auge bleibt: Dieses lautmalerische Wort erinnert übrigens an das Flügelschlagen eines kleinen Vogels, der soeben das elterliche Nest verlassen hat und nicht beabsichtigt, dorthin zurückzukehren.
Zelda Fitzgerald, die all diese Frauen verkörpert, schreibt:
»Die Flapper ist aus der Lethargie ihrer Vorgängerinnen erwacht, hat sich die Haare kurz geschnitten, ihre schönsten Ohrringe angelegt und sich mit einer guten Portion Wagemut und Lippenstift in den Kampf gestürzt.«
Es geht nicht nur um einen Modekampf: Hinter den bunten und provokanten Aufmachungen, die wir aus Filmen und Romanen kennen, verbirgt sich der drängende Wunsch nach Emanzipation, den die bürgerliche Gesellschaft einzudämmen versucht. Doch die neue Generation junger Frauen zurück in die Enge der häuslichen vier Wände zu führen, scheint kein leichtes Unterfangen zu sein. Elizabeth ist mittendrin im Geschehen und entschlossen, ihre Chance zu nutzen.
Die Titelseite der Vogue vom März 1927 markiert den triumphalen Einzug Miss Millers in die glanzvolle Welt der Mode. Für die junge Schönheit aus Poughkeepsie ist es ein erstaunlicher Erfolg. Innerhalb weniger Monate taucht ihre elegante und außergewöhnliche Gestalt in den glamourösesten Zeitschriften des Medienimperiums von Condé Nast auf, und sie wird zu einer Ikone des Luxus. »Das Schicksal geht weiter«, aber in so schwindelerregendem Tempo, dass es einem den Atem verschlägt.
Die Archivfotos zeugen von dieser überraschenden Entwicklung: Ich sehe Elizabeth in Dreiviertelansicht, den sinnlichen Ausschnitt dem Objektiv zugewandt, bedeckt von einem zarten Tüllkleid ganz in Schwarz und mit einer glänzenden Kette aus Jais geschmückt. Dieses Bild ist der Inbegriff des Chics, eine geradezu majestätische Aufnahme von Edward Steichen, dem Star-Modefotografen, der die junge Frau, hingerissen von ihrer geheimnisvollen Ausstrahlung, auf Dutzenden legendären Fotos verewigt hat. Mal ist sie eine kunstvoll in ein cremefarbenes Seidenunterkleid verpackte und mit einem weißen Fuchs verzierte Lady; kurz darauf wird sie zu einer burschikosen und selbstbewussten jungen Dame im Chanel-Hosenanzug an Deck einer Milliardärs-Yacht; dann wieder ist sie das betörende Uptown Girl im blütenweißen, mit Swarovski-Steinen besetzten Satincape. »Schließ die Augen und öffne sie dann rasch wieder, so wirkt dein Blick natürlicher.« Die junge Frau mit den perfekten Gesichtszügen scheint das geborene Model zu sein, sie hat eine Aura, die die Meister der Fotografie verzaubert. Vor allem ihr rätselhafter Blick hat es ihnen angetan: eine ganz besondere Eigenschaft für ein Model. Vor der Kamera wirkt sie wie unerreichbar, versunken in eine ferne Welt. »Öffne die Augen, Li-Li«, diesmal ist es dein Vater, der dich fotografiert, du bist nackt und verspürst keine Scham, er ist es, der dir beigebracht hat, Körper und Gefühle zu trennen. Eine Überlebensstrategie, die zu ihrem größten Talent wird. »Schließe die Augen, Elizabeth, und träume.« Du bist am Ufer eines sonnigen Strandes, und die Wellen streifen deinen mit Algen und Muscheln bedeckten Körper. »Öffne die Augen, so bist du perfekt.« Eine von Erté stilisierte Ikone, eine Femme fatale oder eine romantische jeune fille en fleurs, wie der Meister der Porträtfotografie Arnold Genthe sie darstellt. Im Licht der Scheinwerfer wird Elizabeth Miller zum Kaleidoskop tausend verschiedener Frauen, doch ihre Gedanken sind anderswo, an einem Ort, den niemand sonst betreten darf.
Diese kostbare Realitätsferne ist keine an der Schauspielschule einstudierte Technik, sondern eine überlebenswichtige Waffe, die sie seit ihrer Kindheit erprobt hat: ein unsichtbarer Schleier, der sie vor jenem nie genannten Schmerz schützt, den sie nur ein einziges Mal in ihrem Tagebuch als »meine dreckige Vergangenheit« erwähnt. Doch was jetzt zählt, ist die Gegenwart, und der unerwartete Erfolg als Model gibt ihr die Freiheit, nach der sie sich immer gesehnt hat. Elizabeth ist in ein neues Leben katapultiert worden, und sie hat vor, es ganz und gar auszukosten. Sie ist gerade erst zwanzig geworden, und das New Yorker Café Society empfängt sie begierig. Miss Miller steht auf der Guest List der angesagtesten Clubs und ist stets von einer Schar Bewunderer umringt, die hingerissen sind von ihrer Schönheit.
»Hat dir noch nie jemand gesagt, dass du aussiehst wie Marlene Dietrich? Nein, eigentlich eher wie Greta Garbo. Oder, besser gesagt, wie alle beide.«
»Und du siehst aus wie Groucho Marx bei einer seiner schlechtesten Vorstellungen«, erwidert sie amüsiert.
Auch wenn sie von einem Flirt zum anderen flattert und sich wie eine Femme fatale gibt, bleibt sie unter der Schale ihrer schicken Kleider das draufgängerische kleine Mädchen aus Poughkeepsie, das auf die Bäume des elterlichen Anwesens klettert. Sie hat keine aufgeschlagenen Knie mehr, sondern trägt hauchzarte Seidenstrümpfe, aber sie bleibt stets die unbezwingbare Li-Li, die keiner zu fassen bekommt.
Condé Nast will sie bei seinen exklusiven Partys in dem legendären 30-Zimmer-Appartment in der Park Avenue dabeihaben. Für den Tycoon sind Elizabeth und ihre Freundin Tanya Ramm ein unverzichtbares Dekorationselement, mit dem sich die Gästeliste, auf deren Zusammenstellung er eine beinahe an den Cast eines Hollywoodschinkens erinnernde Sorgfalt verwendet, bereichern lässt. Tanya ist brünett mit Cleopatraaugen, Elizabeth ist die engelsgleiche Blondine mit Bubikopf. In den Zimmern voller antiker Möbel und Perserteppiche sind auch die beiden jungen Frauen Sammelobjekte, die man gern besitzen würde. Aber Elizabeth lässt sich nicht vom Luxus blenden. Und sie gibt den sprichwörtlichen Avancen von Nast nicht nach, der, wie es heißt, von unstillbarem sexuellem Verlangen besessen sein soll, insbesondere bezüglich seiner jungen Entdeckungen.
»Sag selbst, er ist ein harmloser alter Bock.«
»Ja, aber es ist besser, zwischen ihm und mir steht immer ein Schreibtisch.«
So lauten die Kommentare der jungen Frauen, während sie an ihrem Jahrgangschampagner nippen, um nach kurzem Verweilen interessantere Orte aufzusuchen, wie etwa die Zusammenkünfte von Neysa McMein, einer talentierten und extravaganten Illustratorin, die in ihrem Atelier in der 5th Street die hübschesten Denker der Stadt versammelt. Während dieser feuchtfröhlichen Abende übt Irving Berlin seine neuesten Kompositionen am Klavier, während Charlie Chaplin die Gäste mit komischen improvisierten Monologen unterhält. Neysa ist es, die sie zum ersten Mal Lee nennt: ein Name, so kurz wie ein musikalischer Ton, der sowohl für einen Mann als auch für eine Frau passen könnte. Elizabeth übernimmt ihn sofort und begräbt ihren ursprünglichen Namen für immer.
In Neysas Salon sind auch Dorothy Parker und deren Freunde aus dem Literatenzirkel Algonquin Round Table, die über den jüngsten in der Zeitschrift The New Yorker erschienenen Verriss der Journalistin diskutieren.
»Das Erste, was ich morgens mache, ist Zähneputzen und meine Zunge schärfen«, erklärt Parker.
Lee pflichtet ihr bei: Auch sie hat eine scharfe Zunge. Dem süßlichen Gerede ihrer Bewunderer begegnet sie mit Ironie und lässt sie erbarmungslos abblitzen.
»Weißt du, wie die Flappers Eheringe nennen? Handschellen! Und dem kann man nur zustimmen.«
Es ist nicht leicht, sie zu erobern und insbesondere sich an ihre überschäumende sexuelle Freizügigkeit zu gewöhnen, die Lee, genau wie ihre Altersgenossinnen, ungeniert an den Tag legt: eine absolute Neuheit für die Männer des frühen 20. Jahrhunderts, die sich plötzlich mit unabhängigen und emanzipierten Frauen konfrontiert sehen, die nicht gewillt sind, sich der puritanischen Wohlanständigkeit ihrer Mütter zu unterwerfen.
Die Frauen würden sich zu viel rumtreiben, erklärt Tom Buchanan, Daisys Ehemann in »Der große Gatsby« von Francis Scott Fitzgerald. Die einzige Möglichkeit, nicht auf der Strecke zu bleiben, besteht darin, die Bedingungen zu akzeptieren, die durch die neuen Gefühlsbeziehungen auferlegt werden und die nicht unbedingt auf Treue bauen.
Genau das ist es, was Elizabeth dem davon wenig begeisterten Alfred de Liagre junior in Aussicht stellt, einem gut aussehenden jungen Mann, der soeben sein Diplom an der Yale University abgelegt hat und der theoretisch alle Voraussetzungen erfüllt, um sich als offizieller Verlobter zu bewerben: Er ist faszinierend, großzügig, mit genau der richtigen Prise Humor, derer es bedarf, um eine brillante junge Frau wie Lee, die Eifersucht, vor allem aber Langeweile verabscheut, zu erobern. Weil er sie keinesfalls verlieren will, akzeptiert Alfred die anderen Beziehungen, auf die sich Lee ohne nachzudenken einlässt, wobei der größte Rivale ausgerechnet sein bester Freund, der kanadische Flieger Argylle, ist. Wie hätte jemand wie sie der Einladung in seinen glänzenden Doppeldecker widerstehen sollen, um Schulter an Schulter wie Co-Piloten durch den Himmel über New York zu sausen? Lee mag keiner Verlockung widerstehen, sie ist davon überzeugt, dass es keineswegs anstößig ist, zwei oder mehr Beziehungen gleichzeitig zu führen. Eine Haltung, die sie niemals aufgegeben hat im Laufe ihres bewegten, von gebrochenen Herzen und rasenden Eifersüchten geprägten Liebeslebens. Das aber auch ungewöhnliche Freundschaften zwischen rivalisierenden Männern zu verzeichnen hatte, die, aus aufrichtiger Liebe zu ihr, gelernt hatten, ihre Unabhängigkeit zu akzeptieren. Sie ist ein echtes Phänomen, das noch heute, fast hundert Jahre später, bei vielen um die eigenen Belange ringenden Frauen Bewunderung und Staunen auslöst.
Es ist diese unermüdliche Suche nach Freiheit, die mich an Lee Millers Geschichte am meisten fasziniert. In meinen flammendsten Fantasien stelle ich sie mir als Heldin eines dringend benötigten Frauen-Epos vor, die unter dem Glanz ihrer edlen Kleider die Rüstung einer Kämpferin trägt, bereit, sich zur Wahrung der eigenen Autonomie jeglicher Herausforderung zu stellen.
Doch es ist nicht so einfach, wie es scheint. Das kleine Mädchen, das allen Schmerz der Welt erfahren und ihn an einem geheimen Ort verschlossen hat, weiß zwar, wie sie Sexualität und damit einhergehende Gefühle voneinander zu trennen hat, aber sie bleibt eine Gefangene ihrer maßlosen Schönheit. »Die Privilegien der Schönheit sind immens«, wird ihr Jean Cocteau Jahre später erklären. Aber diese Ressource, die ihr Leben verändert hat, ist auch eine tödliche Falle, der sie so schnell wie möglich entkommen muss.
Eine Bleistiftzeichnung, eine Skizze, die Lee während ihrer Pariser Zeit an der Seite von Man Ray angefertigt hat, zeigt die elegante Silhouette einer Frau in Kostüm und Hütchen, die mit einer Reihe von Messern aus der Hand eines unsichtbaren Messerwerfers an einer Wand festgehalten wird. Offenbar eine geistreiche Karikatur, die darauf verweisen will, wie sehr sich Frauen zu Sklavinnen der Mode machen und Opfer und Komplizinnen eines künstlich entworfenen Bildes übertriebener Weiblichkeit sind. Aber diese Zeichnung ist auch das Porträt ihrer eigenen Situation als Model, das von den erbarmungslos sezierenden Blicken der Männer auf diese Rolle festgenagelt wird. »Schließ erneut die Augen, Lee, lass dich gehen, du bist ein bunter Schmetterling, der mit einer Nadel auf ein Blatt gesteckt ist, du verspürst keinerlei Schmerz, doch deine Flügel sind gefangen, und wenn du versuchst zu fliehen, so wird dich eine dünne Glasscheibe am Abheben hindern.« Als Lee die Augen öffnet, sieht sie nicht nur die blendenden Scheinwerfer, die das Setting ausleuchten, sondern sie konzentriert sich auf die Techniken der Meister, die sie fotografieren. Sie spürt, dass diese wunderbare Kunst, die sie dank der väterlichen Lektionen seit ihrer Kindheit liebt, ein Teil von ihr ist, den sie beherrschen lernen muss, wenn sie ihre Zukunft verändern will. Es geht um den Wechsel der Perspektive, darum, auf die andere Seite der Kamera zu gelangen, doch was wie eine winzige Bewegung erscheint, ist in Wahrheit ein riesiger Schritt für eine allein wegen ihres Äußeren geschätzten jungen Frau. Es sind die unscheinbaren Frauen, denen niemand den Hof macht, die danach streben, einen Beruf zu erlernen. Weshalb sollte Lee das Kapital ihrer eigenen Schönheit verschleudern, um sich in ein Abenteuer voller Unwägbarkeiten zu stürzen?
Die Art Students League of New York, wo sie sich voller Erwartungen und mit dem Segen Theodores eingeschrieben hatte, erscheint ihr nicht mehr als der heilige Ort, an dem »ihr Talent aufblühen würde«, wie es der Direktor verkündet hatte. Lee hat das Gefühl, dass alle Gemälde bereits gemalt sind und dass jenseits der verstaubten Hörsäle eine spannendere Welt darauf wartet, eingefangen zu werden. »Die Fotografie ist eine Kunst, die der Malerei in nichts nachtsteht«, erklärt ihr Edward Steichen immer wieder, während er seinen Assistenten, die ihn wie eine Gottheit verehren, Anweisungen erteilt. Der neben Alfred Stieglitz – einem weiteren Pionier der Kunstfotografie – für das Image von Vogue und Vanity Fair