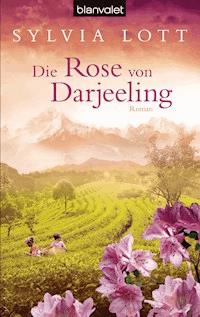9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Norderney-Saga
- Sprache: Deutsch
Ein Friseursalon auf Norderney und starke Frauen, die für ihre Träume und die Liebe kämpfen – Die große Familiensaga voll nostalgischem Insel-Charme!
Norderney, Anfang des 20. Jahrhunderts: Für die Fischertochter Frieda geht ein Traum in Erfüllung – sie bekommt eine Stelle im Friseursalon Fisser und damit Zugang zu einer neuen, aufregenden Welt. Ihr Glück ist perfekt, als sie den charmanten Joseph Graf Ritz zu Gartenstein kennenlernt. Doch der Standesunterschied macht eine Ehe unmöglich, und bald muss Frieda eine folgenschwere Entscheidung treffen. Auch Friedas Freundin Grete, Tochter einer wohlhabenden Berliner Familie, hat große Pläne. Sie will sich den Vorstellungen ihrer Eltern widersetzen und auf der Insel eine Ausbildung beginnen. Dass sie dabei einem fortschrittlichen jungen Arzt nahe sein kann, macht sie nur noch entschlossener. Doch alles kommt anders, als gedacht: Der Erste Weltkrieg bricht aus, und die Männer versprechen: Weihnachten sind wir zurück!
Die Norderney-Saga von Sylvia Lott:
Die Frauen vom Inselsalon
Sturm über dem Inselsalon
Bände 3 und 4 in Vorbereitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Norderney, Anfang des 20. Jahrhunderts: Für die Fischertochter Frieda geht ein Traum in Erfüllung – sie bekommt eine Stelle im Friseursalon Fisser und damit Zugang zu einer neuen, aufregenden Welt. Ihr Glück ist perfekt, als sie den charmanten Joseph Graf Ritz zu Gartenstein kennenlernt. Doch der Standesunterschied macht eine Ehe unmöglich, und bald muss Frieda eine folgenschwere Entscheidung treffen. Auch Friedas Freundin Grete, Tochter einer wohlhabenden Berliner Familie, hat große Pläne. Sie will sich den Vorstellungen ihrer Eltern widersetzen und auf der Insel eine Ausbildung beginnen. Dass sie dabei einem fortschrittlichen jungen Arzt nahe sein kann, macht sie nur noch entschlossener. Doch alles kommt anders, als gedacht: Der Erste Weltkrieg bricht aus, und die Männer versprechen: Weihnachten sind wir zurück!
Autorin
Die freie Journalistin und Autorin Sylvia Lott ist gebürtige Ostfriesin und lebt in Hamburg. Viele Jahre schrieb sie für verschiedene Frauen-, Lifestyle- und Reisemagazine, inzwischen konzentriert sie sich ganz auf ihre Romane, die regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste zu finden sind. Bei der Recherche zu einem ihrer Romane faszinierte sie die glanzvolle und wechselhafte Geschichte Norderneys, und die Idee entstand, eine mehrbändige Saga zu schreiben. »Die Frauen vom Inselsalon« ist der erste Teil einer vierbändigen Reihe um einen Friseursalon auf Norderney in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Mehr Informationen unter www.romane-von-sylvia-lott.de und www.facebook.com/Sylvialott.romane
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
SYLVIA LOTT
Die Frauen vom Inselsalon
Roman
Die Hauptpersonen rund um den Inselsalon
Frieda Dirks
Die flachsblonde Fischertochter mit den blauen Augen hat ein freundliches Naturell, was vielleicht damit zusammenhängt, dass sie unter einer Glückshaube geboren wurde. Sie lebt mit ihren Eltern, Großeltern, dem älteren Bruder Dodo und der jüngeren Schwester Rieka in einem Haus in den Dünen. Zwei ältere Geschwister sind schon verheiratet. Frieda hilft ihrer Mutter, die als Badedienerin am Damenstrand ein Zubrot für die Familie verdient, aber ihr Traum ist es, im Friseursalon Fisser zu arbeiten.
Grete Lehmann
Eigentlich Margarete-Viktoria. Mit ihren dunklen, langen Haaren und ihrem hellen Teint könnte sie aussehen wie Schneewittchen. Wenn da nicht diese unansehnlichen Ekzeme und der quälende Husten wären. Zusammen mit ihren Eltern und ihren beiden Brüdern Hans-Heinrich und Eduard macht sie Urlaub auf Norderney. Ihr ältester Bruder Ludwig ist in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika stationiert. Die Tochter eines Berliner Fabrikanten und einer Adeligen träumt von einem Leben frei von Zwängen.
Fritz Fisser
Das Oberhaupt der Familie und Meister des Friseursalon Fisser ist gutmütig, kaisertreu bis in die Bartspitzen und überall auf Norderney beliebt. Auf seinem Frisierstuhl sitzen Prominente wie Reichskanzler von Bülow, aber auch Norderneyer Honoratioren und normale Insulaner. Er beschäftigt neben seiner Frau, Sohn Hilrich und Tochter Frauke die Lehrlinge Willy und Menno sowie den Gesellen Erwin.
Jakomina Fisser
Die Matriarchin der Friseurfamilie Fisser. Sie ist abergläubisch, jedoch sehr vernünftig und geschäftstüchtig. Wenn es um das Glück ihrer Familie geht, wird sie zur (See-)Löwin.
Hilrich Fisser
Der gut aussehende Sohn von Jakomina und Fritz Fisser steckt die schönsten Damenfrisuren und empfiehlt jedem Kunden die passende Bartform. Er möchte nach Berlin, um dort in einem führenden Friseursalon die neuesten Moden kennenzulernen.
Max Lubinus
Der charmante junge Kandidat der Medizin unterstützt die Reformbewegung und die Abkehr von überkommenen Traditionen. Max stammt aus einfachen Verhältnissen, wurde von einem ostfriesischen Pastor auf dem Festland adoptiert und studiert mit einem Stipendium. Er ermutigt Grete, neue Heilmethoden auszuprobieren und sich von Konventionen zu lösen.
Joseph Graf Ritz zu Gartenstein
Der österreichische Adelige arbeitet im diplomatischen Dienst. Er ist ein Bekannter von Gretes Bruder Eduard. Auch mit Grete und Frieda versteht er sich auf Anhieb. Der junge Graf muss eine gute Partie machen, um seine verarmte Familie vor dem Bankrott zu bewahren.
Martin von Welser
Ein Pilot der Berliner Ikarus-Gesellschaft. Er fliegt auf Norderney ein Wasserflugzeug und beeindruckt bei Flugshows mit kühnen Manövern. Der gesellige junge Mann lernt Grete bei einem Besuch der Pferderennbahn der Insel kennen.
Das Wickwief
Die Mittfünfzigerin ist verwitwet und lebt allein in einem Häuschen in den Dünen. Sie gilt als Wahrsagerin und hat manchmal »een Vörlopp« – also eine Vision dessen, was kommen wird. Ihre Zauber und Rituale haben schon der einen oder anderen Insulanerin und auch einigen Insulanern geholfen. Zu Frieda hat das Wickwief eine ganz besondere Beziehung.
Jeder braucht jemanden, den er jederzeit unangemeldet zum Tee besuchen kann.
Tobias Bohlsen (Großvater der Autorin)
Frieda
Warum nur trug das Mädchen, das in ihrem Alter sein mochte, einen Hutschleier vor dem Gesicht? War die junge Dame so unansehnlich, oder hatte sie Angst, die Sonne könnte ihren Teint verbrennen? Aufmerksam beobachtete Frieda Dirks die beiden Badegäste, wohl Mutter und Tochter, deren Nummern gerade aufgerufen worden waren. Die Ältere wurde von den Badedienerinnen Gesine und Herta abgeholt, während sie noch eindringlich auf das Mädchen einredete.
»Nein, ich will aber nicht!«, hörte Frieda die Jüngere ausrufen.
Sie warf ihr Bündel in den Sand, verschränkte die Arme vor der Brust. Etliche der Damen, die ringsum wie Einsiedlerkrebse in geflochtenen Einzelstrandkörben saßen und darauf warteten, dass ihre Badenummer aufgerufen wurde, unterbrachen irritiert ihre Lektüre. Jetzt stampfte das zarte Wesen auch noch auf. Einen Moment lang fürchtete Frieda, es könnte in der Mitte entzweibrechen – so schmal war seine Taille.
»Du gehst!« Entschieden klappte die Mutter ein Sonnenschirmchen zusammen, das ausnehmend gut zu ihrem eleganten cremefarbenen Kleid passte. »Heute lasse ich keine Ausrede mehr gelten, Margarete. Nur zehn Minuten, die wirst du doch wohl durchhalten. Es ist gut für deine Gesundheit!« Sie bat Gesine und Herta um einen Moment Geduld und wandte sich an Friedas Mutter, die hier – wie unschwer an ihren wadenlangen roten Hosen zu erkennen war – ebenfalls als Badedienerin arbeitete. »Bitte lassen Sie sich nicht erweichen. Scheuchen Sie meine Tochter in die Wellen!«
»Dat kriegt wi woll henn.«
Meta Dirks nickte mit einem wissenden Lächeln, das die beiden kurz über alle Standesgrenzen hinweg als Mütter verband.
Mütter …
Frieda empfand in diesem Moment Stolz auf ihre »Moeder« – eine schöne, aufrechte Ostfriesin war sie, auch ohne Korsett und trotz der wettergegerbten Haut. Das freundliche Lächeln, die hübsche kleine Nase im breiten Gesicht und die blauen Augen hatte sie von ihr geerbt. Meta Dirks strahlte Zuverlässigkeit aus, wie sie da so stand und sich in aller Ruhe eine im Wind flatternde Strähne aus der Stirn strich. Das Haar trug sie zu einem schlichten Dutt verschlungen wie die anderen Insulanerinnen auch, die während der vom frühen Morgen bis um zwei Uhr nachmittags dauernden Badezeit Dienst taten. Nur ein kleines Kopftuch rahmte ihr Gesicht ein, die weiblichen Kurgäste dagegen kamen mit ausladenden Sommerhüten über kunstvoll aufgebauschten Frisuren angerauscht.
An diesem Tag frischte es in Böen auf. Margaretes Mutter bemühte sich, ihren Florentinerhut mit dem Sonnenschirm festzuhalten, mit der anderen Hand steckte sie Meta etwas in die Tasche ihrer Kitteljacke. Ein gutes Trinkgeld hoffentlich, dachte Frieda. Das würde ihre Mutter später in die Büchse werfen, deren Inhalt die Badedienerinnen erst am Ende der Saison untereinander aufteilten. Über die Summe bewahrten sie stets Stillschweigen.
»Geben Sie meinem Fräulein Tochter bitte einen von diesen altmodischen Karren. Sie wissen schon, so einen mit einer Markise vorm Ausgang.« Im Fortgehen wies sie auf die wartenden Damen, eine vornehmer als die andere. »Nun halte den Betrieb nicht länger auf, Margarete! Unter der Markise kann dich nicht mal Neptun sehen.«
Mit einem Seufzer, der verriet, wie enervierend sie das alles fand, verschwand sie in einem Badekarren. Herta folgte ihr, um beim Auskleiden behilflich zu sein.
Frieda lächelte. Es war doch wieder höchst unterhaltsam am Damenbadestrand! Windgeschützt saß sie auf dem Austritt jenes Karrens, in dem die Badefrauen ihre persönlichen Sachen zu verstauen pflegten, und genoss die wärmende Sonne. Eine leichte Bräune überzog ihre glatte Haut, die Wangen schimmerten rosig. Ihre flachsblonden Zöpfe trug sie neuerdings zu Affenschaukeln hochgesteckt. Schließlich war sie im Frühjahr konfirmiert und mit der Volksschule fertig geworden, also kein Schulmädchen mehr. Nun ging sie erst einmal ihrer Mutter zur Hand. Noch war sie zu jung, um offiziell als Badedienerin arbeiten zu dürfen, aber es gab genug für sie zu Hause zu tun, und sicher würden sich im Laufe der Saison ein paar einträgliche Nebentätigkeiten in einer Pension oder Hotelküche finden.
Zufrieden beobachtete Frieda von ihrem Logenplatz aus das gut organisierte Treiben. Über dem Pavillon auf der Marienhöhe wehte weithin sichtbar die rote Flagge, die signalisierte, dass Männern derzeit der Zutritt zu diesem Abschnitt der Promenade und erst recht natürlich des Strandes verboten war. Ständig wurden neue Nummern für frei gewordene Karren aufgerufen. Zwei Kammerzofen oder Dienstmädchen versuchten, sich für ihre Herrinnen vorzudrängeln. Doch Hedwig, die leitende Badedienerin, behielt den Überblick, sie duldete keine Mogeleien.
Eine weit auslaufende Welle umspülte Friedas herabbaumelnde Füße. Tief atmete sie die prickelnd frische Luft ein – das war doch wesentlich angenehmer, als bei Wind und Wetter im Frühjahr oder Herbst nach glitschigen Wattwürmern zu graben. Dilben nannte man das. Die Erinnerung daran ließ sie erschaudern. Als Kind hatte sie die zappelnde Beute mit klammen Fingern Stück für Stück aufspießen müssen, auf die Haken sämtlicher kurzer Schnüre, die im Abstand von jeweils einem Meter an mehrere hundert Meter langen Leinen befestigt gewesen waren. Diese speziellen Angelleinen hatte ihr Vater damals, als er noch mit ihren beiden Brüdern und einem Bestmann täglich auf Schellfisch rausgesegelt war, an Bojen mit seinem Namen ausgelegt. Harte Arbeit war das gewesen. Auch für die Frauen. Denn sie hatten später alles wieder entwirren, säubern und reparieren müssen.
Ihre Mutter war, die Angelsachen auf dem Kopf balancierend, stets vom und zum Schiff gegangen. Immer hatte ihr Haar streng nach Fisch und Algen gerochen, außer wenn es frisch gewaschen gewesen war. Leider hatte es danach tagelang ziemlich stumpf ausgesehen, weil die Kalkseife, die sie benutzte, einen grauen Film hinterließ. Angeblich gab es jetzt etwas ganz Neues aus dem Ausland, das man Schampuun aussprach. Es schäumte, die Anwendung sollte das reine Vergnügen sein und versprach frischen Glanz. Aber es kostete zwanzig Pfennig. Frieda hatte eine Reklametafel mit einem schwarzen Kopf im Schaufenster von Friseurmeister Fisser gesehen. Ab und an hatte sie auch schon, wenn Kundschaft den Inselsalon verließ, einen feinen Duft erschnuppert. Er erinnerte sie an Veilchen, und darin schwebte noch etwas anderes, etwas wie eine geheimnisvolle Verheißung. Zu gern würde sie einmal nähere Bekanntschaft mit solchem Luxus machen. Doch die Haare schnitt bei ihnen in der Familie immer die Großmutter, ihr Vater und die Brüder ließen sich einen Bart stehen. Für einen Friseur oder Barbier gab man kein Geld aus.
Ihre Mutter zeigte ans Ende der Karrenreihe. Sie und Tant’ Dina führten das trotzige Mädchen dorthin. Bei den meisten der mobilen Umkleiden handelte es sich um neuere Ausführungen, sie verfügten nur über ein Treppchen ins Wasser. Zwei übrig gebliebene Holzkabinen von anno dunnemals jedoch mit halbrunden Markisen als Sichtschutz standen ganz hinten am Damenstrand. Sie benutzte kaum noch jemand.
Die Kurgäste gaben sich mittlerweile lockerer als früher. Das behauptete auch die über siebzigjährige Badefrau Altje, die schon Königin Marie von Hannover aufgewartet und viele Moden gesehen hatte. Wie alle alten Norderneyer erinnerte sie sich gern an die Epoche vor der Preußenzeit, in der Norderney noch zum Königreich Hannover gehört hatte. Drei Jahrzehnte lang hatte König Georg V. jeden Sommer mit Familie und Hofstaat drei Monate auf der Insel residiert. Überall konnte man noch Spuren entdecken, vor allem in der klassizistischen Architektur der Kurbetriebe. Das hatten sie im Heimatkundeunterricht rauf und runter durchgenommen.
Wasserspritzer holten Frieda aus ihren Gedanken. Einige junge Frauen in ihrer Nähe amüsierten sich prächtig. Sie aalten sich wie verspielte Seerobben, kichernd, abgestützt auf ihre Ellbogen nebeneinander in der Brandung. Bei jedem Wellenschlag mischte sich ihr Juchzen in die Geräuschkulisse aus Möwengeschrei und Meeresrauschen. Einige umklammerten beim übermütigen Planschen ein langes Sicherungstau. Schon wieder bekam Frieda Wasser ab. Ihre blaue Hose, die eigentlich ihrem Bruder Dodo gehörte, war schon ziemlich nass. Doch das störte sie nicht sonderlich.
Interessiert beobachtete sie eine allseits bekannte Gräfin, die sich von zwei kräftigen Badedienerinnen ins Wasser tragen und in den Wellen hin und her wiegen ließ. Was für ein Anblick! Eine Woge drückte ihr Salzwasser in die Nase.
»Passt doch auf!« Sie japste vor Empörung.
Andere Damen nahmen ihr Kurbad so, wie sie wohl auch Lebertran schluckten – sie überwanden sich und ertrugen die erschröckliche Tortur des Eintauchens und Standhaltens tapfer im Dienste der Gesundheit. Bis zu zehn Minuten lang. Von einem noch längeren Aufenthalt im Wasser rieten Badeärzte ab.
Kein Mensch schwamm. Nur wenige Leute beherrschten diese Fertigkeit. Aber selbstverständlich gab es an beiden Badestränden der Insel Rettungsschwimmer des jeweiligen Geschlechts.
Margaretes Mutter gab Klopfzeichen. »Ich bin bereit!«
Die Dienerinnen bezogen Stellung, Herta verließ das Holzkabuff. Auf ihr Kommando hin schoben Gesine und sie die hinteren höheren Räder vorwärts, während vorne an der Deichsel zwei andere Badefrauen kräftig zogen. So lange, bis der Karren tief genug in der Nordsee stand. Natürlich achteten sie darauf, dass sie möglichst keinem anderen Karren zu nahe kamen, damit die Badende vor neugierigen Blicken von der Seite geschützt war.
Das verschleierte Mädchen indes verharrte nun vor dem Markisenkarren immer noch bockig wie ein Esel. Mehrere Badewärtinnen umgaben sie. Frieda sprang auf. Sie lief hinüber und stellte sich vor das Mädchen.
»Ich helf dir«, sagte sie, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Behände kletterte sie in den Karren, hielt dem Mädchen ihre Hand hin. »Komm!«
Und das Mädchen folgte ihr. Frieda zog die Vorhänge der kleinen Fenster zu. Sie ließ gerade noch so viel Licht rein, dass man die Ablagen, die Haken und die Sitzbänke an den Längsseiten erkennen konnte. Im Dunkeln war die Fremde sicher weniger verschämt. Frieda schwieg, weil ihre Mutter ihr eingeschärft hatte, dass man die Kundschaft nicht durch Gerede belästigen sollte.
»Wie heißt du?«, fragte das Mädchen mit angenehmer klarer Stimme.
»Frieda. Und du?«
»Margarete-Viktoria, aber die meisten Leute nennen mich Grete.«
»Soll ich dir dein Kleid aufknöpfen?« Es ließ sich vorne öffnen.
»Nein, das kann ich allein, aber gleich beim Korsett kannst du mir helfen.«
Zögerlich begann Grete, sich zu entkleiden. Zuerst entledigte sie sich der Stiefeletten. Dann förderte sie aus ihrem Bündel ein Paar hübsche blaue Badeschuhe mit Bändern hervor, die man über Kreuz um die Knöchel hochbinden musste.
»Das ist aber ein schöner Badeanzug!«, rief Frieda, als Grete einen dunkelblauen Taftzweiteiler mit weißer Bordüre bereitlegte.
»Hab ich bislang nur bei den Warmbädern angehabt. Und das hat schon genug wehgetan.«
»Wehgetan?«, echote Frieda verständnislos. Grete setzte sich, während sie den Schleier entknotete und den Hut abnahm. Im Profil sah sie wunderschön aus, geradezu umwerfend. Das war trotz des Dämmerlichts zu erkennen. Sie hatte ein kluges ovales Gesicht. Helle Haut, dunkle Augen, klassische Nase. Besonders bewunderte Frieda das lange schwarze Haar. Sein Glanz war ihr vorhin schon aufgefallen. »Wie Schneewittchen«, murmelte sie andächtig.
»So?«
Gretes Stimme klang verbittert. Sie wandte sich ihr zu, und Frieda zuckte zusammen. Ein Ausschlag, teils hellrot entzündet, teils dunkel verkrustet, verunstaltete die linke Gesichtshälfte.
»Oh!«
»Hübsch hässlich, nicht? Ekelst du dich jetzt vor mir?«
Frieda brauchte einen Moment, um zu reagieren. Sie setzte sich auf das Bänkchen ihr gegenüber. »Schön … ist das wirklich nicht. Aber ekeln? Nee.«
»Keine Sorge. Ist nicht ansteckend.«
»Gut.«
»Mein Husten übrigens auch nicht.«
»Oje.« Frieda fing sich wieder. »Viele Leute kommen ja gerade deshalb. Weil sie hier Heilung oder wenigstens Linderung erfahren.« Sie streckte die Hand nach dem in Wellen herabfallenden Haar aus. Es duftete angenehm. »Die sind wirklich prachtvoll!«
»Ich finde deine Farbe viel interessanter.«
»Och, so sehen doch alle aus.«
Grete konnte schon wieder lachen. »Hier auf eurer kleinen Insel vielleicht. Bei uns in Berlin nicht. Sind übrigens interessant geflochten.«
»Ja?« Frieda freute sich, dass sie es bemerkt hatte. »In meiner Klasse waren nur vier von dreißig Mädchen nicht blond.«
»Ach, du hast sicher so eine süße kleine Inselschule besucht, wo alle Jahrgänge in einem Raum unterrichtet werden, oder?«
»Nein!« Frieda schüttelte energisch den Kopf. Sie unterdrückte ein Kichern, weil sie sich das gerade bildlich vorstellte. »Wär wohl ein bisschen eng geworden – mit siebenhundert Schülern und zwanzig Lehrkräften.« Dass manche Kurgäste immer so tun mussten, als ob die Insulaner ein rückständiges, bedauernswertes, aber irgendwie niedliches Völkchen wären, so originell und ursprünglich! Dabei war Norderney schon seit über hundert Jahren ein vornehmes Seeheilbad. Sie hatten neben den zahlreichen Logierhäusern und Familienpensionen mit schmucken Erkern und Veranden Grandhotels, ein Theater und Kureinrichtungen vom Feinsten. Elektrisches Licht erleuchtete abends die Strandpromenade, das Hotel Kaiserhof und das Conversationshaus, strahlender als das sonst übliche Gasglühlicht. Na gut, bei ihnen zu Hause gab’s zwar noch Petroleumlampen, aber sämtliche Fahrstraßen auf der Insel waren geklinkert. Alles von der Kanalisation übers Gaswerk bis zum Schlachthof war so modern, wie es nur ging, das hatte ihr Lehrer oft hervorgehoben. Am Hafen von Norddeich stand während der Saison stets ein Schnellzug nach Berlin bereit, für den Fall, dass der Reichskanzler aus seinem Sommerdomizil in die Hauptstadt musste. Ihr Postamt war so groß und einschüchternd wie das einer richtigen Stadt, es verfügte über Telegramm- und Telefonverbindungen zum Festland. Und das dreistöckige Schulgebäude aus kunstvoll gemauerten Klinkersteinen, an dessen Einweihung sie sich gut erinnern konnte, bot neben den Klassen der Volksschule sogar noch ausreichend Platz für vier gehobene Klassen einer Privatschule. Überall im Schulgebäude war bestes Linoleum verlegt. Sie lebten auf Norderney nicht hinterm Mond. Kein Vergleich zu den rückständigen Moordörfern auf dem ostfriesischen Festland! Warum denn wohl verbrachten Könige, Kaiser, Fürsten, Offiziere, Fabrikbesitzer und Künstler mit ihren Familien die schönste Zeit des Jahres ausgerechnet auf Norderney? Und färbte der Umgang mit ihnen nicht ab? Frieda sprach zwar mit den Insulanern Plattdeutsch, aber sie hatte gelernt, verschiedene deutsche Dialekte zu verstehen und in gutem Hochdeutsch zu antworten. Sie bemerkte, dass Grete sie erwartungsvoll anschaute, doch statt ihr das alles zu erklären, behielt sie ihre Überlegungen für sich und schluckte ihren Ärger runter. »Willst du dich nicht weiter ausziehen?«
Seufzend gestattete Grete, dass Frieda ihr das Korsett aufschnürte. Jede Lockerung ließ sie freier atmen.
»Hach!« Als sie die mit Fischbein verstärkte Stütze endlich los war, holte sie ganz tief Luft. »Danke dir. Wie alt bist du, Frieda?«
»Vierzehn.«
»Ich auch.«
Wortlos hielt Frieda ihr die über dem Knöchel gerüschte Badehose zum Einsteigen hin und musterte verstohlen die schwellenden Brüste der Gleichaltrigen. Sie waren etwas weniger weit entwickelt als ihre eigenen.
»Könnten wir nicht einfach den Badeanzug nass machen und so tun, als wäre ich im Wasser gewesen?«, bat Grete. »Es sieht doch kein Mensch, ob ich unter der Markise in die Nordsee eintauche oder nicht. Sonst springst du mal kurz für mich rein, machst ordentlich Lärm und kommst wieder in die Kabine. Na, was meinst du?«
Frieda schüttelte den Kopf. »Nein, du willst doch, dass die Kur anschlägt. Dann musst du auch ins kalte Wasser springen.«
Grete ächzte enttäuscht. »Und wenn ich dir dafür eine heiße Schokolade im Café der Victoria-Halle verspreche?« Frieda lachte nur. »Eine Knüppeltorte oder ein Stück Cherry Cobbler beim Hofconditor Hoegel?«
»Ich bin nicht bestechlich.«
Frieda begann, Grete, die nur widerwillig die Arme hochhielt, das Oberteil überzustreifen, so wie sie es sonst bei ihrer kleinen Schwester Rieka machte. Dabei sah sie, dass der Ausschlag sich auch auf dem Bauch, auf dem Rücken und an den Oberarmen ausgebreitet hatte. Und Gretes Brustkorb schien irgendwie verformt zu sein. Die Ärmste, dachte Frieda mitleidig.
Nun verstand sie, wieso das Baden wehtun konnte. Das Salzwasser brannte sicher in den Wunden.
»Es juckt oft fürchterlich, und ich darf nicht kratzen«, erklärte Grete halb peinlich berührt, halb entschuldigend. »Aber manchmal kann ich mich einfach nicht beherrschen, und dann wird’s noch schlimmer.«
»Kenn ich. Ich hab mir auch schon Mückenstiche blutig gekratzt. Und richtig fies wird’s, wenn dich eine Feuerqualle berührt, das brennt höllisch.« Friedas Blick blieb an Gretes Taille haften. »Was ist denn das für eine tiefe Rille?«
»Das? Meine Schnürfurche!« Stolz warf Grete den Kopf in den Nacken. »Ich trage ein Korsett, seit ich sechs geworden bin, jeden Tag ein paar Stunden. Meine Mutter sagt, sonst gewöhnt sich der Körper später nicht mehr ausreichend dran, und man hat keine Chance auf eine richtig gute Wespentaille. Und auf einen Mann.«
»Wie schrecklich!«, entfuhr es Frieda.
»Na ja, mit meinem Ausschlag und dem Husten krieg ich sowieso keinen«, fügte Grete selbstironisch hinzu.
Sie beugte sich vor, um ihr Haar über dem Kopf zusammenzudrehen.
»Wart’s ab. Hast ja noch ein bisschen Zeit.« Frieda reichte ihr eine gewachste gelbe Badehaube mit Pompons. »Bis dahin bist du bestimmt gesund. Fertig?« Grete nickte. Die Haube sah ein bisschen lächerlich aus. Frieda gab den Badefrauen draußen das Klopfzeichen und wandte sich zum Gehen. »Halt dich gut fest, es ruckelt gleich.«
»Kannst du nicht bei mir bleiben?« Plötzlich wirkte Grete wie ein ängstliches kleines Kind.
Frieda überlegte kurz, dann zuckte sie mit den Achseln. »Klar, warum nicht?« Laut rief sie: »Ich bleib drin! Kann losgehen!« Der Karren setzte sich in Bewegung, es war wie Schiffschaukeln. Sie sahen sich an. Frieda spürte Gretes Anspannung. Dann endlich stand die Badekutsche wieder. Frieda öffnete die Tür zum Meer und ließ die weit vorragende Markise so tief wie möglich hinunter, bis etwa einen halben Meter überm Wasser. »Nun komm. Es macht Spaß!«
Grete warf ihr einen skeptischen Blick zu. Zwei der Badedienerinnen lugten unter der Markise durch. Gleich wich Grete zurück in die Dunkelheit des Karrens.
»Nicht gucken«, bat Frieda anstelle von Grete. »Lasst uns einfach allein.«
»Na gut«, hörte sie ihre Mutter antworten. »Vorne ist der Andrang gerade ziemlich groß. Wir bringen schnell einen anderen Karren rein und kommen dann zu euch zurück.«
»Jupp, alles klar!«
Grete trat wieder vor, sie lächelte zaghaft. »Danke!«
»Es ist nicht tief«, sagte Frieda aufmunternd. »Was soll schon passieren? Trau dich, spring einfach!«
Grete
Grete traute sich nicht. Keine Frage, das hellblonde Mädchen gefiel ihr. Frieda faszinierte sie sogar. Sie wirkte so unglaublich gesund. Zwar sprach sie ein bisschen putzig, norddeutsch breit, und ab und zu unterliefen ihr Fehler wie vielen Menschen, die mit einem Dialekt aufwuchsen und erst in der Schule Hochdeutsch gelernt hatten. Aber alles an ihr machte einen kräftigen, harmonischen Eindruck.
Ihr dagegen zitterten die Knie, der Magen schnürte sich zusammen, das Herz schlug bis in die Kehle hoch. Das Nordseewasser war ihr schon aufgewärmt und gereinigt in der Wanne des Warmbadehauses unheimlich gewesen. Und jetzt sollte sie sich schutzlos in diese ungezähmte Wildnis werfen? Graugrünes Meer, unruhig, brodelnd geradezu, braunweißer Schaum auf den Wellenkämmen, aufgewirbelter Sand – was mochte darin an Seeigeln, Schlangen und Knurrhähnen herumschwimmen? Vielleicht würden gleich Medusen oder Algen ihren Körper umschlingen. Grete fühlte sich mit jeder Sekunde, die sie zögerte, schwächer. Eine Böe fuhr unter die Markise und ließ sie frösteln. Wogen schlugen hart gegen die Karrenwand.
Wozu das alles? Ihr Oberkörper war schwach, ihr fehlte die Stütze des Korsetts. Besaß sie denn überhaupt ausreichend Kraft, um sich minutenlang den Naturgewalten auszusetzen?
»Na los!«, wiederholte Frieda.
Grete zauderte. Sie wollte sich nicht blamieren. Aber deshalb gleich das Leben riskieren? Während sie überlegte, verspürte sie plötzlich im Rücken einen Schubs. Sie verlor den Halt, platschte mit dem Bauch zuerst ins Wasser – und das war kalt, eiskalt, grausam kalt! Schlagartig zogen sich ihre Eingeweide zusammen. Kurz darauf schien es ihr sekundenlang, als loderte ein Feuer unter ihrer Haut auf. Heiß, kalt, heiß … was war denn nun wirklich? Ihre Füße suchten den Grund, fanden ihn, doch eine Welle rollte auf sie zu, riss sie um, sie schluckte das salzige Wasser, stieß gegen ein Wagenrad, spürte den Schmerz, musste husten. Sie hatte nicht mit der nächsten Welle gerechnet, die höher war als die vorherige, und tauchte erneut unter. Die Strömung zog sie mit, verzweifelt versuchte sie, den Kopf hochzubekommen, sie schnappte nach Luft, musste wieder husten und atmete Wasser ein, gurgelte, würgte, schmeckte das Meer in der Nase und im Rachen, es scheuerte regelrecht an ihren Schleimhäuten. Plötzlich bekam sie keine Luft mehr. Der Hustenreiz machte sie wehrlos, drohte sie zu ersticken. Ihr letztes Stündchen hatte geschlagen! Panische Angst stieg in ihr auf. Gleich würden ihr die Sinne schwinden, und das war’s dann mit ihrem kurzen langweiligen Leben.
Doch auf einmal fühlte sie, wie ihr jemand unter die Achseln griff. Sie wurde hochgezogen. Gierig schnappte sie nach Luft – der Krampf löste sich. Keuchend, mit rasendem Herzen, nahm sie hinter sich etwas Festes, Lebendiges wahr – Frieda, wie sie dann merkte, Frieda, die sie mit beiden Armen umfangen hielt. Sie standen breitbeinig da, und die Wellen schlugen nicht höher als bis zur Brust. Jetzt spürte Grete einen kurzen heftigen Druck von Friedas Unterarmen unter ihren Rippen. Ein Schwall Wasser schoss aus ihrem Magen empor, sie spuckte und hustete. Frieda zog sie zum Holztreppchen, rückwärts zwei Stufen hoch, hielt sie weiter fest.
Langsam beruhigte sich Grete. Das klatschnasse Haar hing ihr wirr um die Schultern. Sie sah, dass ihre Badehaube schon in die Nordsee hinaustrieb. Ein kleiner gelber Spielball auf den Wellen.
»Adieu!«, murmelte sie.
»Es tut mir leid«, sagte Frieda zerknirscht. »Ehrlich. Ich wollte dir nur einen kleinen Anstupser geben.«
»Ach …« Unwirsch winkte Grete ab. »Lass mich hoch!«
Frieda schüttelte den Kopf. »Du bist doch schon nass«, erklärte sie. »Wenn du jetzt aufgibst, wirst du nie Freundschaft mit dem Meer schließen. Du musst wieder rein. Das ist, wie wenn man vom Pferd gefallen ist.«
»Du meinst: gleich wieder aufsteigen?«
»Richtig.«
»Mensch! Ich hab gerade geglaubt, dass ich sterbe!«
Frieda lachte einfach. »Das wäre allerdings eine beachtliche Leistung. In kniehohem Wasser. Das hat vor dir noch keiner geschafft. Abgesehen vielleicht von ein paar alten Männern, die einen Herzschlag bekommen haben.«
Ganz schön unverfroren. Doch Grete musste grinsen. Irgendwie fand sie Friedas Art erfrischend. Ihre Familie fasste sie meist mit Samthandschuhen an, das war ihr auch nicht recht.
»Wat mutt, dat mutt.« Frieda zwinkerte ihr zu. »Na, was ist?« Sie schob sich an ihr vorbei, glitt zurück ins Wasser und ließ sich treiben. »Versuch’s doch mal so.«
»Du spinnst!«
Grete schüttelte den Kopf, sie hockte sich oben aufs Treppchen. Allerdings registrierte sie erstaunt, dass sie gar nicht mehr fror. Im Gegenteil, ein angenehmes Prickeln breitete sich überall in ihrem Körper aus, besonders lebhaft unter der Haut, und damit verbunden war ein völlig ungewohntes herrliches Gefühl von Stärke.
Frieda streckte ihre Arme und Beine aus wie ein Hampelmann. Sie schien zu schweben. Und sie lächelte, als wäre es ein Genuss. Neidvoll beobachtete Grete, wie Friedas Körper sanft gehoben und durch die Wellentäler getragen wurde, ohne dass sie dabei Wasser schlucken musste.
Das wollte sie auch! Frieda und sie tauschten einen Blick.
Grete hielt sich die Nase zu, kniff die Augen zusammen und wagte sich zurück in die Wellen.
»Jiii!«, rief sie in Erwartung des Temperaturschocks.
Doch zu ihrer Überraschung fühlte sich die Nordsee gar nicht mehr kalt an. Auf einmal war es ein Vergnügen, sich gegen den Druck der Wellen zu stemmen, zu spüren, wie das Wasser ihren Leib umspülte und sprudelnd massierte. Frieda lachte sie an, sie lachte zurück. Seit einer Ewigkeit hatte sie nicht mehr so viel Freude empfunden.
Beim Mittagessen auf der luftigen Veranda des Hotel zum Deutschen Hause gleich neben dem Kurtheater saß ihre Familie um denselben Tisch wie jeden Tag, er war für die Lehmanns reserviert. Grete hatte einen Platz mit dem Rücken zu den anderen Gästen gewählt. Sie schaute hinaus auf den Springbrunnen einer kleinen Grünanlage.
»Nächstes Mal sollten wir doch wieder mehr Personal mitnehmen«, bemerkte ihre Mutter.
Ihr Vater Ludwig knurrte, abgelenkt durch die Wirtschaftsnachrichten seiner Berliner Zeitung. »Du hast selbst gesagt, du brauchst das zweite Mädchen nicht unbedingt.«
»Nun ja, Erfahrung macht klug.« Ihre Mutter, sie hieß mit Vornamen Emilie und war eine geborene von Wingenhorst, lächelte müde. »Wir können froh sein, dass Margarete Zutrauen zu diesem Friesenmädchen gefasst hat. Dank Frieda ist es nun kein Problem mehr, sie zu den Kurbädern zu bewegen.« Ein liebevoll prüfender Blick streifte ihre Tochter. »Sie taucht seit ein paar Tagen sogar ohne Markise ins Meer.« Grete nickte. Ohne die Begrenzung konnte man viel besser in den Wellen herumspringen. Sie verlangte aber immer Frieda als Begleitung, sie bestand darauf. »Ich meine, unsere Tochter sieht auch schon viel wohler aus. Ihr Ausschlag hat sich in dieser Woche deutlich abgeschwächt.«
»Dann kannst du ja endlich, wenn wir in ein Lokal gehen, mit dem Zirkus bei der Platzwahl aufhören.«
»Und sie hatte auf Norderney noch keinen einzigen Asthmaanfall, nicht wahr, mein Kind?«
Grete nickte. Die Attacke neulich unter der Markise des Badekarrens unterschlug sie lieber. Sie wollte gern mehr Zeit mit ihrer neuen Freundin verbringen. Am nächsten Vormittag würde sie nicht baden gehen können, weil einige kurärztliche Untersuchungen anstanden. Aber sie hatte sich mit Frieda für nachmittags am Blumenpavillon im Ort verabredet. Unruhig hibbelte sie auf ihrem Stuhl herum. Kinder und Backfische durften nicht ungefragt bei Tisch reden.
»Papa, bitte frag mich etwas.«
Ihr Vater sah ungehalten von seiner Zeitung auf. »Was ist denn, Margarete?«
»Darf ich morgen Nachmittag etwas Zeit mit Frieda verbringen?«
»Frieda, Frieda – seit Tagen höre ich diesen Namen. Wer in drei Gottes Namen ist das?«
»Ich habe dir vorhin erst von ihr berichtet!« Gretes Mutter verdrehte die Augen. »Das kleine Friesenmädchen, das Margarete die Angst vor der Nordsee genommen hat. Sie ist in ihrem Alter, ein nettes aufgewecktes Ding. Ihre Mutter arbeitet als Badedienerin.«
»Badedienerin? Das ist doch kein Umgang.«
»Ihr Vater ist ein richtiger Fischer mit einem eigenen Boot«, hob Grete hervor. »Im Sommer bietet er auch Lustfahrten auf seiner Schaluppe rund um die Insel an, er kann ein Dutzend Gäste mitnehmen. Wollen wir da nicht mal mitsegeln?«
Geräuschvoll schlug ihr Vater die Zeitungsseite um.
»Und wozu möchtest du diese Frieda treffen?«
»Nur so, zum Reden. Und sie will mir Norderney zeigen.«
»Auf der Insel weilen derzeit jede Menge nobelster Familien. Warum reisen wir wohl hierher? Sucht euch neue Bekanntschaften in den besseren Kreisen.« Er blickte seine Tochter streng über den Zeitungsrand an. »Du musst dich immer nach oben hin orientieren, Margarete. Nicht nach unten.«
»Das ist eine wichtige Lebensregel«, bestätigte ihre Mutter.
Die du selbst ja nicht befolgt hast, dachte Grete aufmüpfig. Du hast einfach einen neureichen Bürgerlichen geheiratet statt eines Adligen. Keine Sorge, das wird mir nicht passieren. Aber das eine hatte ihrer Meinung nach überhaupt nichts mit dem anderen zu tun.
»Wir sind doch in den Ferien!«, wandte sie ein.
»Seht euch die Gästelisten an, die in der Inselzeitung veröffentlicht werden.« Ihr Vater begann wieder zu lesen.
»Ich hoffe ja, dass ich hier dem Reichskanzler begegne«, ließ sich Gretes zweitältester Bruder Eduard vernehmen.
Die Familie war schon mehrfach, immer betont unbeeindruckt, auf der Promenade an dessen Domizil, der Villa Fresena, entlangspaziert. Einmal hatte sie Gräfin Maria von Bülow, die Gattin des Kanzlers – geboren als hochadlige Principessa in Rom –, beim Lesen im Liegestuhl auf dem Rasen vorm Haus erblickt. Sie waren stehen geblieben, hatten demonstrativ in die andere Richtung geguckt, zum Strand, wo Kinder auf geführten Eseln ritten oder von Ziegen gezogene Wägelchen lenkten. Und beim Zurückdrehen hatten sie sich ganz viel Zeit gelassen. Aber auch wenn alle Beteiligten sich Mühe gegeben hatten, so zu tun, als wäre die Situation alltäglich – dieselbe Luft zu atmen wie solche Prominenz, das hatte ihr Lebensgefühl doch enorm gehoben.
Gretes Bruder Eduard war vierundzwanzig. Er wollte Diplomat werden. Dass er nach dem Freiwilligen Einjährigen beim Militär und seinem Jurastudium als Eleve im Außenministerium angenommen worden war, hatte er weniger dem Vermögen ihres Vaters als einer Tradition ihrer Familie mütterlicherseits zu verdanken. Die Grafen von Wingenhorst wirkten schon seit Generationen als Beamte im auswärtigen Dienst. Ihr ältester Bruder, der Ludwig hieß wie der Vater und zur Unterscheidung Lulu genannt wurde, strebte allerdings eine Militärkarriere an. Er konnte nicht bei ihnen sein, weil sein Regiment in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika in Windhuk stationiert war.
Immer wieder hörte man in letzter Zeit von Aufständen Eingeborener, Hottentotten und Herero, die niedergeschlagen werden mussten. Die Familie machte sich Sorgen um Lulu, aber auch nicht allzu sehr, denn er kämpfte nicht an vorderster Front.
Ihr jüngster Bruder Hans-Heinrich, der gerade sechzehn geworden war, beschoss heimlich mit Brotteigkügelchen die Angestellte Annemarie am Ende der Tafel. Sie musste in diesen Ferien neben ihren üblichen Aufgaben als Kammerzofe auch ein bisschen die eines Kindermädchens übernehmen. Das letzte hatte sie kürzlich verlassen, das neue trat seinen Dienst erst nach dem Sommerurlaub an. Ihr Hauslehrer befand sich im Urlaub.
»Ihr verwildert uns noch«, sagte die Mutter.
»Du kannst als Backfisch aus besserem Hause nicht frei herumlaufen wie eine Fischertochter«, mischte sich die Mutter ihres Vaters ein. Während der Stunden, die die Großmutter zum Inhalieren heilsamer Nordseeluft auf dem ausladenden Seesteg verbrachte, ließ sie sich von ihrer Gesellschafterin derzeit Johanna Spyris Roman Heidi vorlesen. Neulich hatte Grete ihre Omama dabei ertappt, wie sie vor Rührung über die Geschichte ein paar Tränen vergoss. »Aber solch ein Naturkind kann durchaus einen günstigen Einfluss auf die Entwicklung haben. Grete würde vermutlich neue Seiten des Lebens kennenlernen. Ludwig, ich meine, du solltest es noch einmal überdenken.«
Gretes Vater sah seine Frau an. »Emilie, was sagst du?«
»Oh, bitte, Maman, sag ja, ja!«, rief Grete dazwischen. »Wir können hier doch wirklich nicht verloren gehen.«
Ihre Mutter sog lange Luft ein, rang mit sich, atmete hörbar wieder aus. »Also gut, wenn Hans-Heinrich dich begleitet, soll es in Ordnung sein. Aber ihr kommt pünktlich zum Abendessen zurück.«
»Nein!«, protestierte ihr Bruder entsetzt. »Ich hab schon andere Pläne. Erst ist Tennisstunde. Hast du das vergessen? Und danach bin ich mit ein paar Jungs von der Berliner Strandkompanie verabredet, wir wollen zur Seehundbank.« Die Jungen der Kurgäste fanden sich in den Ferien in nach Landsmannschaften geordneten Regimentern zusammen. Sie exerzierten, musizierten, marschierten mit Fähnlein am Strand auf und ab und fochten mit Holzgewehren in den Dünen wilde Schlachten aus. Einige hatten sich miteinander angefreundet, sie unternahmen auch sonst einiges gemeinsam.
»Och, Heinilein, lass die Jungs sausen! Du bist doch sowieso längst zu groß für solche Spielchen.«
»Du irrst«, bemerkte der Bruder. »Ich bin zu jung. Ich will endlich richtig mitmachen.«
»Zum Glück dauert es noch etwas, bis sie dich lassen«, warf die Großmutter ein.
»Oder robb ein andermal mit denen über die Sandbank! Bitte, Brüderchen«, schmeichelte Grete.
»Um freiwillig den Aufpasser für zwei pickelige Nervensägen zu spielen?«, flüsterte er ihr ins Ohr, damit die Eltern es nicht hörten.
»Du bist gemein!«
Sie versetzte ihm unter dem Tisch einen Tritt vors Schienbein. Wie ungerecht, dass ihr Bruder eigene Pläne machen durfte und sie nicht. Gab es denn keine andere Möglichkeit? Sie überlegte. Ihre Großmutter würde bestimmt nicht auf die Dienste ihrer Gesellschafterin verzichten, und eigentlich war sie auch nicht besonders erpicht darauf, von dieser pomadigen Person überwacht zu werden.
»Eduard«, sprach die Mutter ihren ältesten Sohn an, »könntest du bitte dein diplomatisches Geschick spielen lassen, um den Konflikt zu lösen?«
»Aber gern, Maman«, erwiderte ihr gut aussehender Bruder ironisch. »Ich schlage vor, wir bilden ein Komitee. Das wird in wenigen Sitzungen einen Kompromiss erarbeiten. Selbstverständlich sollte auch eine Delegation der Seehunde Gehör finden.«
»Heiliger Brehm!« Enttäuscht schob Grete ihren Teller von sich fort. »Bis du eine Lösung findest, sind wir längst wieder in Berlin.«
Eduard und Hans-Heinrich grinsten.
»Eduard steht eine große Karriere bevor«, unkte Hans-Heinrich.
»Brüder!« Grete stöhnte auf. »Warum hab ich denn nur Brüder? Ich hätte so gern eine Schwester.«
»Ich verstehe nicht, warum du dich beklagst«, erwiderte ihr Vater trocken. »Drei unserer vier Kinder haben doch eine Schwester.«
Grete fand das überhaupt nicht komisch. Sie neigte den Kopf, starrte auf ihre Damastserviette und schwieg gekränkt. Kein Mensch verstand sie – außer vielleicht Frieda. Und ausgerechnet die würde morgen Nachmittag vergeblich auf sie warten.
Im Inselsalon
Friseurmeister Fritz Fisser liebte Spionagegeschichten, und seine Frau Jakomina war einer der abergläubischsten Menschen auf ganz Norderney. Diese Kombination sorgte dafür, dass dem Paar seit fünfundzwanzig Jahren der Gesprächsstoff nicht ausging.
Als die zum Fülligen neigende Jakomina ihrem Mann an diesem Sommermorgen, wie immer mit makellos aufgesteckter Frisur und blütenreinem Friseurkittel, seine erste Tasse Ostfriesentee ans Bett brachte, war er noch müde, weil er bis spät in die Nacht gelesen hatte. Sie dagegen verströmte eine ungewohnte Unruhe.
»Ich hatte einen sehr merkwürdigen Traum, ganz intensiv und besonders«, verriet sie, während sie auf der Bettkante Platz nahm. »Ich sah unseren Barbierstuhl auf der Buhne für die Segelschiffe stehen. Am äußersten Ende. Das Wetter war durchwachsen, der Himmel bedeckt. Doch ein Sonnenstrahlenbündel drang durch die Wolkendecke und beleuchtete unseren Barbierstuhl wie einen Thron in der bewegten See.«
»Wer saß denn darauf?«
»Niemand. Es lag nur ein gepelltes Ei auf dem Sitz. Was mag das zu bedeuten haben?« Sie nahm ihrem Mann die Bartbinde, die er ihr schlaftrunken reichte, ab und legte sie ordentlich in die Nachttischschublade. »Ich glaub, ich muss unbedingt mal wieder zum Wickwief.«
Die Wahrsagerin, eine Witwe Mitte fünfzig, lebte allein in einem alten Häuschen in den Dünen. Ihr widerfuhr manchmal das, was die Insulaner »een Vörlopp« nannten, einen Vorlauf. Schon mehrfach hatte sie im Voraus den Untergang eines Schiffes, den Tod eines Norderneyers oder einen Wiedergänger gesehen. Sie besaß aber nicht nur das zweite Gesicht, sondern konnte zudem Träume deuten, die andere gehabt hatten. Außerdem wusste sie von allerlei Zauber, mit dem man sich gegen Hexeneinfluss wehren konnte. Der Pastor wetterte in regelmäßigen Abständen gegen sie, gegen dummen Aberglauben, wie er sagte, aber die meisten Insulaner behandelten das Wickwief mit Respekt. Auch wenn längst nicht jeder ihre Dienste in Anspruch nahm – mit ihr verderben wollte es sich niemand.
»Ich finde, von diesem Bild mit der Segelbuhne geht doch etwas Freundliches aus.« Fritz Fisser versuchte sich als Traumdeuter, in der schwachen Hoffnung, seine Frau würde ihr Geld dann nicht zum Wickwief tragen. »Ein Platz an der Sonne dürfte ein gutes Omen sein. Das bedarf keiner weiteren Deutung.« Er setzte sich auf, rieb sich die Augen und genoss den ersten sahnigen Schluck seines Morgentees.
»Meinst du?« Seine Frau knetete unruhig ihre Hände.
»Allerdings.« Ihm fiel der ausführliche Bericht über einen englischen Roman wieder ein, den er quasi mit angehaltenem Atem gelesen hatte. Das Buch The Riddle of the Sands würde übersetzt »Das Rätsel der Sandbank« heißen. Es verkaufte sich nicht nur sensationell gut, es hatte auch die Admiralitäten in Großbritannien wie in Deutschland alarmiert. »Wir müssen auf der Hut sein! Unbedingt. Mehr denn je. Denn es steht zu befürchten, dass britische Offiziere unsere ostfriesische Küste ausspionieren. Sie tarnen sich als Freizeitsegler. Aber heimlich fertigen sie detaillierte Seekarten an, damit die britische Marine uns eines Tages besser überfallen kann.«
Jakomina lächelte milde. Sie war zum Glück die Vernünftige in der Familie. Sie verfügte über ein Gespür für das Wahrscheinliche, konnte die Dinge realistisch einschätzen, vermochte Gefahren frühzeitig auszuweichen und sich gegen Unvermeidliches zu wappnen. Ihre Umsicht zeigte sich schon in Kleinigkeiten. Oft reichte es beispielsweise, drei Paar Stopfnadeln gekreuzt unter die Türschwelle zu legen, um gegen böse Überraschungen gefeit zu sein. Seit sie diese Vorsichtsmaßnahme getroffen hatte, war jedenfalls keine Hexe mehr in ihren Salon gekommen.
Natürlich ließ Jakomina ihren Mann ihre Überlegenheit in diesem Punkte nicht spüren. »Der Tag dürfte noch sehr fern sein, Meister Fisser. Du weißt, dass der König von England der Onkel unseres Kaisers ist. Da gibt’s vielleicht mal Kabbeleien und Streit unter Verwandten, aber man führt gegeneinander keinen richtigen Krieg auf Leben und Tod.«
»Dein Wort in Gottes Ohr!« Fritz Fisser nahm den letzten Schluck Tee und zerknabberte die Kandisreste. »Ich wette übrigens, dass der Schriftsteller auf Norderney gewesen ist. Und das Vorbild für die Villa, in der der Spion gefasst wird, der sich am Ende das Leben nimmt, war ganz gewiss die Villa Fresena.«
»Wie aufregend!« Sie nahm ihm die leere Tasse ab. »Ob die Einrichtung wohl gut beschrieben ist?« Die markante Villa gehörte dem Grafen von Wedel und erhob sich am Weststrand. Dort an der Promenade hatte sich der ostfriesische Landadel schon vor Jahrzehnten die besten Grundstücke gesichert und herrschaftliche Sommervillen erbauen lassen. Der amtierende Reichskanzler Graf Bernhard von Bülow, nach Kaiser Wilhelm II. wichtigster Mann des Deutschen Reiches, pflegte seit Jahren die Villa Fresena zu mieten, um darin samt Gattin, aus Berlin mitgebrachten Dienstboten, Adjutanten und Sekretären den Sommer zu verbringen. Zahlreiche vaterländische Vereine unternahmen Tagesausflüge nach Norderney, um dem Kanzler zu huldigen. Ebenso zahlreiche Fotografien hielten jene erhabenen Momente fest, da er vom Balkon winkte. »Vielleicht kennt der Schriftsteller die Villa von Bildern«, überlegte sie. »Und überhaupt, mein Lieber, bedenke, es ist nur ein Roman.«
»Ich mache mir aber doch Sorgen, seit unser Erzfeind, der Franzose, seine Liebe zu England entdeckt hat. Das neue ›herzliche Einverständnis‹ zwischen den beiden Ländern, diese kürzlich verkündete Entente cordiale, ist nicht gut für Deutschland.«
»Nun ja, besprich das mit deinen Honoratioren.« Beim Rasieren der Stammkunden wurde stets lebhaft über Politik disputiert. »Hast du gestern Abend noch ein ernstes Wort mit Hilrich sprechen können?«, lenkte seine Frau auf ein Thema um, das ihr viel mehr am Herzen lag. Ihr Ältester arbeitete im Salon, er würde ihn eines Tages übernehmen. Hilrich war ihr ganzer Stolz, sah blendend aus und beherrschte besser als jeder andere, den Vater eingeschlossen, die Kunst der Ondulation nach Marcel. Zudem hatte er ein Händchen für raffinierte Abendfrisuren und für die typgerechte Bartwahl. Deshalb rissen sich Damen wie Herren darum, von ihm bedient zu werden. Vor großen gesellschaftlichen Ereignissen bestellten ihn vornehme Kunden auch gern in ihr Hotel. Doch nun hatte Hilrich seinen Eltern verkündet, dass er fortwollte. Er plante, längere Zeit in Berlin zu arbeiten, um sich dort in einem führenden Friseursalon den letzten Schliff zu holen. Jakomina Fisser mochte sich gar nicht ausmalen, welchen Gefahren ihr Sohn in der Hauptstadt ausgesetzt sein würde. Letztlich würde es sich wohl nicht verhindern lassen, dass ihr Liebling sich abnabelte. »Es wäre eine Katastrophe fürs Geschäft, wenn er uns jetzt verließe«, sagte sie besorgt.
Erst recht, wo sich vor Kurzem ein Friseur aus Norden erdreistet hatte, eine Filiale auf der Insel zu eröffnen. Damit konkurrierten nun im Sommer schon vier Salons miteinander. Im Winter waren es lediglich zwei. Der Inselsalon blieb durchgehend geöffnet, arbeitete dann nur mit weniger Personal, mit der Kerntruppe rund um die Familie.
Ihre Tochter Frauke war sechzehn Jahre alt, nicht halb so begabt wie Hilrich oder der Vater. Sie verfügte wie ihre Mutter natürlich nur über die begrenzten Kenntnisse, die Frauen als mithelfende Familienangehörige in ein paar mehrwöchigen Kursen der Friseurinnung in Aurich vermittelt bekamen. Eine Lehre durften ausschließlich Männer absolvieren.
Ihr Geselle Erwin – kräftig, rothaarig, die Haut übersät von blassen Sommersprossen – war munter und vielseitig, aber kein Künstler wie Hilrich. Willy, der sympathische, manchmal etwas zu freche Junge, hochaufgeschossen und brünett, der seit zwei Jahren bei ihnen in die Lehre ging, eignete sich mehr fürs Barbieren als fürs Wellenlegen. Auch den zweiten Lehrling, Menno, wegen seiner blonden Locken Kruuskopp genannt, konnte man noch nicht auf jeden loslassen.
Schon mehrfach hatten sie darüber gesprochen, bald eine erfahrene Kraft vom Festland einzustellen, allerdings würden damit auch ihre Ausgaben steigen. Sie trugen schon schwer am Abtrag des Kredits, mit dem der Salon zwei Jahre zuvor modernisiert worden war. Andererseits schien es eine gute Kurzeit zu werden. Man musste sorgfältig abwägen.
Ihr Mann schlug die Federdecke zurück und stand auf. »Du hast schon geschlafen, als ich zu Bett ging.« Er strich über sein langes Nachthemd. »Hilrich hat mir gestern Abend versprochen, dass er erst zum Ende der Saison gehen wird. Nach seinem zweiundzwanzigsten Geburtstag im September.« Erleichtert atmete Jakomina auf. »Ich hab trotzdem schon eine Anzeige in der Friseur-Zeitung aufgegeben. Herausragende Kenntnisse auf den Gebieten der Ondulation nach Marcel und des Färbens sind ausdrücklich verlangt.«
»Ach, das ist gut.«
Um beides machte Jakomina gern einen Bogen. Sie war zufrieden, wenn sie Kindern die Haare schneiden, Kämmchen verkaufen und das Mittagessen für alle kochen konnte.
»Was die Bedeutung deines Traumes angeht, Minchen …«, Fritz Fisser legte einen Arm um ihre Schultern. Er versuchte, sie mit genau jenem Spruch zu beruhigen, den das Wickwief seiner Frau schon oft mit auf den Weg gegeben hatte. »Wenn es so weit ist, wirst du es wissen.«
Frieda
Lilienduft strömte aus dem mit wunderschönen Ornamenten verschnörkelten Blumenpavillon im Ortskern. Frieda wartete schon seit zehn Minuten auf Grete. Das Nachmittagskurkonzert vor dem Conversationshaus, einem lang gestreckten klassizistischen Gebäude, das schräg gegenüberlag, hatte bereits begonnen. Auf von Rabatten gesäumten Wegen spazierten Kurgäste durch die Grünanlage, unterhielten sich oder lauschten den Märschen und Operettenklängen. Frieda ging auf dem angrenzenden Marktplatz auf und ab, umkreiste den Pavillon und hielt Ausschau im Arkadengang des Bazar-Gebäudes.
Sie freute sich darauf, Grete gleich ein paar ihrer Lieblingsplätze zu zeigen. Zum Beispiel das Kaap, das Seezeichen Norderneys. Von der hohen Düne aus, auf der es stand, hatte sie als kleines Kind oft mit Mutter oder Großmutter Ausschau nach dem Schiff ihres Vaters gehalten. Noch nie war ihr ein gleichaltriges Mädchen so exotisch und interessant erschienen wie die Berlinerin. Sie wollte erfahren, wie sie lebte, was sie wusste, fühlte und dachte. Irgendwie hatte sie schon jetzt das Gefühl, dass sie sich trotz der Andersartigkeit mühelos mit ihr verstand, vielleicht sogar besser als mit ihren Norderneyer Freundinnen. Sie konnte es nicht richtig in Worte fassen, aber mit der neuen Bekanntschaft verbunden war eine angenehme Aufregung, als würde der Horizont aufklaren.
Überall auf der Insel kannte man Frieda als die Tochter des Fischers Dirk Dirks, der eine Weile als Trinker gebrandmarkt und aus den Dorfkneipen geworfen worden war. Er hatte auf einer amtlichen Säuferliste gestanden, dem »Verzeichnis der Trunkenbolde« der Königlichen Landdrostei Aurich. Zum Glück war ihr Vater seit langer Zeit abstinent, doch der Familienmakel hatte sich tief in ihre Seele eingebrannt.
Man kannte sie allerdings auch als das Mädchen, das mit einer Glückshaube geboren worden war. Ihre Großmutter erinnerte sie daran, wenn sie niedergeschlagen war. Das ist ein gutes Omen, pflegte sie zu sagen. Es sind immer gutmütige Menschen, die so zur Welt kommen. Manche von ihnen besitzen sogar übernatürliche Fähigkeiten.
Von einer seherischen Gabe hatte Frieda bei sich noch nichts bemerkt, sie war sich auch nicht sicher, ob sie so was wirklich haben wollte. Aber die Geschichte mit dem Glückszeichen, die nahm sie gern an. Daran glaubte sie. Ihr würde schon nichts Böses geschehen.
Ein städtisches Publikum, eingehakte Paare, Familien mit Kindermädchen und ältere Herrschaften am Gehstock, schob sich an ihr vorüber. Frieda musste zugeben, einige der Damen waren überaus elegant, geradezu atemberaubend schön.
Ob diese Sache mit der Schnürfurche wirklich so erstrebenswert war? Gretes Mutter gehörte auch zu den Frauen, deren Figur von der Seite wie ein wandelndes S aussah. Der Oberkörper mit vorgewölbter Brust und durchgedrücktem Rücken schien, mehr getrennt als verbunden durch eine schmale Taille, um ein Stück vorversetzt vor dem Unterkörper zu schweben. Frieda versuchte, während sie auf der Kante des Bürgersteigs balancierte, ein paar Schritte auf diese Weise zu gehen. Mit angehaltenem Atem drückte sie die Brust raus, nahm die Schultern straff zurück, zog den Bauch ein. Sie erntete missbilligende Blicke und brach den Versuch mit einem heftigen Ausatmen schnell wieder ab. Wie konnte man nur so gehen? Kein Wunder, dass die feinen Damen ständig ein Riechfläschchen benötigten. Ach herrje, schoss es Frieda durch den Kopf, hoffentlich ist Grete nicht unterwegs in Ohnmacht gefallen!
»Pass doch up!«, rief ein Kutscher.
Frieda wich einem voll besetzten Pferdeomnibus aus, trat in einen Haufen Pferdeäpfel. Während sie ihren Schuh im Gras säuberte, erkannte sie auf der anderen Straßenseite Hilrich Fisser, den blonden Juniorchef des Inselsalons. Das war mal ein gut aussehender junger Mann! Der gefiel ihr. Aber er hatte keinen Blick für sie, und man munkelte auch, er ginge mit Anna, der Tochter des Hotelbesitzers Onno Remmers. Die war schon älter, hübsch und wohlhabend.
Wo blieb denn Grete nur? Ihre Augen suchten den Marktplatz ab. Sie würde sie auch mit verschleiertem Gesicht von Weitem erkennen – an ihrem schönen Haar. Doch weit und breit keine Spur von ihr.
Frieda setzte sich auf eine Parkbank. Sie studierte die Frisuren ringsum, überlegte, wie viele und welche Haarteile die Zofen für ihre Herrinnen wohl benötigten. Natürlich trugen alle einen Knoten, denn woran sonst sollten sie mit großen Haarnadeln ihre Hüte befestigten? Die einen trugen ihn oben auf dem Kopf, die anderen tiefer im Nacken, mal fiel er schlichter aus und mal kunstvoll verschlungen. Daran konnte man schon eine Menge ablesen und auf den Charakter der Trägerin schließen. Ob sie streng war oder verspielt zum Beispiel. Am interessantesten fand Frieda es, die Damen abends zu beobachten, wenn sie zu einem Ball gingen – ohne Hut, mit Federn und Blumen im Haar.
Schon wieder waren zehn Minuten vergangen. Grete würde wohl nicht mehr kommen. Enttäuscht sackte Frieda in sich zusammen. Nahm Grete sie nicht ernst? Wollte sie sich vielleicht sogar lustig über sie machen, indem sie zu ihrer Verabredung nicht erschien? Nein, das glaubte sie eigentlich nicht. Sie hatten einander in die Augen gesehen. Ihr Interesse war ehrlich und echt gewesen.
Frieda wunderte sich selber darüber, dass Gretes scheußlicher Ausschlag sie nicht abstieß. Vielleicht lag es daran, dass sie im abgedunkelten Badekarren die Schönheit erkannt hatte, die darunter verborgen lag. Vielleicht hatte das Sandwurmaufspießen sie auch abgehärtet. Oder lag es vielleicht daran, dass sie damals, als ihre vier Geschwister eines nach dem anderen an Masern erkrankt waren, als Einzige verschont geblieben war und ihrer Mutter bei der Pflege geholfen hatte? Zum Glück waren alle durchgekommen. Ihr ältester Bruder Hero fuhr inzwischen auf einem Fischdampfer und besuchte die Familie nur noch selten. Ihre ältere Schwester Mientje war längst verheiratet und lebte auf Borkum. Nun wohnten nur noch Dodo, sie und Rieka zu Hause. Und natürlich die Großeltern.
Die Kirchturmuhr schlug zur halben Stunde. So lange wartete Frieda sonst auf ihre Freundinnen nicht. Aufmerksam beobachtete sie weiter das Treiben ringsum. Einige Kurgäste waren schon recht seltsam. Sie liefen immer auf den gleichen Wegen durch den Park, und zwar so, als hätten sie ein Lineal verschluckt. Die Herren, Schritt für Schritt mit dem Spazierstock aufstoßend, lüfteten den Hut oder die Prinz-Heinrich-Mütze, sobald sie anderen Gästen begegneten, die sie offenbar kannten. Sie grüßten – da gab es wohl Regeln, wer wen zuerst grüßen musste –, blieben stehen, unterhielten sich etwas und gingen weiter. Bei der nächsten und übernächsten Runde wiederholten sie das Spiel, als hätten sich ihre Wege nicht bereits zigmal gekreuzt. Das musste doch schrecklich langweilig sein! Ungeduldig zippelte Frieda an den Bändern ihrer weißen Haube. Keine Grete. Schade. Dabei hatte sie sich sorgfältiger als sonst angezogen – zum wadenlangen dunkelblauen weiten Rock eine Schößchenbluse, die eigentlich zur Sonntagstracht gehörte. Sogar Schuhe trug sie, als müsste sie zur Schule gehen. Natürlich sah man ihr trotzdem an, dass sie kein Gästekind war.
»He! Was machst du hier?«, schnauzte sie ein Aufseher der Kurverwaltung an.
Sie fuhr zusammen. Dumme Frage.
»Ich sitze hier und warte.«
»Kannst du nicht lesen, du freches Gör?« Er zeigte auf ein Schild, das an der Bank prangte – NUR FÜR KURGÄSTE. »Verschwinde hier, oder ich mach dir Beine!«
Frieda streckte ihm die Zunge raus und lief weg.
Betrübt trottete sie zu Hause durchs Gartentor. Ihre Mutter saß auf einem Binsenstuhl vor der Eingangstür und strippte Johannisbeeren in eine Kumme. »Was ziehst du für ’ne Schnute?«
»Och, Grete ist nicht gekommen …«
»Ihr verbringt jetzt schon viel zu viel Zeit miteinander. Die anderen Badedienerinnen sind längst angesäuert, weil du jeden Tag am Strand mitmachst. Du hast keine Genehmigung«, sagte ihre Mutter streng.
»Aber sonst würde sie doch nicht baden gehen.«
»Ich weiß. Deshalb steck ich ja auch das Geld, das Frau Lehmann mir für dich gibt, immer in den großen Trinkgeldtopf.« Ihre Mutter sah sie mitfühlend an. »Häng dein Herz nicht an ein reiches, krankes Stadtmädchen. Grete wird dir nur Flausen in den Kopf setzen.« Wie zum Trost reichte sie ihr ein paar reife Beeren. »Freundschaften mit solchen Leuten sind nichts für unsereins. Das meint man vielleicht, wenn man jung ist. Aber es kann nicht gut gehen. Bald ist sie wieder weg.«
Im Inselsalon
Fritz Fisser ging nach draußen und hängte das Zunftzeichen der Friseure, einen blank geputzten Metallteller, oben neben die Eingangstür. Der Inselsalon befand sich in einem weißen Eckgebäude mit umlaufendem Säulengang nahe dem Marktplatz, nicht weit vom Conversationshaus entfernt, im Zentrum des Kurlebens. Eine Weile blieb er stehen wie jeden Morgen, grüßte vorübereilende Bekannte, winkte ins Geschäft gegenüber und atmete tief durch. Die Luft war noch frisch, aber es würde ein schöner Tag werden. Er prüfte die neue Dekoration in beiden Schaufenstern, spiegelte sich im Glas und war zufrieden mit dem, was er sah – einen agilen, mittelgroßen Mann in den besten Jahren, mit blauen Augen und braunem Haar, akkurat seitlich gescheitelt, der Bart kaiserlich in Hochform gebracht.
Und schon tauchte der erste Kunde auf.
»He, Fritz!«
»He, Theo. Allens up stee?«
»Jau, mutt ja. Un sülmst?«
»Geiht.«
Alles in Ordnung? Muss ja, und selbst? Es geht. Der Dialog wiederholte sich täglich. Fritz hielt dem Redakteur der Inselzeitung die Tür auf. Er ging durch den Verkaufsraum, der in der Mitte lag, nach links in den nicht weiter abgetrennten Herrensalon. Theo Weerts nahm Platz, bekam einen Umhang umgelegt und eine Rasierschale gereicht.
»Die russische Handelsdelegation ist eingetroffen«, wusste der Journalist zu berichten, »unter der Leitung von einem ganz hohen Tier, Sergej Witte, er ist der Vorsitzende des russischen Ministerrats. Die sind gestern im Großen Logierhaus abgestiegen.«
Fritz brauchte eigentlich keine Tageszeitung, Theo berichtete ihm immer das Wichtigste. Vor allem wusste er noch mehr, als er im Inselboten veröffentlichte. Bei den Verhandlungen, erklärte er, ginge es um Handelserleichterungen und neue Zollvereinbarungen zwischen dem Deutschen Reich und Russland, das durch den gegenwärtigen Krieg mit Japan geschwächt war. Nach und nach trudelten weitere Männer ein, die alle ein Monatsabonnement hatten. Der verwitwete Kurarzt Dr. Hermann Seut in zerbeulten Hosen, schon ergraut, mit Brille und Schnauzbart einem Seelöwen nicht unähnlich. Der Hotelier Onno Remmers, ein strohblonder Hüne, ebenso guter Gastgeber wie Geschäftsmann in den besten Jahren, im Gesangverein der beste Bariton. Und der steifbeinige, gutmütige Jan Gerdes, Besitzer eines Tabakgeschäfts, der nie ohne Stock ausging und seine leeren Zigarrenkisten immer an Kinder aus dem Seehospiz verschenkte. Das schlimme Bein war ihm nach einer Kriegsverletzung anno 1871 geblieben. Na, hat sich ja gelohnt, pflegte er zu kommentieren, wenn jemand sein Mitgefühl wegen der Behinderung ausdrückte. Er hatte mit seinen Kameraden gesiegt und dafür gesorgt, dass die deutschen Königreiche, Herzogtümer und andere Kleinstaaten endlich in einem einzigen Deutschen Reich hatten vereint werden können. Die Einheit des deutschen Volkes, auf das Schönste verkörpert im Kaisertum, das war wohl ein steifes Bein wert.
Man kannte sich, man duzte sich. Theo war der Einzige mit Spitzbart, Onno und Jan zogen es vor, ihre Manneszierde wie der Kaiser seitlich hochzuzwirbeln.
»Die Russen sind da«, teilte Fritz ihnen mit.
Hilrich, Erwin und Willy begrüßten die Stammkunden, nahmen wie auf Kommando deren beschriftete Rasierbecher mit den persönlichen Utensilien darin vom Regal und begannen mit dem allmorgendlichen Pflegeritual.
»Sie wollen zwei Wochen bleiben. Die Verhandlungen finden wohl beim Reichskanzler direkt in der Villa Fresena statt«, steuerte Onno bei, der durch andere Kanäle bereits über die Neuankömmlinge informiert war. Natürlich bedauerte er, dass die Delegation nicht in seinem Hotel wohnte.
»Deutschland sollte ruhig freundschaftlichere Beziehungen zu Russland pflegen«, meldete sich Hermann zu Wort. »Wir brauchen mehr Verbündete als nur Österreich-Ungarn. Seit die Engländer und Franzosen sich lieben, stehen wir nämlich ziemlich allein auf weiter Flur da.«
»Ganz meine Meinung.«
Fritz verteilte gerade die aufgeschäumte Rasierseife auf Theos Wangen und Hals, als ein schneidiger Hauptmann den Salon betrat. Er stellte sich als Adjutant des Reichskanzlers vor. Vertraulich nahm er den Saloninhaber zur Seite.
»Seine Exzellenz wünscht, sich die Haare schneiden zu lassen«, raunte er.
Fritz wäre beinahe der Pinsel aus der Hand gefallen. Er verbeugte sich mehrfach, eine Hitzewelle durchlief seinen Körper vom Bauch bis in die Ohrläppchen.
»Selbstverständlich. Welch hohe Ehre!« Er überlegte. »Wann? Sollen wir das Geschäft ganz für ihn freihalten? Oder möchte er eine separate Kabine?«
Im Damensalon, der vom Verkaufsraum aus durch eine Glastür, eine Stufe höher gelegen, nach rechts abging, hatten sie neben mehreren durch Vorhänge abgetrennten Kabinen auch eine, die durch den Hausflur erreichbar war. Das ermöglichte allergrößte Diskretion. Immer wieder kam es nämlich vor, dass eine Kundin beim Friseurbesuch unbeobachtet bleiben wollte.
»Nein, keineswegs. Der Reichskanzler genießt gern einmal die Atmosphäre eines gepflegten Friseursalons.« Der Adjutant sprach kultiviert, leicht schnarrend. »Machen Sie kein Aufhebens.« Dennoch musterte er die Anwesenden scharf. Fritz entging nicht, dass Hilrich seinen Blick mit Bewunderung erwiderte. Dieser Hauptmann verkörperte Stil und militärische Eleganz. Fritz sah seinem Sohn an, was er in diesem Augenblick dachte, und konnte gut verstehen, dass er sich auf Berlin freute. Schließlich war er selbst als junger Friseurgeselle auf der Wanderschaft gewesen, bis nach Paris war er gekommen. »Kennen Sie hier jeden persönlich?«
»Wieso?«, fragte Fritz irritiert. »Ach, Sie meinen …« Natürlich! Der Kanzler musste jederzeit mit einem Attentat rechnen. Sogar auf ihrer Insel, wo die Welt noch in Ordnung war. Bei seinen täglichen Ausritten am Strand und durch die Dünen wurde Bernhard von Bülow stets zur Sicherheit von ein oder zwei Männern begleitet. Meister Fisser richtete sich gerader auf. »Sind alles Stammkunden, Herr Hauptmann.«
»Und dort?«
Er zeigte auf die mit Glasgravur verzierte Tür zum Damensalon. Hilrich öffnete sie, damit er hineinschauen konnte. Dort war um diese Zeit nicht viel Betrieb.
»Nur meine Tochter Frauke«, erklärte Fritz. »Frisiert gerade Frau Meyer von Feinkost Meyer.« Ohne nachzudenken, schlug er die Hacken zusammen, verfiel in eine knappe militärische Sprache. Schließlich hatte er gedient. »Besondere Vorlieben zu beachten?«
Der Hauptmann musterte das Regal hinter dem Verkaufstresen. Dort standen etliche Packungen mit der ES IST ERREICHT! genannten Spezialbartpflege von François Haby, dem französischen Hoffriseur Kaiser Wilhelms II.
»Nein, wie ich sehe, führen Sie die richtige Bartwichse.« Er studierte die Preistafel. »Was macht das?«
»Selbstverständlich … gar nichts. Es ist mir eine hohe Ehre«, stammelte Fritz.
Doch der Adlatus des Kanzlers zückte seinen Geldbeutel und entrichtete einen mehr als großzügigen Betrag. »Erwarten Sie ihn in zirka fünfzehn Minuten. Guten Tag.«
Mehrstimmiger Glöckchenklang begleitete seinen Abgang.
»Guten Tag. In zirka fünfzehn Minuten, sehr wohl«, murmelte Fritz.
Theo hielt noch die Barbierschale unterm Kinn, er schloss aber endlich seinen Mund. »Allerhand, mein Lieber«, sagte er beeindruckt. Seifenschaum tropfte herab. Doch er schmunzelte. »Schleif mal flugs deine Messer. Aber nicht zittern, das würde dich teuer zu stehen kommen.«
Noch stand Fritz da wie festgefroren. »Wart eben, Theo.«
»Du glaubst doch nicht, dass ich jetzt aufsteh und weglaufe? Das lass ich mir nicht entgehen.«
Dem Friseurmeister gingen gleich mehrere Lichter auf. »Willy, fegen!«, kommandierte er. »Erwin, putz die Spiegel! Kruuskopp, kämm dich ordentlich!«, und dann flitzte er hinaus durch den Flur, der hinter dem Verkaufsraum begann, in ein Zimmer, das sowohl Küche als auch Aufenthaltsraum für alle war. Jakomina instruierte gerade das Hausmädchen Else, wie es das Gemüse für den Mittagseintopf schneiden sollte.
»Minchen, du hast richtig geträumt mit deinem Platz an der Sonne!« Fritz umarmte sie stürmisch. »Jetzt verstehe ich alles.« Überrascht sah sie ihn an. »Wer hat gesagt: ›Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne‹?«
»Na, unser Reichskanzler natürlich«, antwortete sie.
Das geflügelte Wort kannte jedes Kind. Damit hatte von Bülow schon vor Jahren im Reichstag das zum Ausdruck gebracht, was sich alle Deutschen wünschten – eigene Kolonien in südlichen Gefilden, genau wie Holland, England, Frankreich und wer noch alles auch.
»Richtig, mein Minchen. Und wo liegt die Segelbuhne, von der du geträumt hast?«
»Am Weststrand, vor der Villa Fresena.«
Woraus lief das alles hinaus? Weshalb war ihr Mann so aufgedreht?
»Wer wohnt dort?«
»Na, der Reichskanzler!«
Was sollte die Fragerei?
»Siehst du. Jetzt die Preisfrage: Wer wird wohl gleich auf dem Barbierstuhl von Meister Fisser die Haare geschnitten bekommen?«
Ein triumphierender Blick aus seinen blauen Augen machte ihr schlagartig klar, was bevorstand.
»Doch nicht er persönlich?«
»Jawoll.« Stolz zwirbelte Fritz seine Bartenden in die Höhe. Er hatte schon einigen Berühmtheiten den Kopf gewaschen, aber das wäre die Krönung. »Nun eile, liebe Frau, bereite Tee und Kaffee zu, hol frische Kittel. Wir wollen uns nicht blamieren.«