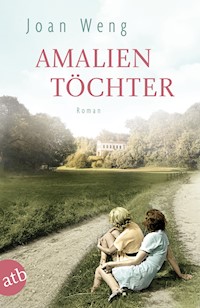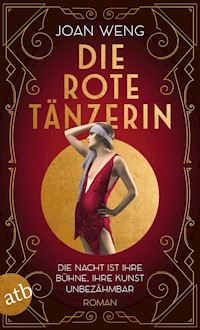8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Weil die Liebe uns gehört!
Berlin, 1925: Als Vicky von ihrem Mann verlassen wird, denkt sie gar nicht daran, sich einen neuen Gatten und Ernährer zu suchen. Stattdessen erfüllt sie sich lieber einen Traum und eröffnet gemeinsam mit ihrer besten Freundin eine Buchhandlung - nur für Frauen. Der kleine Laden am Savignyplatz sorgt von Anfang an für Aufsehen. Schon bald werden sie zu Ikonen der aufkeimenden Emanzipation, aber auch Ziel konservativer Anfeindungen. Doch dann wirft Vicky plötzlich alle guten Vorsätze über Bord und das ausgerechnet wegen eines Mannes ...
„Joan Weng weckt das Berlin der Goldenen Zwanziger mit seinem Glamour zu neuem Leben.“ Stuttgarter Zeitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Joan Weng
Joan Weng, geboren 1984, studierte Germanistik und Geschichte und promoviert über die Literatur der Weimarer Republik. Bisher erschien Das Café; unter den Linden bei atb, sowie zwei Krimis, die ebenfalls im Berlin der Zwanziger Jahre spielen: Feine Leute und Noble Gesellschaft.
Informationen zum Buch
Weil die Liebe uns gehört!
Berlin, 1925: Als Vicky von ihrem Mann verlassen wird, denkt sie gar nicht daran, sich einen neuen Gatten und Ernährer zu suchen. Stattdessen erfüllt sie sich lieber einen Traum und eröffnet gemeinsam mit ihrer besten Freundin eine Buchhandlung. Und zwar nur für Frauen. Der kleine Laden am Savignyplatz sorgt von Anfang an für Aufsehen. Schon bald werden sie zu Ikonen der aufkeimenden Emanzipation, aber auch Ziel konservativer Anfeindungen. Doch dann wirft Vicky plötzlich alle guten Vorsätze über Bord und das ausgerechnet wegen eines Mannes …
»Joan Weng weckt das Berlin der Goldenen Zwanziger mit seinem Glamour zu neuem Leben.« Stuttgarter Zeitung
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Joan Weng
Die FrauenvomSavignyplatz
Roman
Inhaltsübersicht
Über Joan Weng
Informationen zum Buch
Newsletter
Berlin – Frühling 1916
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Herbst 1925
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Mai 1926
Epilog
Glossar
Nachwort
Danksagung
Impressum
Für Margit, ohne die es dieses Buch nicht gäbe,
und
für Bambi und Peter, die wissen warum
BerlinFrühling 1916
1. Kapitel
»Ungemachte Betten sind aller Laster Anfang! Wie oft soll ich es dir noch sagen? Bei schlampig gemachten Betten fängt es an, und ich darf mir gar nicht vorstellen, wo es endet!« Einen Moment unterbrach Vickys Mutter ihren Monolog. Einerseits, um in Gedanken an das schmachvolle Ende ihrer Tochter zu schaudern, andererseits, um für das große Finale ihrer Strafpredigt noch einmal Luft zu schöpfen: »Ich sterbe vor Scham, wenn ich mir ausmale, was der Herr Tucherbe Ebert von mir denkt, wenn er im Juni so ein kleines Lotterflittchen zur Frau bekommt. Denn auf wen fällt die mangelnde Erziehung am Ende zurück? Auf wen werfen Falten auf dem Bettzeug am Ende ein schlechtes Licht?«
»Auf die Frau Mama, Frau Mama«, entgegnete Vicky betont gehorsam. Um des lieben Friedens willen verkniff sie sich auch den Hinweis, dass Tucherbe entgegen der Meinung ihrer Mutter gemeinhin kaum als fester Namensbestandteil galt und die Familie Ebert des Weiteren Strümpfe herstellte. Vermutlich aus Seide oder Wolle, aber ganz sicher nicht aus Tuch. Und weil ihre Mutter mit einem gefallenen und zwei weiteren Söhnen an der Front genug Kummer hatte, ergänzte sie mit dem gesenkten Blick einer braven Tochter: »Es tut mir leid.«
»Das will ich dir auch geraten haben. Mit siebzehn Jahren kann man von einem Mädchen ja wohl durchaus etwas Anstand und Sitte erwarten. Als ich in deinem Alter war, da war ich schon Frau Metzgermeister Greiff, da hatte ich schon Otto, Gott habe ihn selig, und mit Peter war ich in anderen Umständen. Dein Herr Papa hätte wenig Nachsicht gehabt, wenn ich derartige Saumseligkeiten an den Tag gelegt hätte.« Sie seufzte und musterte den Verkaufsraum der Metzgerei Greiff & Söhne. Pieksauber und das Glas vor der kriegsbedingt sehr leeren Auslage spiegelblank. »So! Fertig.«, stieß sie hervor und wrang den Wischlumpen aus, was Vicky als Zeichen nahm, mit ihrem nachlässigen Wienern der Registrierkasse aufzuhören.
»Ach, der Herr Tucherbe Ebert ist so ein feiner Herr!«, hauchte ihre Mutter jetzt, und Vicky nickte stumm. Ihre Gedanken waren bei ihrem gefallenen Bruder. Auch von Bambi und Peter, ihren anderen Brüdern, hatten sie schon lange keine Post mehr bekommen. Vicky seufzte, sie durfte der Mutter wirklich nicht noch zusätzlichen Kummer bereiten, indem sie sich so abschätzig über den von den Eltern sorgsam ausgewählten Verlobten äußerte.
Dabei wäre ihr durchaus manches eingefallen. Es begann bei Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass sie kaum wusste, wie der Herr Ebert aussah, ihn aber als eher klein und blässlich-blond in Erinnerung hatte. Still und sehr höflich war er gewesen.
Vicky, aufgewachsen zwischen den groben Scherzen wandschrankbreiter Metzgergesellen, war bei ihren drei Brüdern früh zur lachenden Komplizin ungezählter Weibergeschichten geworden – leichtfertige, herrlich verwegene Abenteuer, die im gleißenden Gegensatz zu Eberts langweiliger Höflichkeit standen. Nach Meinung von Vickys Eltern hing der Gedeih einer Ehe jedoch kaum von derart kleinlichen Geschmacksfragen ab, da zählten ganz andere Dinge, Sockenfabriken nämlich!
Jetzt war es an Vicky, zu seufzen. Man hatte ihr beigebracht, dass die Liebe mit der Zeit kommen würde, und sie wollte es ja auch glauben, aber trotzdem … heftig schlug sie das Metallgitter vor der Eingangstür zurück, blinzelte einen Moment in das grelle Frühmorgenlicht und nuschelte dann: »Ich finde aber wirklich, er hätte mich zuerst selbst fragen sollen. Es alles mit Papa zu besprechen, war nicht eben romantisch.«
»Romantisch? Ach, Gusta!« Da war er wieder, der verhasste, altmodische Name, auf den ihre Eltern sie hatten taufen lassen. Und als wäre einmal nicht schlimm genug, wiederholte ihre Mutter: »Gusta, wirklich, du bist doch kein Kind mehr.« Sie gab ihr einen flüchtigen Kuss auf den blonden Scheitel und schnipste ein unsichtbares Staubflöckchen von Vickys frisch gestärkter weißer Überschürze. »Hübsch bist du, nur sollte ich dich nicht so viele von diesen albernen Romanen lesen lassen. Dein Herr Papa ermahnt mich deswegen oft genug, davon bekomme ein Mädchen wirre Vorstellungen vom Leben. Aber jetzt zu den wichtigen Dingen. Wenn die Köchin des Herrn Oberst kommt, dann weißt du, was du zu tun hast?«
Vicky nickte und zeigte mit dem Kinn in Richtung der Luke zum Eiskeller. »Die Rindersteaks.«
»Schsch!«, machte ihre Mutter ärgerlich, dabei waren sie nicht nur allein im Laden, auch die Straße vor dem Schaufenster lag in morgendlicher Verlassenheit. »Ich bin oben. Wenn du Hilfe brauchst, ruf.«
Abermals nickte Vicky. Seit Otto gefallen war, ließ die Mutter sie oft allein im Laden, und wenn Vicky doch einmal um Unterstützung rief, dauerte es lang, bis sie kam – das Korsett hastig geschnürt und die Augen trocken, aber rot verschwollen. Nein, sie durfte der Mutter nicht noch weiteren Kummer bereiten.
Sie lauschte den sich entfernenden Schritten, und erst als die Wohnungstür im ersten Stock ins Schloss gefallen war, entnahm sie den Tiefen ihrer Schürze die aktuelle Ausgabe der Mädchenpost. Da erschien gerade Mamsell Sonnenschein, ein neuer und, wie auf der Titelseite zu lesen war, exklusiv für Die Mädchenpost geschriebener Fortsetzungsroman von Courths-Mahler. Ein seliges Lächeln umspielte Vickys Mundwinkel. Wenn sie Glück hatte, kam den ganzen Morgen kein Kunde.
Fleisch war zwar eigentlich nicht knapp, aber Fleisch, das man regulär in einer Metzgerei erstehen konnte, das war es durchaus. Man munkelte, demnächst würden wie beim Brot Marken eingeführt, doch bis dahin liefen die Geschäfte über das Damenkränzchen ihrer Mutter, die Kegelbrüder ihres Vaters und über die Nachbarschaft.
Vicky verstand wenig von all dem, genau wie sie so erschreckend wenig vom Krieg verstand. Zeitungen durfte sie seit dem Juli vor zwei Jahren überhaupt nicht mehr lesen, derartige Lektüre war nach Meinung des Vaters Gift für ihr zartes Gemüt. Von solcherlei Themen bekämen junge Mädchen Keuchhusten und Fieberkrämpfe, weshalb man auch bei Tisch nicht darüber sprach. Anfangs hatte ihr das Verbot nicht viel ausgemacht, schließlich wurde das Fleisch beim Verkauf in die Zeitung vom Vortag gewickelt, ob sie vom Beginn der Belagerung Antwerpens gestern oder heute erfuhr, war ja im Grunde egal. Leider hatte der Vater sie während des Weihnachtsfriedens beim Lesen erwischt, das hatte Prügel gesetzt, und dann war von irgendwoher ein ganzer Pferdekarren voll Einschlagpapier gekommen: Die Jahrgänge 1890 bis 1895 der Allgemeinen Zeitung der Lüneburger Heide. Das bisschen, was sie nun wusste, hatte sie sich mühsam zusammengetragen: Bei ihren weniger behüteten Freundinnen aufgeschnappt oder es stammte aus den Briefen ihres Lieblingsbruders Bambi. Die Post wurde zensiert, aber eine Sache war ihr trotzdem nur allzu bewusst: dass Bambi große Angst hatte zu sterben. Anders als Peter und Otto lag er an der Ostfront, dort ging es wohl recht beschaulich zu – nicht so wie im Westen.
Vicky hatte es dem nächtlichen Gespräch der Eltern erlauscht, da hatte es gerade eine Schlacht bei? … um? … Verdun gegeben, in der war Otto gestorben und ihr Peter verwundet worden. Der Onkel ihrer Freundin Lisbeth, beide Brüder einer ehemaligen Klassenkameradin und der Ehemann der Köchin waren gefallen. Einer ihrer ehemaligen Metzgergesellen galt als vermisst und ihr Postbote hatte beide Beine verloren. Verdun musste also eine große Schlacht gewesen sein. Sicher wusste Vicky eigentlich nur, dass der Kaiser den Krieg nicht gewollt hatte, Deutschland ihn aber sehr bald schon gewinnen würde, zumindest sagten das vom Vater bis zum Pastor alle, und deshalb würde es vermutlich stimmen. Hoffte sie. Und bevor die zweiflerischen Stimmen in ihrem Kopf zu laut wurden, schlug sie entschlossen Die Mädchenpost auf. Doch sie hatte kaum den ersten Satz gelesen, als das Scheppern der Türglocke einen Kunden ankündigte.
Vicky blickte auf. In der Tür, das Licht im Rücken, stand ein Mann. Seine Schultern füllten den Rahmen fast vollkommen aus, etwas, das sie bisher nur von ihren Brüdern Peter und Otto kannte und sie einen winzigen Moment mit der aberwitzigen Hoffnung erfüllte, Peter sei unerwartet auf Fronturlaub.
»Haben Sie offen?« Die Stimme jedoch war fremd, hatte nicht einmal die wohlvertraute Berliner Färbung.
»Ja, natürlich. Kommen Sie herein«, entgegnete Vicky und ließ die Zeitschrift verstohlen in die Tasche ihrer Schürze gleiten. »Womit kann ich Ihnen helfen?«
Der Mann trat in den Laden und bei jedem Schritt knallten seine schweren Lederstiefel auf dem frisch geputzten Fliesenboden. Er trug einen etwas schmutzigen Zivilmantel, darunter eine Leutnantsuniform, weder Mütze noch Hut. Seine Haare leuchteten karottenrot, und er hatte sich ganz offensichtlich heute nicht rasiert. Vermutlich hatte er auch bisher kein Bett gesehen. Er wirkte eindeutig verkatert.
»Ich möchte etwas kaufen«, erklärte er. Er sprach mit leicht bayrischem Dialekt. »Ein Rindersteak, wenn Sie haben. Notfalls tut’s ein Kotelett.«
»Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Ihnen wäre mit einem Rollmops oder einem sauren Hering besser gedient.« Gegen ihren Willen und gegen die eisernen Gebote ihres Vaters, niemals fremde Herren anzulächeln, musste Vicky grinsen. Der Geruch nach kaltem Rauch, Schnaps und Leder, der dem Mann anhaftete, war ihr von ihrem Bruder Peter wohlvertraut, machte sie plötzlich zur Komplizin des Fremden, so wie sie nach durchzechten Nächten stets Peters Komplizin gewesen war. »Wenn Sie sich in Charlottenburg nicht auskennen, erkläre ich Ihnen gern, wo Sie ein Glas Heringe kaufen können.«
»Nein, ich brauche wirklich ein Steak!«, beharrte der Rothaarige, wobei er den Kopf etwas zu ihr drehte und auf sein rechtes Auge zeigte. Und jetzt sah sie es, der Mann hatte ein Veilchen. »Verstehen Sie?«
Vicky schluckte. Ihr kamen plötzlich die Tränen. Ihre Brüder fehlten ihr so furchtbar. Sie hatte solche Angst, dass sie sterben könnten, sterben würden, wie Otto einfach gestorben, einfach weg war. Ein offizieller Brief und seine Sachen und dann nichts mehr, nie mehr.
Um Peter sorgte sie sich nicht so sehr, Peter hatte sich freiwillig gemeldet, Peter war inzwischen Leutnant, er war dafür gemacht. Aber Bambi nicht! Männer wie er brachten es nicht weiter als zum Gefreiten und Gefreite wie Bambi fielen. Es war eine Sache der Hände. Man brauchte sich nur Bambis Finger ansehen, klein, schmal, mit scharf hervortretenden Gelenken und muschelrosa Nägeln. Mit solchen Händen überlebt man keinen Krieg.
Vicky schluckte abermals und noch einmal und noch einmal. Es half nichts, eigentlich half es ja nie, und sich die nassen Augen mit dem Ärmel wischend, stammelte sie: »Bitte entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie vielmals, Sie erinnern mich nur so furchtbar an jemanden. An jemanden … jemanden, der mir sehr viel bedeutet. Ich weiß gar nicht, warum. Sie sehen ihm nicht einmal ähnlich. Vielleicht, weil Sie ungefähr gleich alt sind? Bitte entschuldigen Sie.«
Abermals verstieß sie gegen das väterliche Gebot. Noch immer weinend, lächelte sie den Fremden an, um Verständnis bittend diesmal, und der Mann beugte sich über den Verkaufstresen, fuhr ihr mit dem Daumen über die feuchten Wangen, wischte die Tränen einfach fort. »Ist schon in Ordnung. Ist doch schon wieder gut. Wo ist er denn stationiert?«
»An der … Ostfront.« Das war irgendwie die Unwahrheit, denn der breite Fremde erinnerte sie an den im Westen stationierten Peter, aber sie konnte ihm ja kaum ihre komplette Familiengeschichte, inklusive ihrer Theorie zu der Verbindung von Sterblichkeit und rosa Nägeln erklären, und so wiederholte sie eilig: »An der Ostfront. Ich weiß, die gilt als sicher, aber ich habe trotzdem solche Angst um ihn. Einmal, da hat er für mich Sonnenblumen geklaut, ich bin vollkommen verrückt nach Sonnenblumen, und als er gerade wieder über den Zaun kletterte, kam der Gartenbesitzer aus dem Haus, und er musste fliehen. Und bei der Flucht ist er gegen eine Litfaßsäule gelaufen und hatte ein blaues Auge und … bitte entschuldigen Sie, das ist für Sie natürlich vollkommen gleichgültig.«
Einige Male holte sie tief Luft, fasste sich und fragte dann mit zittriger Ruhe: »Was wollten Sie noch einmal kaufen?«
»Ein Steak.«
Eigentlich hätte Vicky nun sagen müssen, dass sie aufgrund kriegsbedingter Knappheit leider keine Steaks hatten, sie ihm aber Pferdesalami und Leberwurst empfehlen könne. Ihr Vater hatte sie ausdrücklich angewiesen, die Leberwurst rasch zu verkaufen, die hielt sich schlecht – des großen Anteils an Steckrüben wegen –, doch zu ihrer eigenen Überraschung hörte sie sich sagen: »Dafür muss ich in den Eiskeller. Warten Sie bitte einen Moment.«
Würde die Köchin des Herrn Oberst eben ein Steak zu wenig bekommen und eine Szene machen, würde die Mutter Vicky deswegen eben anbrüllen und der Vater sie dafür vertrimmen, seltsam egal war ihr all das plötzlich. Da, wo der Daumen des Rothaarigen ihr über die Wange gefahren war, fühlte die Haut sich noch immer wärmer an.
»Das geht aufs Haus.« Vicky schüttelte den Kopf, als der Mann seine Geldbörse zückte. Inzwischen fast schon gewohnheitsmäßig gegen die väterliche Anordnung verstoßend, reichte sie ihm lächelnd sein in die Geburtsanzeigen der Lüneburger Heide geschlagenes Stück Fleisch. »Sie wissen doch: Ohne Brot kein Sieg.«
»Danke.« Etwas umständlich begann er, das Paket in einer Innentasche seines Mantels zu verstauen. »Vielen Dank, das ist sehr großzügig.«
Er wandte sich zum Gehen, doch in der bereits geöffneten Tür drehte er sich ruckartig um: »Bitte sehen Sie mir die Frechheit nach, Sie haben ja selbst gemerkt, ich bin noch halb betrunken, aber ich muss es Ihnen einfach sagen: Ich beneide Ihren Mann. Oder Ihren Verlobten. Ich gäbe den Blauen Max, den ich nicht habe, und das Eiserne Kreuz, das ich auch nicht habe, darum, an seiner Stelle zu sein. Ich bin sicher, wenn er weiß, dass Sie zu Hause auf ihn warten, wird er sehr vorsichtig sein. Ihm wird nichts passieren.«
»Wie bitte?« Verwirrt starrte Vicky ihn an. Wovon sprach er? Herr Ebert war doch sowieso die Vorsicht in Person, außerdem hatte er dank bester Beziehungen einen wunderschönen Druckposten bei einer Feldpostsammelstelle. Der lief höchstens Gefahr, sich an einem Blatt Papier zu schneiden. »Wovon reden Sie denn bloß?«
»Ich wäre gern der Mann, wegen dem Sie geweint haben«, erklärte der Rothaarige und auch er klang nun reichlich durcheinander.
»Aber wieso?«, stammelte Vicky. Sie tat sich ein wenig schwer mit der Konzentration, solange sie dieser Leutnant aus seinem einem gesunden Auge ansah. »Warum, um alles in der Welt, wollen Sie mein Bruder sein?«
»Ihr Herr Bruder?« Plötzlich lachte der junge Soldat, breit, laut und sehr erleichtert. »Also, da haben Sie recht. Ihr Bruder möchte ich wirklich nicht sein, nicht für alles Geld der Welt. Aber heute Abend mit Ihnen spazieren gehen, das möchte ich. Ich bitte Sie, gehen Sie mit mir spazieren, bis dahin bin ich wieder nüchtern. Sie werden staunen, wie zivilisiert ich sein kann. Ich werde keine dreisten Komplimente mehr machen und mich ganz tadellos betragen. Geben Sie mir eine Chance. Ich bitte Sie!«
Sie schwieg.
Im Gegensatz zu allen Rothaarigen, die Vicky kannte, hatte er keine blauen oder grünen, sondern braune Augen. Sie hatte noch nie einen Rothaarigen mit braunen Augen gesehen. Darüber dachte sie nach und darüber, dass sie mit dem Herrn Ebert verlobt war, zumindest aus Sicht der Eltern und vermutlich auch aus Sicht des Herrn Ebert. Die Mädchenpost in ihrer Schürzentasche knetend befand sie, dass man den Eltern keinen Kummer machen durfte und hübsche, verkaterte Leutnants mit Veilchen und ohne Tapferkeitsorden waren genau die Sorte Männer, die einem am Ende Kummer bereiteten. Ganz sicher waren solche Männer kein Umgang für eine Augusta Greiff, wohlanständige Tochter des Metzgermeisters Greiff, treusorgende Verlobte des Strumpffabrikerben Ebert.
»Ich kann nicht mit Ihnen flanieren. Es tut mir leid.«
Er nickte, sehr beherrscht. »Natürlich. Das verstehe ich.«
Er hatte wirklich die hübschesten braunen Augen, die sie je gesehen hatte, selbst jetzt, wo das rechte halb verschwollen war. Vielleicht waren Männer mit so hübschen Augen und so breiten Schultern aber ja Umgang für Mädchen, die sich Vicky nannten und Einschlagzeitungen lasen? Mädchen, die nachts bei weit geöffnetem Fenster rauchten und sich mit der Pinzette heimlich die Haare von den Beinen zupften? Mädchen, denen es beim Tischgebet manchmal vor Sehnsucht nach Leben den Hals zudrückte?
Sie lauschte, im ersten Stock war die Tür aufgegangen, weshalb Vicky leise zischte: »Um halb sieben vor der Bäckerei Frech, kommen Sie erst raus, wenn Sie mich sehen. Sprechen Sie mich nicht an. Ich gehe voraus, Sie folgen mir mit Abstand auf der anderen Straßenseite.« Und laut sagte sie: »Wenn Sie keine Leberwurst kaufen möchten, muss ich Sie leider wirklich bitten, zu gehen. Auf Wiedersehen.«
***
»Machen Sie das öfter?«, fragte der Mann, wobei er hinter ihr in Lisbeths Zimmer trat. Lisbeth war nicht nur schlechter Umgang und Vickys allerbeste Freundin, sie war seit der Einberufung des Gesellen auch Besitzerin eines eigenen, winzigen Zimmers über der Bäckerei Frech. Eine Dachstube mit abschließbarer Tür, Ofen und Fenster.
»Ich meine, dass Sie sich hier mit Männern treffen? Auf diese geheimniskrämerische Art, mit zweimal vor ihm her um den Block laufen und dann durch den Hintereingang rein?«
Sein Tonfall war gleichermaßen bewundernd wie überrascht, vielleicht auch ein wenig vorwurfsvoll, und da Vicky keine Ahnung hatte, was für eine Antwort er erwartete, blieb sie bei der Wahrheit: »Nein, ich habe das noch nie gemacht. Es ist auch gar nicht mein Zimmer. Meine Freundin Lisbeth ist mit dem Besitzer verlobt, also nicht wirklich offiziell verlobt, aber er hat ihr die Schlüssel gelassen, als er eingezogen wurde. Lisbeth kennt sich aus.«
»So ist das also«, entgegnete er vage, und sie war sich nicht sicher, ob er ihr glaubte. Einen Moment schwiegen sie beide. Ein wenig außer Atem vom Treppensteigen, ein wenig verlegen, ein wenig ängstlich.
Es war die Stunde der goldenen Fenster, und ein fiebrig erwartungsflirrendes Licht lag über dem jetzt glattrasierten Gesicht des Mannes. Nun erst sah Vicky, wie sommersprossig seine Haut war. Die Sommersprossen nahmen viel von seiner erwachsenen Männlichkeit, stellte sie erleichtert fest.
»Möchten Sie Kaffee?«
»Bohnenkaffee?«
Sie schüttelte den Kopf, stocherte mit dem Schürhaken etwas in der Ofenglut, stellte dann den Wasserkessel auf die Kochplatte. »Aber zumindest mit Karlsbader Kaffeegewürz. Ich esse so katastrofürchterlich gern Sarotti-Schokolade, die gibt es aber auch nicht mehr. Wegen den Engländern und ihrer Seeblockade, oder?«
Er zuckte die Schultern, die Hände in den Hosentaschen stand er unschlüssig inmitten des kleinen Raums, betrachtete abwechselnd das Bücherregal, das lumpige Plüschsofa und den aus einer umgedrehten Holzkiste bestehenden Tisch.
Er schien sich sehr unwohl zu fühlen und plötzlich platzte er heraus: »Ich heiße Wilhelm Genzer, alle sagen Willi, und ich bin Zugführer der zweiten Kompanie, 5. Preußisches Infanteriebataillon. Aber eigentlich bin ich Student. Im dritten Semester Chemie. Hier an der Humboldt. Ursprünglich komme ich aus München. Ich hab auch einen Bruder, Paul. Er ist ein Jahr jünger als ich. Aktuell liegt er im Lazarett, in Heidelberg, hat Granatsplitter gefressen, aber er kommt durch. Paul ist zäh wie Kommissfleisch. Ich bin ganz sicher, dass er durchkommt.« Er nickte einige Male heftig, dann haspelte er weiter: »Ich habe Ihnen eine Sonnenblume kaufen wollen, aber die gibt es um die Jahreszeit nirgends, und dann wollte ich Ihnen eine malen, aber ich kann nicht besonders gut malen, und versuchen Sie mal in einer Garnison Buntstifte oder Kreiden aufzutreiben und außerdem …«
Vicky hob den Wasserkessel vom Herd, bevor er zu pfeifen anfing, goss Wasser über das Kaffeepulver, und während der ganze Raum nach Bucheckern zu duften begann, schüttelte sie ganz langsam den Kopf: »Ist schon in Ordnung. Du musst mir das jetzt gar nicht alles auf einmal erzählen. Wir haben Zeit. Ich darf meiner Freundin Lisbeth bis acht Uhr beim Stopfen helfen und morgen bin ich Verbandsmull schneiden, da sagt Lisbeth, dass ich wegen Kopfschmerzen im Bett bleiben muss.« »Kopfschmerzen?« Er lächelte unfroh. »Ich muss spätestens in neun Tagen wieder an die Front. Ich hab für meinen Hauptmann hier was zu erledigen. Mein Hauptmann ist in Ordnung.«
Wie sehr er ihren Brüdern glich, wenn er das Wort Front aussprach. Leicht zögernd, andächtig, ehrfurchtsvoll, als wäre diese Front etwas Lebendiges, ein schönes, gefährliches Tier.
»Gestern hieß es, von unseren 150 Mann sind nur 32 vom Schanzen zurückgekommen. Gasangriff.« Vorsichtig setzte er sich auf das geblümte Sofa. »Sie wären auch gefallen, wenn ich dabei gewesen wäre, nur …«
»Zucker?«, unterbrach Vicky hastig. Sie wollte das nicht hören. Sie wollte sich nicht vorstellen, dass er einer davon hätte sein können. Sie wollte nicht daran denken, dass er nächste Woche Freitag wieder dorthin musste. Plötzlich wollte sie überhaupt nichts mehr über diesen ganzen verdammten Krieg hören oder wissen. »Sahne?«
»Ich glaube, ich habe seit August vierzehn weder das eine noch das andere gekriegt, also ja. Drei Löffel, bitte.« Er nahm die zerbeulte Emaille-Tasse zwischen beide Hände. Seine Finger waren gleichfalls mit Sommersprossen übersät. »Warum darfst du nicht mit mir spazieren gehen? Warum darf man uns nicht zusammensehen? Ich bin immerhin Leutnant und wenn der Krieg erst vorbei ist, werde ich weiterstudieren und in ein paar Jahren bin ich Doktor. Du darfst nicht denken, dass ich mich ständig prügle oder betrinke oder …«
Wieder schüttelte sie nur stumm den Kopf. Sie wollte ihm nicht sagen, dass für ihre Eltern alle Doktoren Juden waren und dass Studieren für sie nichts bedeutete. Als das Fräulein Lehrerin damals bei ihrem Vater vorsprach, er möge Vicky doch weiter auf dem Lyzeum lassen, sie könne Abitur machen, da hatte der gesagt: »Von Bildung wird man nicht satt, und ich brauch das Mädchen hinter dem Tresen.« Und die Mutter hatte noch ergänzt:
»Vom in der Schule hocken kriegt das Mädchen einen fahlen Teint. Wer soll sie dann heiraten wollen?« Und dabei war es geblieben.
Vielleicht würde sie Willi all das eines Tages erzählen können, sie hoffte es, aber für den Moment beschränkte sie sich auf die Kurzform. »Ich bin verlobt. Ich werde im Juni heiraten. Eine sehr gute Partie, ein sehr feiner Herr. Mietshäuser in Pankow, Wohnung in der Leipziger Straße, all das. Er ist der Sohn eines Freundes meines Vaters. Aber stell dir vor, er ist dreißig!«
Einen Augenblick lang schwiegen sie beide, beide ein wenig verblüfft angesichts der Tatsache, dass man so alt sein konnte, dann sagte Willi: »Ich werde im Juli einundzwanzig.«
»Ich bin letzte Woche siebzehn geworden.«
Wieder schwiegen sie. Von der Straße war Kinderlachen zu hören, und die Blätter des vor dem Haus stehenden Baumes rieben sacht über das Dachfenster. Vicky hätte gern erklärt, dass sie ihren Verlobten nicht heiraten wollte, dass sie es ohnehin nicht getan hätte und nun auch wusste warum. Doch erstens durften Frauen so etwas niemals als erstes sagen und zweitens hatte Lisbeth sie am Nachmittag eindringlich gewarnt. Diese Fronturlauber seien alle böse Weiberhelden, besonders die hübschen, die nahmen mit, was es gab, wusste ja keiner, wie lang er noch lebte. Aber eigentlich war Willi kein Fronturlauber, er erledigte ja etwas Offizielles für seinen Hauptmann. Zählte das dann noch als Urlaub?
»Na dann, alles Gute nachträglich«, riss Willi sie aus ihren Gedanken. Er stellte die Tasse auf den Boden und mit seinen noch von der Hitze der Emaille warmen Händen umfing er Vickys Gesicht. »Vermutlich hörst du das von deinem Verlobten ständig, aber du siehst aus wie eine dieser Käthe-Kruse-Puppen. Man will dich die ganze Zeit nur ansehen.«
»Nein, das hat er nie gesagt.«
Eigentlich hatte Herr Ebert sich Vicky gegenüber bisher noch gar nicht über ihre Erscheinung geäußert. Vermutlich wusste er über ihr Aussehen genauso wenig wie sie über das seine und außerdem sagte der ja sowieso nie was.
»Jetzt schwindelst du. Natürlich hat er das gesagt. Das liegt einfach zu nahe.« Willi lachte. Es klang unsicher. »Du bist ein bemerkenswertes kleines Geschöpf. Du siehst so anständig und kernseifensauber aus, und dann triffst du fremde Männer in Bumskammern und lügst schlimmer als ein hundert Jahre alter Fregattenkapitän. Ich werd nicht schlau aus dir.«
»Wir kennen uns auch noch keine Stunde«, wandte sie ein. Das war die Wahrheit, obwohl es sich anders anfühlte. »Außerdem treffe ich normalerweise keine fremden Männer. Du bist der Erste.«
»Wenigstens etwas, wenn ich schon nicht der Einzige bin …« Ein bitteres Lächeln huschte über Willis Gesicht, dann fragte er unvermittelt: »Welchen Dienstgrad hat dein Verlobter? Wo ist er stationiert?«
»Das ist doch egal.«
»Nein, ist es nicht.« Aus einem gesunden und einem halb zugeschwollenen Auge sah er sie ärgerlich an. »Es interessiert mich eben.«
»Aber er ist vollkommen bedeutungslos für mich. Wirklich.«
»Sicher«, schnappte Willi. »Deshalb gehen wir ja auch gerade vor allen Leuten unter den Linden spazieren. Also?«
»Er ist Feldpostrat, hier in Berlin.« Die Antwort schien die richtige, zumindest ließ die Spannung in Willis Zügen einen Moment nach, und plötzlich zog er Vicky an sich, schlang einen Arm um ihre Taille, legte ihr die andere Hand in den Nacken, küsste sie mit an Verzweiflung grenzender Heftigkeit. Erst als es draußen schon dunkelte, ließ er sie wieder los und erklärte in überraschend zornigem Tonfall: »Ich weiß noch nicht einmal, wie du heißt.«
Wenn Willi schlief, suchte sie in seinen Sommersprossen nach Sternbildern. Er sah dann so jung und friedlich aus, keine Spur mehr von dem männlich, erwachsenen Frontsoldaten. Auch das zerschlagene Auge war in den vergangenen neun Tagen geheilt. Er hatte ihr nicht erzählt, wie es dazu gekommen war, aber sie wusste inzwischen, dass er hochfahrend und hitzköpfig sein konnte. Obwohl er den Krieg verabscheute und selten erwähnte, mochte er es nicht, wenn man schlecht über französische Soldaten oder die Tommys sprach. Er schien dasselbe Mitleid für sie zu empfinden, wie für seine Kameraden und bemerkte einmal kryptisch, keiner käme jemals lebend aus dem Graben. Doch als Vicky nachfragte, hatte er nur die Schultern gezuckt und erklärt, das sei ein halbes Zitat, von Hans von Keller, seinem Hauptmann, der sage manchmal schlaue Sachen. Überhaupt habe er da Glück, von Keller sei ein anständiger Kerl, kein hochnäsiger Schinder, wie man sie gerade unter den Junkergenerälen gern fand. Ein bisschen weich sei er, habe manchmal Probleme mit der Disziplin, tränke auch oft zu viel, aber Willi und die anderen Zugführer wüssten, was sie an ihm hatten und sprängen notfalls für ihn in die Bresche. Im Zivilleben war er Schriftsteller.
Am nächsten Tag hatte Willi ihr dann eine alte Ausgabe des Sturms mitgebracht, hatte ihr daraus einen Artikel seines Vorgesetzten vorgelesen. Es ging um Kunst in Paris und Kunst in Berlin und ob man als Künstler Patriot sein dürfe. Vicky war sich nicht sicher, ob sie den Text wirklich verstand, aber sie mochte die ernsthafte Art, mit der Willi sie nach ihrer Meinung fragte. Und sie mochte, wie er dann für sie beide den Kaffee kochte, damit sie ungestört noch ein bisschen in der Zeitung schmökern konnte. Überhaupt mochte sie sehr vieles an ihm.
Vor ihm hatte es nur einen Freund ihres Bruders gegeben, der ihr mit schwitzigen Händen an den Brüsten herumgefingert und hinterher geweint hatte, weil er nicht in den Krieg wollte. So weit war es allerdings dann gar nicht gekommen, schon im Ausbildungslager war er an Lungenentzündung gestorben, und obwohl Vicky einen grauenhaften Monat lang fürchten musste, von ihm schwanger zu sein, war sie froh gewesen, ihm so immerhin noch eine kleine Freude bereitet zu haben.
Willi stöhnte im Schlaf, und sie fuhr ihm beruhigend über die frisch geschnittenen Haare. Das Licht der Gaslampe warf flackernde Schatten über die weiße Narbe auf seiner Brust.
Als Vicky ihn gefragt hatte, woher sie stammte, hatte er nur gelacht, ein seltenes, fröhliches Lachen, und er hatte ihr ins Ohr geflüstert: »Ich erzähl den Frauen immer, dafür hätte ich beinahe ein Eisernes Kreuz gekriegt, aber du erfährst die Wahrheit. Da hab ich als Kind mit meinem kleinen Bruder eine Mutprobe gemacht und bin bäuchlings den Todeshügel runter. War eine blöde Idee, die Schlittenkufe hat mich halb aufgeschlitzt.« Vicky hatte sich sehr bemüht, kräftig zu kichern, so kräftig, dass er ihre Tränen als Kompliment für die gute Geschichte nehmen würde. Sie wollte nicht, dass er sie für melodramatisch oder albern hielt – vermutlich würden sie sich nie wiedersehen, und überhaupt wusste sie nicht, ob Willi die nächsten Wochen überlebte. Es hieß, die Westfront käme in Bewegung, und sie flennte, weil er als Kind beinahe gestorben war und sie sich dann nicht getroffen hätten.
Sie hatten viel über ihre Kindheit gesprochen, seine in der armseligen Enge eines Münchner Vorortes, ihre in der wohlanständigen Enge Charlottenburgs. Über ihre Geschwister hatten sie gesprochen, seinen Bruder Paul, der vielleicht durchkam, vielleicht aber auch nicht, ihren Bruder Otto, der gefallen war, ihre Brüder Bambi und Peter, die am Leben waren, noch. Und über Bücher hatten sie diskutiert, Willi liebte Schnitzler und Mann, Heinrich, nicht Thomas, den er für einen überbewerteten Schwätzer hielt. Für Vickys Lieblingsautorinnen Marlitt und Courths-Mahler hatte er nur gutmütigen Spott übrig, aber wenn sie ihm vorlas, seinen Kopf an ihrer Schulter, die Beine eng verknotet, dann wollte er doch immer wissen, wie es weiterging.
»Vielleicht könntest du mir schreiben?« Plötzlich war er wach, sah jedoch an ihr vorbei. Vicky schluckte.
Er wollte, dass sie ihm schrieb.
Er wollte, dass sie ihn nicht vergaß.
Er wollte an sie denken, auch wenn er nicht mehr mit ihr schlafen konnte. Sie war mehr als eine Fronturlauberschickse für ihn. Das Blut in ihren Ohren pochte vor Glück und Aufregung so laut, sie konnte nicht antworten.
Er wollte, dass sie ihm schrieb.
Anscheinend interpretierte er ihr Schweigen falsch, denn er schob rasch hinterher: »Nur wenn es dir keine Mühe macht. Du musst ja so viel arbeiten und dann musst du deinen Brüdern schreiben. Und selbstverständlich auch deinem Herrn Verlobten.«
In den vergangenen neun Tagen hatten sie beide das Thema »Herr Ebert« weitläufig gemieden. Natürlich hatte Vicky ihm von dem Freund ihres Bruders mit den schwitzigen Händen berichtet, und Willi hatte eine längst vergangene unglückliche Liebe erwähnt, eine Christine, die ihm wohl manchmal noch schrieb, was ihn jedoch mehr zu nerven als zu freuen schien.
Einen kurzen Moment schloss Vicky die Augen, presste ihren Kopf fest gegen seine Brust, spürte den Herzschlag an ihrer Wange. Draußen prasselte Regen auf das Glas des Fensters und bei jedem etwas kräftigeren Windstoß klapperte die Scheibe im Rahmen. Trotzdem war es sehr warm in dem winzigen Zimmer, der Ofen glühte und es roch nach brennendem Holz.
»Ich habe Herrn Ebert noch keinen einzigen Brief geschickt. Ich lasse nur meinen Vater Grüße ausrichten. Mehr nicht.«
Sein Brustkorb hob und senkte sich einige Male rasch, dann sagte Willi: »Warum musst du immer lügen? Das ist nicht richtig gegenüber deinem Verlobten. Ich bin vermutlich der Letzte, der das sagen sollte, aber wenn du ihn schon betrügst, dann solltest du ihn nicht auch noch verleumden.«
»Ich kann aber doch nicht behaupten, dass ich ihm schreibe, wenn ich es nicht tue.« Vicky richtete sich auf, sah ihm ins Gesicht, doch er mied ihren Blick. »Wenn ich sage, ich lasse meinen Vater Grüße ausrichten und das war’s, dann war’s das. Ich lüge nicht. Nie.«
»Zuckerkind, du sitzt gerade am Totenbett der Großtante deiner sehr nützlichen Freundin Lisbeth und stehst der alten Dame beim Sterben bei. Du warst bei Hetti zum Flicken und bei einer Maria zur Großwäsche und am Samstagnachmittag, da warst du … ach, ich hab’s vergessen. Ist ja auch egal.« Ohne sie anzusehen, griff er über sie hinweg und suchte mit der Hand nach den Zigaretten. »Ich hab volles Verständnis dafür, dass dir dein Bruder fehlt und du jemanden brauchst, bei dem du dich anlehnen kannst, und dein Verlobter ist eben nicht da, und ich bin gerade geschickt verfügbar gewesen, nur hör auf, ihn zu verleumden.« Er stand auf, suchte seine Hose. »Vergiss, dass ich wegen der Post gefragt hab. Ich krieg schon genug Briefe.«
»Ja, von deiner tollen Christine zum Beispiel«, fauchte Vicky wütend. Vermutlich, weil sie ihren Eltern gegenüber so viel log, hasste sie es katastrofürchterlich, wenn man ihr die Wahrheit nicht glaubte. Aber trotzdem lenkte sie jetzt ein: »Wenn du möchtest, schreib ich dir. Jeden Tag, wenn du das willst? Versteh das doch nicht falsch. Bitte.« Er schüttelte den Kopf, knöpfte schon an seiner Uniformjacke herum.
»Ich verstehe das vollkommen richtig. Du bist doch nicht die Erste, mit der ich mal eben ins Bett gestiegen bin. Soll ich dir was verraten? Wenn du jung bist und noch alle Gliedmaßen hast, dann werfen sich dir die ganzen Schicksen nur so an den Hals!« Er lachte höhnisch. »Und soll ich dir noch was verraten, Zuckerkekschen? An dem Morgen, an dem wir uns kennengelernt haben, da bin ich gerade von einer anderen gekommen. Ich hab mich mit einem Unteroffizier um sie geprügelt und gewonnen. Daher hatte ich das blaue Auge.«
»Willi, ich habe dich niemals angelogen.« Sie bemühte sich um eine ruhige, feste Stimme, doch die Worte kamen zittrig über ihre Lippen: »Mir ist egal, wo du vor unserem ersten Treffen warst.«
»Das ist ja reizend von dir. Aber weißt du was, du bist mir nicht mehr als jede andere blonde Schickse, verstehst du? Es ist mir vollkommen gleichgültig, dass du fürchtest, uns könnte jemand zusammen sehen. Es ist mir egal, dass ich nicht würdig bin, deinen Eltern und ihrer tollen Metzgerei vorgestellt zu werden.« Er lachte traurig auf. »Und weil das so ist, erwarte ich rein gar nichts von dir, kapierst du das? Auch keine Briefe. Es ist mir egal, wenn du dich jetzt gleich hinsetzt und deinem feinen Herrn Verlobten schreibst, wie du in ewiger Treue auf ihn wartest. Aber ich hätte es als nette Geste empfunden, wenn du wenigstens ehrlich zu mir gewesen wärst.«
»Verdammt noch mal, ich bin ehrlich!« Jetzt war es vorbei mit der ruhigen, beherrschten Stimme. »Ja, ich habe meine Eltern angelogen, in Ordnung. Ja, ich hab Ausreden erfunden, aber nur, um dich sehen zu können. Und ja, ich wollte dich sehen, obwohl du im Zivilleben Fürsorgestipendiat bist und nicht weißt, wovon die Zimmermiete zahlen.«
»Dankeschön! Das war aber gnädig von dir. Wie kann ich das nur jemals wieder gut machen?«
Er stand bereits in der Tür, bereits in Uniform und mit Gepäck. »Hab noch ein schönes Leben, und wenn dein Verlobter es nicht bringt und ich diesen verschissenen Krieg zufällig überleben sollte, du weißt ja, an wen du dich wenden kannst. Du findest mich dann wieder im Studentenverzeichnis der Humboldt, als Fürsorgestipendiat. Aber halt dich ran, wenn ich erst Doktor bin, hab ich vermutlich keine Lust mehr auf so eine zweitklassige Schlachterbraut.«
»Für wen oder was hältst du dich eigentlich?«, fauchte Vicky. »Und wo willst du überhaupt hin? Es ist mitten in der Nacht, es schüttet, und dein Zug fährt erst in sechs Stunden.«
»Ich will an die frische Luft. Und vor allem will ich dich nicht mehr sehen. Ich hab genug von deinen Ausflüchten. Lebwohl!«
Und ehe sie wirklich begriff, was eigentlich gerade passierte, polterten seine Schritte über die Treppe, knallte im Erdgeschoss die Tür. Sie fasste sich ins Gesicht, doch sie konnte nicht einmal weinen.
2. Kapitel
Als sich Vicky während des Absteckens auf den strahlendweißen Saum ihres Brautkleids übergab, seufzte Lisbeth: »Also ehrlich, Vic.« Sie klang etwas undeutlich, denn sie hatte den Mund voll mit Stecknadeln. »Du hast jetzt genau drei Möglichkeiten.«
»Riechst du das denn nicht?«, fragte Vicky, fuhr sich mit einem Handtuch über den Mund und nahm einen Schluck direkt aus dem Waschkrug. »Diesen widerlichen Gestank! Da brät doch irgendjemand Zwiebeln.«
»Also Möglichkeit eins, du wartest, bis deine Eltern dahinterkommen und sich des Problems annehmen. Du weißt, es gibt da Wege?«
»Lissi, es ist alles in Ordnung. Das mit Willi hängt mir noch in den Knochen. Wie kann einer, der so nett ist, gleichzeitig so ein Widerling sein. Hast du was dagegen, dass ich das Fenster zumache?« Ohne eine Antwort abzuwarten, schloss sie es. »Ich glaube, dieser katastrofürchterliche Geruch kommt von draußen. Dass dir das nichts ausmacht? Na, du kennst mich, mir schlägt immer alles auf den Magen. Hab ich dir erzählt, dass er mich eine Lügnerin genannt hat?«
»Ja, hast du, schon mehrfach.« Lisbeth machte einen etwas genervten Eindruck. »Und das war sicher nicht freundlich von ihm, aber als besonders wahrheitsliebend kann man dich nun wirklich nicht bezeichnen. Ich meine, meine arme Großtante aufs Totenbett zu verfrachten, nur damit du eine Ausrede hast, über Nacht wegzubleiben? Jetzt schau mich nicht so an. Ich hab ja Verständnis für dich, deine Eltern sind wirklich eine Plage. Nur Willi kennt die eben nicht, der weiß nicht, dass man mit denen anders nicht umgehen kann. Und außerdem, Vicky-Schatz, es tut mir leid, dir das so ins Gesicht sagen zu müssen, du bist ein furchtbarer Dickkopf und hitzköpfig bist du obendrein.«
»Stimmt doch gar nicht!«, brauste Vicky auf und musste dann über sich selbst lachen. »Na ja, vielleicht ein kleines bisschen.«
»Courths-Mahler würde es mit eine leidenschaftliche Natur umschreiben«, kicherte die Freundin. »Soll ich dir einen Tee gegen die Übelkeit machen? Kamille vielleicht?«
»Nein!«, zischte Vicky entschieden. »Nein, wirklich nicht nötig.«
»Vic, du kotzt dir jeden Morgen die Seele aus dem Leib und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis deine Eltern dich dabei erwischen und dann bist du das Baby schneller los, als du Ich will nicht sagen kannst.« Lisbeth legte tröstend den Arm um sie, führte sie zu dem geblümten Sofa und setzte sie mit sanftem Druck darauf. »Jetzt beruhig dich mal für fünf Minuten. Wir müssen da ganz logisch ran. Also Möglichkeit eins, du sagst deinen Eltern, was passiert ist. Du kannst ja behaupten, es war einer dieser unsittlichen Übergriffe, von denen man jetzt überall liest. Also, willst du das Baby behalten? Ja oder nein?«
Vicky nickte stumm. Sie konnte immer noch nicht weinen.
»Gut, dann müssen wir schnell handeln. Möglichkeit zwei, du stattest deinem heiß vermissten Verlobten einen Besuch bei der Feldpost ab. Du ziehst dein blaugeblümtes Kleid an, ich mach dir die Steckfrisur von Ostern und du triffst die erforderlichen Maßnahmen, dass er als Vater in Betracht kommt. Manche Kinder kommen eben ein paar Wochen früher. Ein paar Wochen, nicht drei Monate. Denk an das Gerede, dass es bei deinem Bruder Otto gab, weil der für ein Frühchen doch sehr gut entwickelt war.«
Vicky schüttelte den Kopf. Allein der Gedanke daran ließ ihren Magen erneut rebellieren. Wortlos reichte Lisbeth ihr die Waschschüssel und kommentierte trocken: »Also, das sollte dir vor ihm halt nicht passieren. Und wenn doch, dann schiebst du’s auf die Aufregung. Oder auf Ottos Tod. Gibt ja viele Gründe, und Männer sind so blöd.«
»Und die dritte Möglichkeit?«
»Du schreibst dem Vater.«
»Nein, da schneide ich mir vorher die Pulsadern auf. Ich hab dem nichts zu sagen.« Trotzig schüttelte sie den Kopf. »Ich wiederhole zweitklassige Schlachterbraut.«
»Wie du dir immer alles wortwörtlich merken kannst. Das hat mich schon in der Schule beeindruckt«, bekannte Lisbeth und, sich eine Schokolade aus der Bonbonniere nehmend, erklärte sie: »Schade, dass du sie nicht essen willst. Das ist echte Sarotti. Vorkriegsqualität. Muss ein Vermögen gekostet haben.«
»Seine Dreckspralinen hätte er sich sparen können. Ich will von dem gar nichts mehr, weder Pralinen noch Entschuldigungen. Es täte ihm leid? Was tut ihm leid? Ich hoffe stark, er bedauert den Tag seiner Geburt.« Wütend riss sie die schon sehr kleinen Briefschnipsel in noch kleinere. »Dem schreib ich garantiert nicht. Der will doch nur mit seinen Kameraden über mich lachen. Aaahooo, Post von der Schlachterbraut.«
»Vic, er hat Angst gehabt. Bevor sie einrücken, haben sie alle Angst. Besonders die nicht ganz dummen.« Mit nachdenklicher Miene schleckte Lisbeth eine Nuss aus der Nougatummantelung, fasste dann zusammen: »Also Möglichkeit drei. Dann wäre das auch entschieden. Wunderbar, komm lass uns weiter abstecken, sonst werden wir nie fertig. Da, wo du ihn mir durchs Schaufenster bei Frech gezeigt hast, da hat er mir sowieso nicht so gut gefallen. Natürlich, er diskutiert mit dir über Bücher und studiert, aber seien wir ehrlich, jetzt mag er noch männlich breit sein, nur gib dem mal fünf Jahre, dann ist er fett und sein roter Strubbelkopf ist auch flöten. Da nimmst du besser gleich den Ebert, der ist schon klein und kahl.«
»Ich hab keine Ahnung, ob der kahl ist. Ich kann mich an den kaum erinnern, aber wie Lars Hanson wird er kaum ausgesehen haben, sonst hätte ich es mir gemerkt.. Und mit dreißig sind sie doch eigentlich alle kahl.« Angewidert schüttelte sie den Kopf, fragte dann: »Aber was soll ich Willi denn schreiben? Ich kann ja kaum darum bitten, geheiratet zu werden, oder?«
»Nein, aber du bedankst dich für das Konfekt und seinen lieben Brief. Denn das war er, und wenn du noch so die Nase rümpfst. Dann schilderst du ihm deine missliche Lage. Natürlich ohne Möglichkeiten eins und zwei. Du erwähnst nur, wie unglücklich und ratlos und verzweifelt du bist. Er ist Offizier, er wird dir umgehend telegrafieren und einen Antrag machen. Außerdem wartet er doch nur darauf, der hätte doch nicht einen kompletten Monatssold in Konfekt investiert, wenn er nicht verknallt wäre.«
»Genau! Ganz sicher!« Sie seufzte. »Warum soll der gerade mich heiraten? Ich meine, er ist Leutnant und er studiert. Und er kann Kaffee kochen. Findest du nicht auch, er sieht rasend gut aus?«
»Wenn man rote Haare, Bartwuchs und Sommersprossen mag, hat er sicher viel zu bieten.« Lisbeth grinste, nahm die Stecknadeln wieder in den Mund und, an Vickys Rocksaum zur Tat schreitend, nuschelte sie: »Und wenn’s mit deinem Rotschopf nicht klappt, haben drei Mietshäuser in Pankow vermutlich auch ihren Reiz.«
3. Kapitel
An einem drückend heißen Mittwoch im Juni erreichte den in einem Heidelberger Lazarett liegenden Paul Genzer eine Ansichtskarte seines älteren Bruders. Auf der Vorderseite prunkte der Kaiser, komplett mit Morgenröte und schwarz-weiß-roter Fahne, auf der Rückseite stand in Willis unordentlicher, schwer lesbarer Akademikerschrift: Lieber Paul, am 2. Juni habe ich die Metzgerstochter Augusta Greiff geheiratet. Sie ist bildhübsch und das fröhlichste, schlauste Geschöpf, das mir je untergekommen ist. Im Januar werde ich Vater. Ich bete jeden Tag für deine Genesung, hoffe, es nützt.. Beste Grüße, dein überglücklicher Willi
Paul las die Karte zweimal, bis er begriff, was dort stand. Obwohl er den älteren Bruder als Weiberhelden kannte, hatte er stets damit gerechnet, dass dieser eines Tages seine Jugendliebe Christine heiraten würde. Christine, die schöne, kultivierte Professorentochter mit den sanften Augen und dem sinnlichen Mund.
Und nun also das – Augusta Greiff, Metzgerstochter.
Er las die Karte ein weiteres Mal, rechnete nach und dann musste er sich übergeben. Das Übergeben lag an der täglichen Dosis Morphium oder an der Hitze, oder an beidem, zumindest sagte Paul das der herbeigeeilten Krankenschwester.
Herbst 1925
4. Kapitel
»Ich kann das nicht länger.« Willis Stimme klang ruhig und nicht einmal besonders beherrscht. Die Stimme war so normal, dass Vicky sich einen Moment fragte, wovon ihr Mann überhaupt sprach.