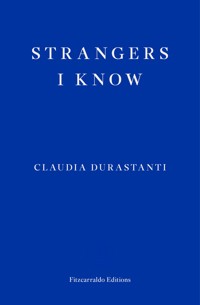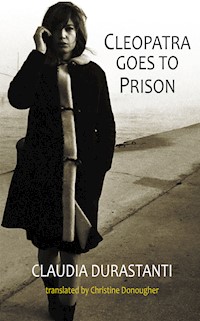Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Claudia Durastantis Roman ist eine Rettungsboje in den dunklen Gewässern der Erinnerung.“ (Ocean Vuong) – Eine außergewöhnliche Familiengeschichte über das Anderssein Claudia Durastanti erzählt in ihrem von der Kritik gefeierten Roman eine ganz besondere Familiengeschichte. Es ist ihre eigene. Beide Eltern sind gehörlos. In den sechziger Jahren sind sie nach New York ausgewandert. Claudia kommt in Brooklyn zur Welt und als kleines Mädchen zurück in ein abgelegenes Dorf in Italien. Mit Büchern bringt sie sich selbst die Sprache bei, die ihr die Eltern nicht geben können. Aus allen Facetten dieses Andersseins hat Claudia Durastanti einen außergewöhnlichen Roman gemacht. Von den euphorischen Geschichten einer wilden italoamerikanischen Familie in den Sechzigern bis ins gegenwärtige London. Dieser Roman lässt einen keine Zeile lang unberührt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Durastanti filtert das Selbst — als Frau, Künstlerin, Tochter — in einem universellen Familiendrama wie in einem Sieb. Ihr Roman ist eine Lichtquelle, eine Rettungsboje in den dunklen Gewässern der Erinnerung, der Imagination und der mutigen Fragen. Dies ist meine liebste Art zu schreiben: nicht nur von der Welt erzählen, sondern lebendig durch sie hindurch graben.« Ocean VuongClaudia Durastanti erzählt in ihrem von der Kritik gefeierten Roman eine ganz besondere Familiengeschichte. Es ist ihre eigene. Beide Eltern sind gehörlos. In den sechziger Jahren sind sie nach New York ausgewandert. Claudia kommt in Brooklyn zur Welt und als kleines Mädchen zurück in ein abgelegenes Dorf in Italien. Mit Büchern bringt sie sich selbst die Sprache bei, die ihr die Eltern nicht geben können. Aus allen Facetten dieses Andersseins hat Claudia Durastanti einen außergewöhnlichen Roman gemacht. Von den euphorischen Geschichten einer wilden italoamerikanischen Familie in den Sechzigern bis ins gegenwärtige London. Dieser Roman lässt einen keine Zeile lang unberührt.
Claudia Durastanti
Die Fremde
Roman
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
Paul Zsolnay Verlag
Inhalt
Familie
Mythologie
Kindheit
Entwicklungsjahre
Jugend
Ehe
Scheidung
Reisen
Amerika
Italien
England
Gesundheit
Das unendliche Zimmer
Zerebrovaskulärer Schaden
Die Sprache der Träume
Wie geht es dir? Bist du müde love your Papa
Okay, I love dich
Lethal attraction
Arbeit & Geld
Ein völlig wertloser Roman
Vorstadtbürgersöhnchen
Große Erwartungen
Freizeit
Liebe
Das Echo eines Mythos
Die Liebe begann, die achtzehn Jahre halten würde, vielleicht auch länger
Liebende haben Vertrauen, aber sie zittern
Bobby oder ein anderer
Hallo, Fremde
Beim nächsten Mal
Welches Sternzeichen bist du
Zwilling
Familie
After great pain,
a formal feeling comes.
Emily Dickinson
Mythologie
Meine Mutter und mein Vater lernten sich an dem Tag kennen, als er versuchte, sich in Trastevere vom Ponte Sisto zu stürzen. Es war eine gute Stelle zum Springen, er konnte zwar ausgezeichnet schwimmen, aber der Aufprall auf dem Wasser hätte ihn gelähmt, und der Tiber war schon damals giftig und grün.
Wenn sie allein war, ging meine Mutter immer mit gesenktem Kopf und hochgezogenen Schultern, als würde es regnen, doch an dem Tag blieb sie auf der Brücke stehen und sah einen jungen Mann rittlings auf der Brüstung sitzen. Sie ging zu ihm, legte eine Hand auf seine Schulter und zog ihn zurück, vielleicht gab es auch ein kurzes Gerangel. Sie brachte ihn dazu, sich zu beruhigen und langsam zu atmen, dann spazierten die beiden durch die Stadt, betranken sich und landeten in einem Hotel mit steifen Bettlaken, die nach Ammoniak rochen. Noch vor Tagesanbruch zog meine Mutter sich an und ging. Sie musste zurück ins Pensionat, und mein Vater war ihr zu nervös erschienen, sie rüttelte nicht einmal an seiner Schulter, um sich zu verabschieden.
Als sie am nächsten Tag mit ihren Freundinnen aus dem Schultor kam, sah sie ihn am Straßenrand stehen, mit verschränkten Armen an ein Auto gelehnt, das ihm nicht gehörte, und in dem Moment begriff sie, dass sie geliefert war. Ich habe sie immer um den mystischen, finsteren Ausdruck beneidet, mit dem sie das erzählt, diese Apokalypse habe ich ihr nie gegönnt.
Damals vor der Schule trug mein Vater enge Jeans, ein hellblaues Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln und rauchte eine Marlboro rot, davon verbrauchte er zwei Päckchen am Tag.
Er war gekommen, um sie von einer staatlichen Schule an der Nomentana abzuholen, und von dem Moment an begann ihr gemeinsames Leben.
»Wie hat er mich bloß gefunden?«, fragte sie. Als ich ein kleines Mädchen war, erzählte sie mir diese Geschichte, darin verwandelte sie meinen Vater in einen geheimnisvollen Zauberer, der uns überall in der Zeit und im Raum abpassen konnte, und ich umarmte sie fest, ohne ein Wort zu sagen, doch insgeheim fragte ich mich, wie es war, von einem Mann auf diese Weise begehrt zu werden.
Dann wurde ich älter und erinnerte sie an das, was nur allzu offensichtlich war. »Für solche wie dich gab es nur eine einzige Schule in Rom, so schwierig war das nicht.« Sie nickte, dann schüttelte sie den Kopf: Nein, er hatte sie gefunden, weil er musste. Obwohl ihre Ehe endete, hat sie nie bereut, dass sie ihn von dieser Brücke weggebracht hatte: Er war taub, sie auch, und ihre Verbindung sollte etwas Intimeres und Tieferes haben als die Liebe.
Mein Vater und meine Mutter lernten sich an dem Tag kennen, als er sie vor einem Überfall vor dem Bahnhof Trastevere rettete.
Er hatte gehalten, um Zigaretten zu kaufen, und wollte gerade wieder ins Auto steigen, als die heftigen, hastigen Bewegungen zweier Übeltäter seine Aufmerksamkeit weckten. Sie traktierten ein Mädchen mit Tritten und versuchten, ihr die Handtasche zu entreißen. Er erschreckte die beiden, bis sie endlich wegliefen, dann blieb er bei meiner Mutter stehen, um sie zu beruhigen, und schlug ihr vor, sich bei ihm zu Hause zu waschen. Damals wohnte er noch bei seinen Eltern, und als sie diese sehr junge Frau, fast noch ein Kind, mit dem dunklen Teint und den von der Dusche feuchten Haaren zum ersten Mal sahen, dachten sie, sie müsse eine Waise sein.
Mit zwanzig hatte meine Mutter ein breites, unmanierliches Lächeln, die Zähne einer Raucherin und glatte, auf die Schultern fallende, schwarze Haare mit dem Schnitt, der keiner Frau steht; manchmal steckte sie ihre Haare mit Spangen aus Schildpatt fest. Sie lebte in einem Pensionat und schlief oft auf der Straße, zur Schule ging sie unregelmäßig. Das Geld, das ihre Eltern aus Amerika schickten, besserte sie mit Gelegenheitsjobs auf, aber sie erschien nicht pünktlich zur Arbeit.
Von dem Tag an gingen die beiden zusammen aus. Sie sprachen die gleiche Sprache aus Röcheln und zu laut ausgestoßenen Worten, doch es war ihr Verhalten, das die Blicke auf der Straße anzog. Sie schubsten die Passanten, ohne sich umzudrehen oder um Entschuldigung zu bitten, und boten ein Bild der Verschiedenheit: Er hatte hellbraune Haare, einen vollen Mund und ebenmäßige Gesichtszüge, sie reichte ihm kaum bis zu den Schultern und sah aus wie direkt dem Stützpunkt einer Guerillatruppe im Dschungel entsprungen.
Vor vielen Jahren konnte mein Vater plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Wenn meine Mutter abreiste, um ihre Familie in Amerika zu besuchen, oder für ein paar Tage verschwand oder auch viel später, als sie sich schon getrennt hatten, ließ er sich oft genau im richtigen Moment am Abflugterminal blicken oder erschien hinter einer Glastür, kam überraschend aus einem Aufzug heraus oder schlug die Autotür laut zu, damit sie wegen der plötzlichen Bewegung die Augen hob.
Sie erkannte ihn an seiner schlaksigen Haltung, am Lichtschimmer der Zigaretten, er stöberte sie auf wie ein verletzter, blutender Jäger die Tiere, wenn ihm keine anderen Sinne mehr helfen und er sich nur noch auf ein wütendes Gespür verlässt. Mein Vater und meine Mutter ließen sich 1990 scheiden. Seither haben sie einander selten gesehen, doch beide lassen die Geschichte damit beginnen, dass sie dem anderen das Leben gerettet haben.
Kindheit
Meine Mutter wurde in den letzten Tagen des Jahres 1956 in einem Gehöft am Fluss Agri in der Basilicata geboren. Während des Winters wohnten meine Großeltern eigentlich im Dorf, nicht in diesem maroden Gebäude, doch sie waren von einem Schneesturm überrascht worden, und so kam meine Mutter umringt von Katzen und magerem Vieh in einem Stall zur Welt. Ihre Eltern arbeiteten auf den Feldern, und sie verbrachte viel Zeit bei ihren Großmüttern. Eine war accidental american wie ich, sie war in Ohio geboren, wo ihr Vater vorübergehend Station gemacht hatte — wir wissen nichts von diesem Nomaden oder Gelegenheitssoldaten, nur dass er eine Reihe leichtsinniger Migrationen auslöste. Sie ging dann mit ihrer Mutter in die Basilicata und verwandelte sich in eine umgekehrte Immigrantin, die die Zukunft aufgab, um sich in der Vergangenheit aufzulösen. (Mit sechs Jahren sollte es mir ebenso ergehen, ich zog von Brooklyn in ein Dorf in der Lucania, wo es mehr Stück Vieh als Menschen gab.) Im Ort wurde diese Großmutter wie eine geheimnisvolle Person behandelt. Sie sprach zwar nie Englisch, besaß aber Dinge mit seltsamen Markennamen, Jeansstoffe, die sich nicht abnutzten, und Kerzen, die sich nicht aufzehrten, auch wenn sie stundenlang brannten. Die andere Großmutter war schweigsam und verletzlich, ihre Welt war geprägt von aschfahlen Erscheinungen am Himmel und Exorzismen, die mit einem auf die Stirn gelegten Silberlöffel vollzogen wurden, sie ging barfuß bei Prozessionen und glaubte fest daran, dass sie einen besonderen Dialog mit der Jungfrau Maria unterhielt.
Als ich klein war, wanderte meine Mutter mit mir am Fluss Agri entlang, an dem sie geboren war, und ich hatte Mühe, ihn mit den mythischen, stürmischen Gewässern zu verbinden, in die man sie mit vier Jahren getaucht hatte. Meine Mutter hatte eine Hirnhautentzündung mit hohem Fieber, und als ihre Eltern das Fieber bemerkten, beeilten sie sich, das Mädchen im Fluss zu baden, damit das Fieber sank, doch nach Meinung der Ärzte und der Nachbarn hatte dieses impulsive Heilmittel nicht den geringsten Nutzen. Durch die Infektion konnte sie blind, verrückt und taub werden oder sterben, und alle Frauen, die an dem Bettchen, in dem sie festgebunden und erloschen lag, über ihr Leben wachten und beteten, stimmten für die Taubheit. Sie würde es nicht leicht haben, aber wenigstens würde sie die Welt sehen und einen Weg finden, sich verständlich zu machen.
Mein Großvater Vincenzo war klein, dunkel und ein Weiberheld. Als er und meine Großmutter Maria in den sechziger Jahren nach Amerika auswanderten, taten sie das nicht, weil sie arm waren — sie waren arm — oder weil sie eine bessere Arbeit brauchten, sondern weil er den Frauen des Dorfes zu galant begegnete und meine Großmutter darunter litt. Er spielte Ziehharmonika auf Hochzeiten und Festen, trug dunkle Hosen und bis zu den Ellenbogen aufgekrempelte Hemden und hatte kein einziges weißes Haar in seinem mit Gelatine zurückgestriegelten Schopf. Es war eine arrangierte Verlobung gewesen, sie waren Cousin und Cousine ersten Grades, und hörte man auf das Geschwätz und den Tratsch der Dorfbewohner, konnte man glauben, meine Onkel und Tanten wären wegen dieser unheilvollen Blutsverbindung kleinwüchsig geboren und meine Mutter deswegen ertaubt. Meine Großeltern hatten die Gesetze der Distanz gebrochen und waren dafür bestraft worden; tatsächlich aber verlor meine Mutter ihr Gehör durch eine Infektionskrankheit, und meine Onkel und Tanten waren klein wie viele junge Leute damals in Süditalien. Adelige und Vampire paarten sich untereinander, um die Spezies zu erhalten, einigen unzuverlässigen Anthropologen zufolge war das auch bei manchen afrikanischen Stämmen Usus, um Bannflüche abzuwenden, doch in Wirklichkeit gab es genaue Regeln, um ein Übermaß an Blutsverwandtschaft zwischen Liebenden zu verhindern; manchmal war es sogar unmöglich, sich mit einem Jungen zu verloben, der das gleiche Totemtier hatte, und wer weiß, ob das Zusammentreffen unverträglicher Geister und Totems wirklich für die gescheiterten Liebesbeziehungen in meiner Familie verantwortlich war.
Meine Großmutter war eine Ehefrau wie aus einem Bauernroman, sanft, wo er leicht entflammbar war, zielstrebig, wenn er sich ausweichend verhielt. Sie hatte helle Haut und einen breiten, schmalen Mund. Als junges Mädchen hatte sie sich einen Jungen ausgesucht, schüchtern wie sie, doch mein Großvater war der, den alle wollten — sie hatte keine Wahl. Auf den Neid der anderen zu verzichten, ist das wahre Tabu in einem kleinen Dorf. Wenn jemand etwas Böses sagte, schüttelte sie den Kopf oder legte dem Unglückseligen die Hand auf den Mund, sie wurde nicht oft wütend. Sie wusste nicht, wie sie ihre Tochter verteidigen sollte, wenn die Leute sie »die Stumme« nannten oder ihr sagten, das Mädchen sei ein armes Ding, auf das Gott besser aufpassen sollte.
Doch meine Mutter verteidigte sich selbst und hatte keine Nachsicht mit denen, die sie nicht verstanden, wenn sie sprach. Mit vier schüttete sie einen Topf kochendes Wasser über einer Nachbarin aus, die schlecht über sie geredet hatte, sie hatte es an der Gestik und den mitleidigen Blicken der Frau erkannt. Und sie war lachend am Fenster stehen geblieben, was ihr bei der Familie heimliche Anerkennung eintrug.
Sie kam nur mit ihren Brüdern und mit den Großmüttern aus, die mit verkniffenem Mund im Dialekt redeten, unmöglich, ihnen von den Lippen abzulesen, aber sie hatten eine natürliche Veranlagung zur Gestik und berührten meine Mutter immer, so wie sie mich immer berührt hat. Ihre Brüder glaubten nicht, dass sie wirklich taub war, und wenn sie Versteck spielten, laut abzählten und meine Mutter auf den Sträßchen des Dorfes sich selbst überließen, taten sie das nicht, um sie auszuschließen, sondern weil sie darauf vertrauten, dass sie sich allein orientieren konnte. Für ihre Brüder war meine Mutter kein Opfer und nie etwas Besonderes. Noch heute, nachdem meine Onkel sehr unterschiedliche Leben gelebt und ihr Italienisch in sechzig Jahren Amerika fast verlernt haben, sprechen sie mit ihr, als könnte sie hören, die Geschwister führen diese komischen, asynchronen Gespräche, die typisch sind für auseinandergesprengte Familien.
Als Kind war sie lebhaft und widerspenstig, und um ihr Disziplin beizubringen, beschlossen die Eltern, sie bei den Nonnen in Potenza aufs Internat zu schicken. Die Lehrerinnen erkannten sie an ihrem blendenden Lächeln; wenn sie keine Schuluniform hatte, trug sie gestreifte Pullover, und selten ließ sie sich mit einer Puppe in der Hand blicken.
Auf dem Internat lernte sie durch Folter, sich verständlich zu machen. Wir hatten nie große Küchenmesser im Haus, weil sie meine Mutter an die Schuljahre erinnerten, als die Nonnen der einstigen Klosterschule Suore Maddalena di Canossa ihr ein Messer auf die Zunge legten und sie aufforderten, zu schreien, damit sie lernte, mit ihren Stimmbändern Töne hervorzubringen. Oder sie musste elektrisch geladene Drähte anfassen, und die Nonnen befahlen ihr, noch lauter zu schreien. So hat meine Mutter gelernt, den Klang ihrer Stimme wiederzuerkennen.
Sie konnte besser sprechen als die anderen Mädchen, denn nach der Hirnhautentzündung waren Reste ihres Hörvermögens geblieben, die aber schwächer wurden und dann für immer verschwanden. Anfangs lebte sie also noch nicht in einer Überdruckkammer der Stille, ihre Hörschnecke war unregelmäßig gebrochen, so kamen und gingen die Geräusche, und die Welt war ein Ort gespenstischer Erscheinungen und plötzlicher Heuler. Manchmal versucht sie, mir die panische Angst zu beschreiben, die man als Schwerhörige bei chronischem Kopfschmerz empfindet. Es sei, als stünde jemand hinter ihr, der sie andauernd erschrecken wolle. Als mein Bruder und ich klein waren, erschreckten wir sie wirklich, wir stürzten plötzlich in ein Zimmer, wir sprangen auf ihren Rücken, damit sie den Körperkontakt spürte, und immer hofften wir, sie würde lachen, aber sie reagierte auf unsere Überfälle mit langen Schweigephasen, in denen wir unsere Grausamkeit bereuten, allerdings nicht ernsthaft genug, um damit aufzuhören. Die Möglichkeit, einem Hinterhalt zum Opfer zu fallen, hat ihren Körper unwiderruflich verändert, hat ihr den Rücken gekrümmt und sie unfähig gemacht, anderen Menschen wirklich in die Augen zu schauen.
Im Internat lernte meine Mutter die Gebärdensprache. So verständigte sie sich mit den Nonnen, die ihre Lehrerinnen waren, mit tauben Freundinnen, später mit meinem Vater, obwohl er das Gestikulieren hasste, doch nie mit Menschen, die hören konnten. Nie hat sie ihre Eltern und ihre drei Brüder gebeten, die Gebärdensprache zu lernen, auch ihre Kinder nicht. Warum sie darauf verzichtet hat, anderen ihre private Sprache aufzunötigen, ist mir, die ich lange Zeit Angst hatte, laut zu sprechen, ganz klar: Die Gebärdensprache ist theatralisch und sichtbar, sie setzt dich ständig den Blicken der anderen aus. Sie macht dich sofort zur Behinderten. Wenn du nicht gestikulierst, hält man dich lediglich für ein etwas schüchternes und zerstreutes Mädchen. Meine Mutter, die anderen von den Lippen las, bis sie mit den Augen und Nerven am Ende ihrer Kraft war, die mit hoher, lauter Stimme und falschem Akzenten sprach, erschien dagegen wie eine Migrantin mit Sprachfehler, eine Fremde. Wenn sie in den Bus stieg, und die Fahrer sie manchmal fragten, ob sie Peruanerin oder Rumänin sei, nickte sie nur, ohne weitere Erklärungen abzugeben, der Irrtum schmeichelte ihr fast.
Meine Mutter hat nicht nur das Gehör verloren: auch eine Freundin im Internat, im Wasser.
Die Mädchen waren mit den Nonnen in eine Ferienkolonie gefahren, sie trugen smaragdgrüne Badeanzüge und Leinenhütchen mit einer zur Schleife gebundenen Kordel unter dem Kinn. Eine von ihnen war zu weit hinausgeschwommen, sie konnte nicht schreien und hatte sich so um sich selbst und ins Meer hinunter gedreht.
Es war ein Trauma für alle Schülerinnen, und von dem Moment an wurden die Horrorgeschichten über die Art, wie sie sterben konnten, immer grauenvoller. Diese Mädchen, alle unfreiwillige Tänzerinnen, immerfort erschüttert von innerlichen Regungen und Racheakten, erzählten einander vor dem Einschlafen Geschichten, die den Nachrichten in den Gazetten des 19. Jahrhunderts ähnelten, Artikeln mit Illustrationen von toten, schwangeren Bräuten, die im Sarg gebaren — Tatsachenberichte einer vergangenen Zeit. Von ihrer eigenen Situation erzählte die Geschichte einer Gehörlosen, die sich nicht mitteilen konnte und nach einem vermeintlichen Herzstillstand begraben wurde. Als man den Sarg wieder öffnete, hatte sie sich am Holz das Fleisch von den Fingern gekratzt. Der Tod der ertrunkenen Freundin wurde mir in allen grausamen Einzelheiten erzählt und ist der Grund, warum meine Mutter noch heute Angst hat, allein im Aufzug zu fahren, und ich Angst habe, zu schwimmen.
In den Sommerferien kehrte sie in ihren Heimatort San Martino zurück, bis ihre Eltern nach Amerika auswanderten und sie mit dem ältesten Bruder, auch er im Internat, zurückließen. Meine Großeltern wurden Migranten, sie mussten sich eine andere Sprache erobern, ohne ihre Muttersprache je richtig gesprochen zu haben. Meine Mutter besuchte eine ausgezeichnete Schule, es gab gute Gründe, sie in Italien zu lassen. Trotz ihrer täglichen Rebellionen hatte sie die Nonnen liebgewonnen und war eine gute Schülerin. Ursprünglich wollte meine Großmutter ihre Tochter mitnehmen, doch bei einer Sprechstunde mit den Lehrerinnen wurde sie gefragt: »Willst du wirklich, dass sie nicht mehr sprechen kann und sich in einer fremden Umgebung einsam fühlt? Kann sie nicht später nachkommen?« Und Großmutter brachte kein Wort heraus, belastet von den Sorgen ihrer eigenen Abreise.
Sie gingen weg, als meine Mutter zwölf Jahre alt war, bevor sie abreisten, schenkten sie ihr ein weißes Kleid und Lackschühchen, ungeeignet für ihr Alter. Nach diesem Abschied wurde meine Mutter noch verschlossener und rabiater, doch wenn ich sie frage, ob sie sich je im Stich gelassen gefühlt hat, verneint sie. Ihre Eltern hatten mit knapper Not die Grundschule abgeschlossen. Sie waren heitere, gute Menschen, nicht besonders intelligent, aber zu einer wichtigen Einsicht fähig: Sie würden nicht für immer da sein, sie hätten ihre Tochter nicht in jedem Moment beschützen können. Meine Mutter musste unabhängig werden, und das ist ihr gelungen. Das Leben meines Vaters sollte anders verlaufen.
Die Mutter meines Vaters war ein anmutiges Mädchen, Schneiderin, Tochter einer Frau aus Monteleone di Spoleto und eines Schäfers aus Canale Monterano, der sie beim Weidewechsel kennengelernt hatte. Sie wuchs zusammen mit der Mutter und den Geschwistern in einem kleinen Ort in Umbrien auf, der Familienvater war eine unwichtige Erscheinung, die sich nur im Sommer konkretisierte. Mit den Brüdern verstand sie sich gut, mit den Mädchen gab es Probleme wegen zu großer Nähe und Eifersucht.
Ihrer ältesten Schwester nahm sie den Verlobten weg, er sollte dann mein Großvater werden.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde meine Großmutter Rufina von einer reichen Familie aufgenommen, für die sie Kleidung nähen sollte. Ein deutscher Soldat, der ihr den jüngsten Bruder entführt hatte, weil er ihn für einen Kommunisten hielt, machte ihr den Hof. Meine Großmutter holte sich den Bruder aus einer Sennhütte am Ortsausgang zurück. Er war kein Kommunist, lungerte nur auf der Straße herum. Ich habe nicht das Privileg, Partisanen zu meiner Familie zu zählen, nur Menschen, die sich der Macht mehr oder weniger nachgiebig unterordneten. Als Gegenleistung für den Bruder versprach sie, die Socken und Hemden der Soldaten zu flicken. Eines Tages, der Deutsche hatte ihr einen Korb mit Wäsche zum Waschen gebracht, sagte er laut: »Wenn ich Glück, kommen wieder, die Blonde nehmen.« Meine Großmutter saß in einem anderen Zimmer, den Kopf über den Nähkorb gebeugt, aber sie wurde nicht rot, als sie seine Stimme hörte. Sie hatte kupferblonde Haare, noch heute ärgert sie sich über diese beleidigende Ungenauigkeit. Nonna Rufina hasste die Faschisten und die Kommunisten, aber zu den Deutschen war sie freundlich. Die jungen Nazis wurden herumkommandiert wie alle anderen auch, doch sie waren wenigstens Fremde, es war einfacher, einander zu töten, wenn man sich nicht kannte.
Auch der Fotograf einer anderen Ortschaft machte ihr den Hof, über einen Nachbarn schickte er ihr Briefe, sie öffnete die Umschläge und fand Fotos von Sonnenuntergängen, die ihr unbehaglich waren und sie langweilten, Kunst hat immer ihr Missfallen erregt.
Der Arzt eines Nachbardorfs kam oft zu den Festen im Haus der reichen Leute, die sie als Schneiderin angestellt hatten, und forderte sie zum Tangotanzen auf, aber sie schämte sich. Der Arzt gefiel meiner Großmutter sehr, doch sie wusste, dass sie ungebildet war. Sie las keine Bücher, konnte kaum schreiben. Schön war sie, aber was hätte sie als Frau eines Arztes getan? Sie hätte ihn in Verlegenheit gebracht, darum verlobte sie sich mit dem Hufschmied, dem ehemaligen Freund ihrer ältesten Schwester, und heiratete ihn.
Sie fühlte sich nicht schuldig, weil sie ihrer Schwester den Mann gestohlen hatte, der Krieg war dazwischengekommen, vieles hatte sich verändert. Mein Großvater »wurde aus der Tür geworfen und kam durchs Fenster wieder herein«, denn er hatte begriffen, dass diese junge Frau trotz ihrer ausgefallenen Frisuren und ihrer Eitelkeit eisern sparen konnte und vom Geld besessen war wie er.
Beide hatten eine gute Arbeit, der sie nachgingen, ohne darüber zu sprechen, und als meine Großmutter schwanger wurde, wusste sie nicht einmal, dass die Fruchtblase platzen würde, sie dachte nur an das Nähen mit ihrer Singer, die sie als Sechzehnjährige auf Raten gebraucht gekauft hatte.
Sie hatten drei Kinder. Die älteste Tochter lebt nicht mehr, und der Letzte, mein Vater, wurde taub geboren.
Wanda, die Tante, die ich nie kennengelernt habe, ist schon mit drei Jahren gestorben. An dem Tag hatte meine Großmutter in der Badewanne Stoffe gefärbt, mit kochendem Wasser, damit die Farbe gut eindrang, und sie war zum Herd gegangen oder weil jemand an die Tür geklopft hatte. Dieses Detail ändert sich jedes Mal, wenn sie die Geschichte erzählt. Sie kehrte ins Badezimmer zurück und fand das Kind in der Wanne. Tagelang wechselte sie, unterstützt von Verwandten und Nachbarn, immer wieder den Verband und rieb die runzelige, spinnennetzfeine Haut mit Öl ein; ein paar Tage später war das Mädchen tot. Auf dem Foto in der Grabnische der Familie ist ihre Haut von der damaligen Nachbearbeitungstechnik verändert, sie trägt ein grell himmelblaues Kleid, und ihr Haar ist lockig, sie war schon ein Gespenst.
Nonna Rufina hat wenig Schulbildung und beherrscht ihre Sprache nicht, aber für Farben hat sie besondere Wörter, da vertraut sie einer Begrifflichkeit, die langsam ausstirbt. In ihrer Welt gibt es kein Blau, es gibt das Zuckerhutpapierblau und das Kornblumenblau. Ich besuche sie, und sie zeigt mir Lederhandschuhe oder auf dem Bett ausgebreitete Wollröcke; wenn ich frage, ob ich die »braunen« nehmen darf, sagt sie »Mohrenkopf«, die Farbe Rosa verbessert sie durch Zyklamen, sie unterscheidet Blauviolett vom Vergissmeinnicht, besteht darauf, dass es wichtig ist, die Dinge bei ihrem Namen zu nennen, und ich muss daran denken, dass ihre Tochter von der Farbe getötet wurde.
Sie behauptet, mein Vater sei taub geboren, weil sie sich während der Schwangerschaft erschreckt hat, sie wollte die Straße überqueren, als plötzlich ein Auto hervorgeschossen kam und sie mitten auf der Straße aufschreien ließ. Anfangs tat sie, als wäre es nicht passiert, als könnte der Junge sie hören, und nie wieder sind Mutter und Sohn so vertraut gewesen wie zu jener Zeit, beide unempfänglich für das Offensichtliche. Mein Großvater sprach wenig, also muss es jemand von außen gewesen sein, der in die wattierte Intimität ihrer Gespräche eingedrungen war und meiner Großmutter begreiflich gemacht hatte, dass man einen Arzt aufsuchen musste, weil der Junge nie antwortete. Nach den nutzlosen Untersuchungen in Krankenhäusern begannen die Pilgerfahrten, für Lourdes fehlte meinen Großeltern das Geld, aber mein Vater schaffte es, sich von Padre Pio berühren zu lassen, freilich um am nächsten Tag noch immer taub und ohne Stigmata zu erwachen. Als kleiner Junge war er eher ruhig, bösartig wurde er erst, als sie ihn in ein Internat auf der Nomentana steckten.
Großmutter holte ihn jedes Wochenende ab, dafür ertrug sie mehrere Stunden Busfahrt von Monteleone di Spoleto nach Rom auf kurvigen Straßen durch Nadelwälder, vorbei an Maschendrahtnetzen, in denen der Fels gefangen war, damit es keinen Steinschlag gab. Später beschlossen sie und mein Großvater, nach Rom umzuziehen, um sich diese Wochenendbesuche zu erleichtern. Großmutter war eines der schönsten Mädchen im Ort gewesen, die mit der geraden Haltung, und in ihrem Mutterdasein hatte sie alles falsch gemacht.
In der Stadt wurde sie Hausmeisterin, doch dafür eignete sie sich wirklich nicht, sie putzte die Treppen und verbreitete keine Klatschgeschichten. Ihr Mann beschlug Pferde im Testaccio, einem Ort, an dem das heute nicht mehr geschieht, unter verfallenen Bögen und Werkstätten, wo Rom Leder und Rost war, bevor es im Tiber ertrank.
Entwicklungsjahre
»Du kannst nicht immer die Hauptrolle spielen«, brüllten die Klassenkameradinnen mit Gesten, und während die Lehrerin etwas an der Tafel erklärte, versuchten sie, die Aufmerksamkeit meiner Mutter zu erregen, indem sie gegen ihren Stuhl traten oder ihre Stifte auf den Boden warfen.
Sie hob nicht den Kopf, weigerte sich, zu antworten, doch als auch ihre Zimmergenossinnen hartnäckig fragten, warum sie unbedingt die Hauptfigur beim Krippenspiel oder bei den Aufführungen zum Jahresende spielen wollte, erwiderte sie, das müsse so sein, sie sei die Beste. Dann versuchte sie, die Mädchen abzulenken, indem sie ihnen half, ihre Wollröcke zu kürzen. Während die Internatsschülerinnen über die Flure spazierten, zogen sie an den Fäden des Saums, und jeden Tag schaute ein Zentimeter Haut mehr hervor, zur Vorbereitung auf die Besuche im Jungeninternat, die etwa einmal im Monat stattfanden. Während dieser Zusammentreffen sah meine Mutter meist ihren Bruder Domenico, der schüchtern war und einer, der lieber verzichtete. Sie wollte eine Freundin für ihn finden. »Gehörlose Mädchen sind lustig und freizügig«, sagte sie. Er fürchtete, sie könnten ihr ähneln, und ließ sich nicht darauf ein.
Ihre Klassenkameradinnen waren überzeugt, dass meine Mutter nach dem Abitur Karriere beim Theater machen würde — es ist so naheliegend, dass ein gehörloses Mädchen Schauspielerin wird, ihr ganzes Leben ist eine Performance —, die Lehrerinnen aber wollten sie an der Kunsthochschule sehen. Sie zeichnete gut, füllte ganze Hefte mit kopflosen Körpern und Augen, die aus Gesichtern gerissen waren, doch wenn man ihr Komplimente machte, zuckte sie nur die Achseln: Sie war nicht dumm, es war viel zu leicht, ihr ein Talent zuzuschreiben, nur weil sie nichts anderes hatte.
Das Internat in Potenza konnte die Mädchen nur bis zu einem bestimmten Alter behalten, danach mussten sie in ihre Familien zurückkehren oder an ein anderes Institut wechseln.
Ihre Familie war in Übersee, also musste meine Mutter von einem Pensionat zum nächsten ziehen oder im Haus von Leuten wohnen, die gegen Geld Streuner aufnahmen. Mithilfe eines Anwalts, der ihr Vormund wurde, fand mein Großvater in ganz Süditalien vorübergehende Unterkünfte für sie, er schickte ihr regelmäßig Schecks, und sie telefonierten oft. Immer wenn meine Mutter den Hass auf ihre Schulkameradinnen in sich aufsteigen fühlte oder ein Mann nachts in ihr Zimmer kam, weil er sich sicher war, dass sie nicht schreien konnte, lief sie zu einer Telefonzelle und bat die Dame im Fernsprechamt um ein R-Gespräch, dann wartete sie auf den regelmäßigen, langen Klingelton, der die Verbindung mit Amerika anzeigte. Das war der einzige Ton, den sie wirklich verstand, der sich in konzentrischen Kreisen und Vibrationen in ihrem Ohr ausbreitete, bis er in ihrem ganzen Körper zersprang, wenn er sich in die Vaterstimme verwandelte. Sie erzählte ihm, wie sie ihre Tage verbrachte, ohne seine Antworten zu hören oder zu verstehen, aber sie konnte eine Strömung in der Telefonleitung auffangen, die ihr die Gewissheit gab, dass der Vater zuhörte, was auch immer sie sagte.
Manchmal bezahlte er ihr ein Flugticket nach New York, sie trafen sich in der Ankunftshalle des JFK-Airports, und beim Anblick dieser intelligenten, wilden Tochter, die immer weiblicher wurde, zuckte mein Großvater zusammen, doch er schimpfte mit ihr, weil sie zu viele ordinäre Wörter gebrauchte. Im Sommer ihres vierzehnten Lebensjahrs brachte er sie in eine Arztpraxis in Manhattan, in der Hand die Kopie einer Zeitschriftenanzeige mit der Werbung für einen chirurgischen Eingriff, bei dem Hörgeräte in die Ohren gepflanzt wurden, die dem Patienten das Hörvermögen zurückgaben. Der Arzt sprach lange mit meiner Mutter, dann sagte er, bei ihr sei nichts zu machen; im Flur versetzte Großvater ihm einen Faustschlag. Danach gingen sie nach Soho, um ihr einen Wintermantel zu kaufen, sie wollte einen »Eskimo« mit pelzgesäumter Kapuze. Meine Mutter nannte es So-hò. Auf das Foto von der Freiheitsstatue, das sie während eines Familienausflugs machten, hat einer der beiden »Niù-Iore« geschrieben.
In Amerika trug sie Shorts, die ihre dunklen, muskulösen Oberschenkel zeigten; die Nachbarn fragten, warum sie Narben auf dem linken Bein hatte. Es war passiert, als sie sich in die Flammen gestürzt hatte, weil die Kätzchen einer ihrer Gastfamilien in den Kamin gekrochen waren und niemand sie hatte retten wollen.
Ihr Vater brachte sie nach Coney Island und blieb vollständig angezogen am Wasserrand stehen, um die Sprünge seiner noch nicht zu Amerikanern gewordenen und schon versprengten Kinder zu beobachten und aufzupassen, dass sie sich an den algenverkrusteten Landungsbrücken nicht den Schädel brachen. Großmutter Maria kniete derweil auf einem Baumwolltuch und verteilte Kaffee in Plastikbechern. Sie lachte, als die Nachbarn, die vor kurzem ihren Namen geändert hatten — sie waren jetzt alle zu Mike oder Joe oder Tony geworden und dachten ungern an ihr früheres Leben in Italien zurück —, ihr sagten, dass sie es nicht erwarten konnten, sie endlich einmal im Badeanzug zu sehen. Aber sie zog sich nie aus, auch mein Großvater nicht, der in Hemd und Hose dastand, die Augen aufs Wasser geheftet.
Er dachte an den jüngsten Sohn, der ihn um Geld gebeten hatte, weil er sich eine Gitarre kaufen wollte, an den Ältesten, der wenig sprach und Zigaretten rauchte, obwohl er gar nicht richtig inhalieren konnte; an den schönsten Sohn, der immer riskierte, von der Schule verwiesen zu werden oder die Mädchen seines Viertel zu schwängern, und dann an diese Tochter, die vernarbte Kratzer an den Beinen hatte, und der er nur Kleider schenken konnte, damit sie an den italienischen Schulen eine gute Figur machte, doch er hegte den Verdacht, dass sie selten zum Unterricht ging, obwohl sie immer gute Zeugnisse vorzeigen konnte.
Für meine Mutter bedeutete Coney Island das Ende des Sommers, die Jungen, die sie verstohlen beobachteten, wenn sie ihre Haare auswrang und schlammige Pfützen im Sand hinterließ, erschraken über ihre hemmungslosen Schreie, die sie jedes Mal ausstieß, wenn Freunde der Familie Anlauf nahmen und sie an Armen und Beinen packten, um sie ins Wasser zu werfen, weil sie glaubten, dass meine Mutter sich nur aus Schüchternheit wehrte. Ihre mit Sonnenöl bedeckte Haut voll blauer Flecken blieb tagelang glitschig, der Körper war schon bereit für die Firmung, aber sie glaubte nicht mehr an die Sakramente, seit sie die Nonnen verlassen hatte, ihren Eltern hatte sie das noch nicht gesagt.
In jenen Jahren gingen alle nach Coney Island, es gibt aber auch andere Strände, die mich an meine Familie erinnern.
Dead Horse Bay ist eine sumpfige Bucht, früher umringt von Pferdeabdeckereien, Müllverbrennungsanlagen und Fabriken für Fischölverarbeitung. Ihren Namen verdankt sie den Pferdekadavern, die zwischen 1850 und 1930 für die Herstellung von Dünger und Klebstoff benutzt wurden. Von den Fleischresten befreit, wurden die Knochen der Tiere ausgekocht und das restliche Kochwasser dann in die Bucht geschüttet, über der ein radioaktiver, unentschiedener Dunst lag, der jedes menschliche Wesen in einen Verbrecher und jeden Verbrecher in ein Gespenst verwandeln konnte. Dead Horse Bay bekam eine neue Funktion, als es zu einer unterirdischen Deponie für den Müll von New York wurde, den man sich dort aus den Augen schaffte. Der Boden wurde festgestampft, damit er den Abfall fassen konnte und Fäulnisprozesse vermieden wurden, doch nach einer Überschwemmung und mehreren Erosionen begann die Müllkippe sich aufzulösen, noch heute schwemmt sie ihren Inhalt an den Strand.
Der Glass Bottle Beach an der Dead Horse Bay ist übersät mit verschlissenen Schuhen, Waschmitteln uralter Marken und kaputten Flaschen, offenbar sind auch immer noch Pferdeknochen dabei, aber ich habe nie welche gefunden. Manchmal bin ich auf Pärchen gestoßen, die die sonderbarsten Reste suchten, um daraus Traumfänger zu basteln, die man im Garten aufhängt, Pärchen, die sich gegenseitig schubsten, die verkrusteten Glasscherben ins Wasser warfen und sich über ihren schlechten Geschmack lustig machten. Am Strand liegen Boote, von irgendwelchen Künstlern bemalt, die Botschaften vom Frieden oder von der Apokalypse darauf hinterlassen haben, nur solche Sachen, keine Herzen mit den Initialen einer Liebesbeziehung, und an den Bäumen, die Rindenstücke verlieren, wenn man sie nur streift und sich die Finger mit Harz und Salz verklebt, hängen amerikanische Fahnen in verrosteten und mittlerweile falschen Farben.
Es ist ein verzauberter und einsamer Ort voller Abfallgeier, doch kein Einwanderungsmuseum erinnert mich so an meine Familie wie dieser Glasfriedhof in Brooklyn. Meine Großeltern haben versucht, Wurzeln in einem Sumpf zu schlagen, und jedes Mal, wenn Amerika es von ihnen verlangte, haben sie die Rollen und Ambitionen gewechselt, nur um eine Art Frieden mit dem unfreiwilligen Verlust der Gegenstände zu machen, die sie mitgebracht hatten. Dinge mit Markennamen, die keinen Bezug mehr zur Realität und nicht einmal mehr einen sentimentalen Wert in einer Familie hatten, die sich immer wieder neu erfand, während ihre euphorische und traurige Lauge an die Oberfläche stieg, als wäre sie eine umgewidmete Müllhalde.
Meine Mutter war etwa fünfzehn, als sie nach Rom umzog, und in dieser Zeit lernte sie das Weglaufen. Oft fanden die Carabinieri sie schlafend in der Villa Borghese. Manchmal ging sie nachts raus, verließ die Boccea — damals noch ein Viertel am Stadtrand —, wo ihr Pensionat lag, und wanderte viele Kilometer zwischen brachliegenden Feldern und Brackwassersümpfen an den Maschen der zerfransten Stadt entlang, auf der Suche nach einem Park, wo sie in Embryonalstellung unter den Bäumen einschlief, die Hände zwischen den Schenkeln, Tau auf dem Rücken, bis die Schuhe eines Unbekannten ihr mit dumpfem Widerhall auf dem feuchten Boden ankündigten, dass jemand sie aufgespürt hatte, dann stand sie auf und flüchtete wieder.
»Du hattest einen Platz zum Schlafen, du hattest zu essen. Es gab Menschen, die sich Sorgen um dich machten, warum bist du weggelaufen?«, fragte ich, wenn sie mir von diesen Fluchten erzählte, die ich als Heranwachsende nachahmen würde, ohne so erfolgreich zu sein wie sie.
»Ich wollte mich nur frei fühlen.« Die einzigen Orte, an denen meine Mutter sich vor den unsichtbaren Angreifern hinter ihrem Rücken geschützt fühlte, waren Wälder und Straßen.
Als kleiner Junge beobachtete er seinen Vater Gorizio, der die Pferde beschlug, er stahl die den Tieren abgenommenen Hufeisen und steckte sie sich in die Tasche, wenn er auf die Felder ging. Hier rammte er hölzerne Pfähle in den Boden, hängte die noch mit Mist und Stroh verschmutzten Eisen daran auf und schoss in das Halbrund. Die Ziele rückte er in immer größere Entfernung.
Zwischen Messern, Druckluftnaglern und Pistolen hat mein Vater sich immer wohlgefühlt.
In der Garage bewahrt er den Sand auf, den er bei all seinen Reisen ans Meer gesammelt hat, der Sand lagert in Behältern mit Etiketten, die das Datum und die Herkunft anzeigen, in seltenen Fällen beschreiben sie auch die Eigenschaften der Sandproben. Manchmal schenkt er mir einen in Zellophan verpackten Seestern, aber erst, wenn er ihn mit einer phosphoreszierenden, vulgären Farbe bemalt hat. In einem Raum an der Rückseite gibt es Kisten voller Mineralien und Muscheln, in solchen Kisten lagern Eisenwarenhandlungen ihre Schrauben. Einmal habe ich eine Dose mit weißen Bimssteinen aus dem Regal genommen, auf dem Etikett stand »Mond«.
In der Grundschulzeit hatte auch ich eine Mineraliensammlung, auf meine mit rosa Quarzstein und Schwefelkies gefüllten Schächtelchen schrieb ich »Vulkangestein«, »Mars« oder »Hawaii« und erzählte meinen Klassenkameradinnen, mein Vater habe sie mir besorgt. Damals war ich imstande, mit zerfaserten, luftigen Resten von Verbandwatte in die Schule zu kommen und zu erzählen, ich hätte auf einer Flugreise die Fensterscheibe eingeschlagen und Stücke aus den Wolken gerissen; manchmal glaubte mir jemand. Mein Vater und ich wetteifern oft, wer die phantastischste Lüge erzählen kann, beide angetrieben von derselben arroganten Gewissheit, auf jeden Fall davonzukommen.
Nach der Mittelschule meldete seine Mutter ihn zu einem Ausbildungskurs als Elektronikingenieur an. Er liebte mechanische Vorgänge und den Lauf der Planeten, auf seinen Schreibtischen stapelten sich immer Hefte, in die er die Entfernung der Erde zur Sonne und die Breitengrade der Wüsten eintrug. Sein Leben ähnelte den Quizsendungen im Fernsehen, wo das Wissen in einfachste Kenntnisse zerstückelt wird, und es war leicht für ihn, intelligent zu erscheinen, wenn er Daten herunterleierte, von denen seine Eltern nichts verstanden.
Er konnte Pferde satteln und Holz bearbeiten, doch lieber bastelte er Miniaturmodelle oder verband mehrere elektrische Systeme miteinander und veränderte die Stromzufuhr in den Anlagen, bis sie vor Spannung strahlten, weil er zu verstehen versuchte, wie das Licht erlöschen und plötzlich zurückkommen konnte. Für die Veränderungen der Farben in einem Zimmer hatte er immer ein feines Gespür.
Seine Lehrerinnen sagten meiner Großmutter, er sei zu schön, um als Elektriker zu arbeiten, er solle Schauspieler werden. Diese Bemerkung erfüllte Rufina mit Stolz, doch mein Vater zögerte, er wollte sich nicht schminken und so tun als ob. Im Sommer fuhr er in Monteleone di Spoleto Motocross-Rennen mit seinem älteren Bruder und anderen Jungen aus dem Ort. Ich weiß nicht, ob er gewann, weil er keine Angst vor Stürzen hatte und schneller fuhr als die anderen, oder weil die anderen ihn siegen ließen, damit er sich freute. Solche Zweifel befielen auch ihn, und die Frustration, die in der Brust zurückgehaltene Wut, war kurz davor, Blitze zu schleudern.
Seine Mutter brachte ihn nach Ostia zum Schwimmen, mit fünfzehn hatte er den geschmeidigen, muskulösen Körper der Kinder wohlhabender Leute. Er hatte angefangen zu trinken und zu rauchen, obwohl ihm Freunde fehlten, die ihm dabei Gesellschaft leisteten. In der Schule war er still. In seinem Heimatort gab es andere Gehörlose, doch sie waren nicht in seinem Alter, und er wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Gestikulieren mochte er nicht, nicht einmal mit seinen Eltern, wenn er jemanden auf sich aufmerksam machen wollte, schlug er auf den Tisch oder stampfte mit den Füßen. Wenn seine Verwandten versuchten, sich mit Gesten verständlich zu machen, ohrfeigte er sie oder schlug die Arme weg, die um ihn herumfuchtelten. Er wollte die Leute zu einer deutlichen Aussprache zwingen, damit er ihnen von den Lippen lesen konnte. Er und meine Mutter lebten kilometerweit voneinander entfernt, aber sie hatten sich dieselben Strategien der Verstellung zu eigen gemacht.
Vor einiger Zeit hat die Ökologin Suzanne Simard gezeigt, dass der Wald ein kooperatives System ist und die Bäume miteinander »sprechen«, um Nährstoffe auszutauschen oder sie bei Gefahr abzugeben. Wenn ein Feuer ausbricht, nutzen die Bäume die Mykorrhizapilze im Erdreich, die ein dichtes neuronales Netzwerk bilden, um lebenswichtige Substanzen an die jüngeren Baumarten weiterzugeben, damit schwächere Pflanzen überleben können. Bevor ich diese Theorien entdeckte, glaubte ich, dass die Liebe fast immer mit dem Schicksal und einer erschreckenden Form von Ignoranz zusammenfällt — wir wissen weder, wen wir lieben werden, noch warum wir ihn brauchen werden. Doch wenn ich daran denke, wie ähnlich sich meine Eltern an den melancholischen und zornigen Nachmittagen ihrer Jugend waren, erwäge ich die Möglichkeit, dass die Begegnung zweier Menschen nichts mit Vorherbestimmung zu tun hat, sondern mit einer Art biologischer Landkarte, die offenbar wird, während man sich ineinander verliebt. Dann erkennen wir, dass es eine ursprüngliche Intelligenz gab, die unsere Körper beherrschte und, noch bevor wir einander begegneten, elementare Teilchen in die Luft entließ, die durch die Stadt, durch Zementwände und Hautmembrane drang, um mit ähnlichen Substanzen in Kontakt zu treten und eine Art gemeinsamer Widerstandskraft zu entwickeln, einen Schutz gegen die Anfeindungen der Welt. Meine Eltern sind sich nicht begegnet, weil es so geschrieben stand, sondern weil es rückwirkende Prozesse gab, wie die in einem Wald vor dem Feuer. Ihre Zukunft war nicht ins Wasserzeichen einer Bibel oder eines alten Horoskops eingeprägt, sie war nur eine besondere Vibration in der Luft, ein unsichtbarer Alarm, der zum Überleben aufforderte.
In der Pubertät entdeckte mein Vater seine bevorzugte Kommunikationsform, die Gemeinheit. Er ließ kleine Nippesfiguren verschwinden, stellte Stolperfallen auf, versteckte die Scheren und den Nähkorb seiner Mutter und erschreckte die Menschen, indem er plötzlich hinter ihnen auftauchte. Keiner wusste, wohin er in seiner Freizeit ging, doch er hatte bereits begonnen, Sex mit älteren Frauen zu haben, die ihn in ihre Wohnungen einluden und ihm beibrachten, was sie wussten. Am frühen Nachmittag auf dem Bett liegend, in Zimmern mit Seidentapeten, orangen Lampenschirmen und blankgeputzten Bilderrahmen, die die Witwen auf dem Nachttisch stehen hatten, erkannte mein Vater, dass er kein Interesse an jungen Mädchen seines Alters hatte, deren Körper noch nicht von Verzichten gezeichnet waren.
Doch auch dieser Körper, der den Frauen so schön und funktionell erschien, sollte früher oder später Schaden nehmen. Behinderte — jedes Wort zu ihrer Bezeichnung ist ungenügend, unpassend — sind eine verborgene Mehrheit: Trotz all der Geräte und Prothesen, die beweisen wollen, dass es den Tod nicht gibt, wird fast allen von uns mit der Zeit eine Superkraft abhandenkommen, sei es das Sehvermögen, ein Arm oder das Gedächtnis. Fähigkeiten zu verlieren, die wir haben müssten, nicht mehr sehen, hören, sich erinnern oder gehen zu können, ist keine Ausnahme, sondern eine Bestimmung.
Früher oder später sind wir alle behindert. Diese jungen Mädchen werden es sein, diese Witwen, die ihn vom Sex abhängig machten, werden es sein — im Vergleich zu ihnen kam mein Vater einfach nur aus der Zukunft.
Wenn er schwimmen ging, verschwand er manchmal, schwamm hinaus ins offene Meer, ertrug das ganze Gewicht des Wassers über seinem Kopf und wagte sich jedes Mal weiter hinaus.
Jugend
Ihren zwanzigsten Geburtstag feierte meine Mutter auf den Pflastersteinen der Piazza Navona mit einer Torte, gekauft von Freunden, die wie sie auf der Straße lebten. Sie hatten eine Kollekte veranstaltet und die Torte auf ein Stück Pappe gestellt, um ihr eine Überraschung zu bereiten.