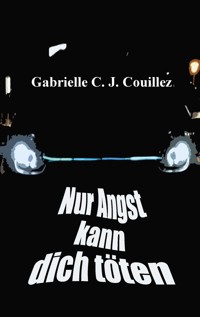Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Frucht des Ölbaums
- Sprache: Deutsch
Okzitanien, der Süden Frankreichs im Jahre 1210. Der gerade erst zehn Jahre alte Olivier erlebt zusammen mit seiner Familie den Ausbruch des Kreuzzuges gegen die Katharer. Sie fliehen vor der Brutalität des Krieges in das nahe gelegene Königreich Aragon, während der Vater Oliviers auf der Festung Termes im Languedoc zurückbleibt. Erzogen von seinem Stiefvater und seinem Onkel, einem berühmten Führer dieser vom Vatikan abtrünnigen Glaubensgemeinschaft, wächst Olivier de Termes im Exil auf und wird nach seiner Ausbildung zum Ritter am Hofe von Barcelona und seinem ersten Abenteuer als Beschützer von geheimen katharischen Schriften zum rebellischen Freiheitskämpfer. Er lernt auf vielfältige Weise die Liebe kennen und hat im Kontakt mit Franziskus erste Zweifel an seiner Religion. Aber die Rückeroberung seiner väterlichen Ländereien hat Vorrang. Für deren Besitz ist er sogar bereit, sich mit Papst und französischer Krone zu arrangieren und seine wahre Denkweise zu leugnen. Doch sein Herz schlägt für sein Land und sein einst stolzes und freies Volk, welches von der Inquisition geknechtet wird. Burgen, Ketzer, verbotene Liebe und ein südfranzösischer Ritter, der für die Freiheit gegen eine Übermacht kämpfte Ein dramatischer Historienroman mit zeitkritischem Hintersinn über den Katharerkreuzzug und das Leben des Ritters Olivier de Termes, der von 1200 bis 1274 lebte. Band 1 der überarbeiteten Neufassung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Vater
Da wartete Noah sieben Tage; dann ließ er die Taube ausfliegen, um zu sehen, ob sich die Wasser vom Erdboden verlaufen hätten. Da aber die Taube keine Stätte fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche ... Hierauf wartete er noch weitere sieben Tage, dann ließ er die Taube abermals aus der Arche fliegen. Um die Abendzeit kam sie zu ihm zurück, und siehe da, sie trug einen frischen Ölzweig in ihrem Schnabel!“
(Bibel, Genesis 8, 8-11)
„Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Garten Getsemani auf dem Ölberg; seine Jünger folgten ihm. ... Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete:Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen.“
(Bibel, Lukas 22, 39-42)
„Allah ist das Licht der Himmel und der Erde.Sein Licht ist gleich einer Nische, in der sich eine Lampe befindet; die Lampe ist in einem Glase, und das Glas gleich einem flimmernden Stern. Es wird angezündet von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder von Osten noch vom Westen, dessen Öl fast leuchtete, auch wenn es kein Feuer berührte – Licht über Licht!“
(Koran, Sure 24, 35)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Belagerung
Oktober 1210
Flucht
22. November 1210
Der Fall von Termes
23. November 1210
Intermezzo
Heimatlos
22. November 1210
Dezember 1210
Paratge Mesura Lerguesa
Ende der Kindheit
Frühling 1214
Sommer 1214
Anno 1216
Anno 1218
Anno 1219
Der Ritter
Sommer 1219
Pilgerreise
Spätsommer 1219
Herbst 1219
Dezember 1219
März 1220
Frühjahr 1220
Der Sohn
Sommer 1220
Faidit
Herbst 1220
Februar 1221
Sommer 1221
Anno 1222
Anno 1223
Sommer 1224
Die Herren von Termes
25. Juli 1224
September 1224
Herbst 1224
Anno 1225
Anno 1226
Anno 1227
Anno 1228
Kapitulation
November 1228
11. Dezember 1228
Jahresende 1228
1. Quartal 1229
Vasall Aragons
5. September 1229
Dezember 1229
Der letzte Baron de Termes
Mai 1230
Herbst 1230
Glossar
Zeittafel der geschichtlichen Ereignisse
Personenregister
Anmerkungen
Quellen
Prolog
Belagerung
Oktober 1210
„Raymond! Wie soll das weitergehen? Seit zwei Tagen ist der Wasservorrat zu Ende. Es gibt nur noch Wein“, zetert Ermessande und streichelt ihre beiden Kleinsten, die wimmernd in ihren Wiegen liegen. Ihre Gesichtchen sind blass und Ermessande sorgt sich um ihr Leben. Auch die beiden größeren Kinder, ihre zwölfjährige Tochter Raymonde und der zehnjährige Olivier, sind die letzten Tage merkwürdig still geworden. „Die Ziegen geben keine Milch mehr, denn den Wein wollen sie nicht trinken“, klagt die Castèlanin weiter. „Wir haben noch ein paar Äpfel, aus denen sich Saft pressen lässt, aber die werden auch nicht lange reichen.“
Der Baron Raymond de Termes sitzt auf der Bettkante bei seiner Gemahlin und starrt mit abwesendem Blick auf sei-ne Füße. Er wirkt kleiner als sonst, seine stolze Haltung ist verschwunden und seine hellen Augen sind dunkel gerändert. Tiefe Falten ziehen sich quer über seine Stirn, die er in all den Jahren jedem Gegner geboten hatte. Ohne von Ermessandes Empörung ergriffen zu werden, antwortet er ihr matt: „Ich hätte nie gedacht, dass diese Kreuzfahrer die Belagerung gegen unsere starke Festung so lange halten würden. Schließlich muss auch diesem verfluchten Simon de Montfort und seinen Söldnern langsam die Verpflegung knapp werden.“
„Wieso sollte sie?“, schreit Ermessande ihren Gatten nervös an. Ihre dunklen Augen funkeln in ihrem ebenmäßigen Gesicht, das von einer unbestritten grazilen Schönheit ist, ‚dass die Sterne am Nachthimmel bei ihrem Anblick erblassen müssten, wenn sie sie aus der Nähe sehen könnten‘, wie einst ein Troubadour über sie bei den noch vor zwei Jahren häufig stattfindenden rauschenden Festen auf Termes gesungen hat. Diese Zeiten scheinen gleichwohl lange vorüber.
„Die Kreuzritter können sich doch frei bewegen und unsere Ländereien plündern, wie es ihnen beliebt!“ Am liebsten würde sie Raymond schütteln, um ihn aus dieser an ihm ungewohnt gleichgültigen Fassung zu bringen, die sie zur Weißglut treibt. Wie kann er nur so ruhig bleiben?
Zögernd erhebt der Baron sein Gesicht und ergreift die Hand seiner Gemahlin, die, vor Wut und Verzweiflung zitternd, Falten in den seidenen Stoff ihres Kleides knüllt. „Du vergisst, Ermessande, dass unsere Untertanen aus dem Dorf unter unserem Castèl alle zu uns herauf gekommen sind und sicherlich nichts Brauchbares für die Kreuzfahrertruppen zurückgelassen haben. Nachschub kann sich Montfort nur aus den weiter entfernten Ortschaften holen und die werden nicht gerade auf ihn gewartet haben. Sein Ruf ist ihm nach den Massakern, die er und seine brutalen Truppen im Auftrag von Papst Innozenz III. hier im Languedoc unter unserem Volk angerichtet haben, schon lange vorausgeeilt. Und da im Zweifelsfalle sogar papsttreue Katholiken gemeuchelt werden, nur um unseren katharischen Christenglauben auszumerzen, hat sich jeder, der konnte, in den Bergen versteckt.“
„Dennoch - Raymond, wie du siehst, ist Montfort noch da. Und jetzt sind wir es, die zwar nicht verhungern werden, aber verdursten!“ Zornig wendet die junge Frau ihrem Gemahl den Rücken zu und kämmt sich mit fahrigen Strichen ihr langes, schwarzes Haar.
„Noch ist es nicht so weit, Ermessande.“
„Und was soll ich den Kleinen geben? Etwa Wein?“ Über ihre Schulter wirft sie Raymond einen vorwurfsvollen Blick zu.
„Sicherlich ist unter den vielen Frauen hier auf der Burg noch eine, die als Amme geeignet ist. Und irgendwann muss es auch wieder regnen“, antwortet der Baron gelassen.
Mit diesen Worten steht Raymond auf, zieht sich sein Kettenhemd über und gürtet sich sein Schwert um. Dann legt er; kurz innehaltend; dem dreijährigen Bernard und der kleinen Blanche die Hände auf die Köpfchen und geht zur Tür hinaus.
Ermessande ist außer sich. Sie fühlt sich mit ihren Sorgen nicht mehr verstanden. Bisher hatte ihr Gatte ihre Einwände jederzeit ernst genommen und sie als seine Gemahlin mit dem gleichen Respekt behandelt wie seinen Bruder Benoît, der als vorbildlicher Katharer und gelehrter Bonhomme von den Gläubigen sogar noch höher geachtet wird, als der herrschende Baron selbst. Doch in den letzten Tagen ist ihr Gemahl für sie unerreichbar geworden. Trotzige Tränen quellen aus ihren Augen und benetzen ihre durstigen Lippen. Unwillkürlich leckt sie danach.
Raymond tritt aus dem Donjon nach draußen in den sonnigen Morgen. Schon so früh am Tag ist die Luft staubig und warm, obwohl der beginnende Herbst die Trockenheit der vergangenen Wochen mildern müsste. Der Baron lässt seinen Blick nachdenklich über das erwachende Treiben der Menschen innerhalb dieses ersten Befestigungsringes seines Castèls schweifen. Die sonst offene, weite Hoffläche ist jetzt vom Bergfried bis zur gegenüberliegenden Burgkapelle mit provisorischen Holzbauten und Zelten übersät, die sich die geflohenen Dorfbewohner als notdürftige Unterkünfte aufgebaut haben. Schließlich entdeckt er von weitem die zarte Silhouette und den blonden Haarschopf seines zehnjährigen Sohnes Olivier, der wartend an der Mauer nahe dem Hofausgang lehnt. Raymond geht auf ihn zu und freut sich über das Lächeln des Kindes, als sich ihre Augen treffen. Olivier bückt sich, um einen kleinen glänzenden Helm, der zwischen seinen Füßen steht, aufzuheben. Der Dorfschmied hat diesen ritterlichen Kopfschutz für den jungen Baron angefertigt und ihm zum Geschenk gemacht, als er mit den übrigen Bewohnern des Dorfes die Festung für die zu erwartende Belagerung vorbereitet hat.
„Bònjorn, mon Paire! Darf ich Euch begleiten?“, grüßt der Sohn seinen Vater verhalten mit einem hoffnungsvollen Strahlen im Gesicht.
„Gerne, mein Sohn. Zwei Augenpaare erkennen mehr als eins. Wollen wir einmal sehen, ob wir beide die Kreuzfahrer heute verjagen können! Aber setz deinen Helm auf, denn manchmal treffen die Geschosse dieser Schweinehunde auch“, scherzt Raymond, um seine Sorge vor dem Kind zu verhehlen, wobei er dem Jungen mit seiner kräftigen Hand streichelnd über den Kopf fährt.
Vater und Sohn, jeder dem anderen ein Spiegelbild aus einer fernen Zeit, schlendern einträchtig hinunter durch den Zwinger, der zwischen der äußeren und inneren Festungsmauer ringförmig die eigentliche Burg umschließt. An der südöstlichen Ecke liegt das einzige größere Gebäude außerhalb des Donjons auf dem Gipfel. Ein großzügiger Mannschaftsraum ist darin untergebracht, aus welchem dem Baron und Olivier das Gelächter der Ritter und Wächter entgegenschallt. Mit lästerlichen Bemerkungen machen sie sich über die Kreuzfahrer lustig, die sich die ganze Nacht ungewohnt ruhig verhalten haben. Ein paar Ritter liegen auf ihren Schlaflagern und ruhen sich von der Nachtwache aus, andere sitzen an einem großen Tisch nahe dem Eingang und stärken sich mit Brot, gesalzenem Speck, Käse und Wein. Als sie den Baron bemerken, stehen sie zum Gruß auf und laden ihn und seinen Sohn ein, an ihrer Tafel Platz zu nehmen. Raymond schiebt seinen Sohn auf die Bank zwischen sich und einen stattlichen Ritter, der schon, seit Olivier denken kann, immer wieder seinen Dienst auf dem Castèl verrichtet. Lehnsherr und Vasall begrüßen sich herzlich und ohne die sonst übliche respektvolle Anrede.
„Na, Guillem, was macht der Nachwuchs?“
„Raymond, wie soll das gehen? Wenn ich immer bei Euch Dienst tue, kann ich keinen bei meinem Weib leisten“, kontert der Ritter schelmisch und reicht dem Baron einen Becher mit Wein.
Neckend entgegnet Raymond: „Ich glaube fast, du übst dich schon in den Regeln der gottergebenen Katharergeistlichen und vernachlässigst deine Ehepflichten bewusst. Du hast doch nicht etwa die Absicht, hier bei mir deinen Dienst aufzukündigen und als Bonhomme predigend durch die Lande zu ziehen? Das werde ich nicht zulassen, dass mein bester Ritter die Waffen ablegt!“
Rundum ertönt daraufhin spöttisches Lachen der Männer. Einer stülpt Guillem im Vorrübergehen eine weite Kapuze aus dunkler Wolle über den Kopf, um ihm das Aussehen eines vollkommenen Katharers, eines Bonhomme, zu geben, was das Gelächter der anderen noch anheizt.
Ein mächtiger Schlag lässt die Männer plötzlich erschreckt aufhorchen und ihr lustiges Lachen verstummt und erstarrt in ihren Gesichtern zu einer routiniert besonnenen Maske. Ein weiterer Geschosseinschlag folgt in kurzem Abstand und erschüttert das Gemäuer.
„Es geht wieder los!“ ruft jemand und um Olivier herum ist plötzlich hektisches Treiben. Die Mahlzeit ist augenblicklich beendet. Rüstungen werden angelegt. Jeder ergreift seine Armbrust und eilt nach draußen. Die sich zur Ruhe niedergelegt haben, springen auf und ziehen sich ihre schützenden Kettenhemden wieder über die müden Glieder. Knappen eilen mit gefüllten Pfeilköchern durch den Saal. Manche hört man auf das flache Dach des Mannschaftsgebäudes steigen und eine dort postierte Ballista und ein kleines Steinkatapult bedienen.
„Komm, Olivier!“ Der Baron hat die Hand des Knaben gepackt. „Hier wird es zu gefährlich für dich. Ich bringe dich zu deiner Mutter.“
Unzufrieden, aber widerspruchslos folgt Olivier seinem Vater. Sie eilen auf den sicheren, höher liegenden, inneren Befestigungsring zu. Befehle werden von allen Seiten gebrüllt und der Feind überschüttet die Burg mit einem Steinhagel. Manche der riesigen Gesteinsbrocken schaffen es bis über die äußere Mauer und schlagen krachend auf den felsigen Boden des Zwingers. Den Donjon jedoch konnten die Kreuzfahrer in den vergangenen Wochen mit ihren Geschossen noch nicht erreichen. Er liegt für die Angreifer gottlob viel zu hoch. Olivier hat von seinem Vater während ihrer gemeinsamen Rundgänge in den Feuerpausen gelernt, dass die Belagerer ihnen selbst mit den mächtigsten Steinschleudern, den Mangonneaux, nichts anhaben können, da sich ihr schweres Kriegsgerät durch die steilen Abhänge rund um Termes nicht vorteilhaft positionieren lässt. Die Täler liegen ebenfalls zu tief, um von dort aus wirkungsvoll Schaden anzurichten. So bleibt den Truppen Simon de Montforts nur die Möglichkeit, die äußeren Mauern vom Turnierplatz aus, auf halber Höhe ihres Berges, immer wieder unter Beschuss zu nehmen und damit die Burgbewohner nervlich aufzureiben und von der Außenwelt abzuschneiden.
Wenige Stunden später ist wieder Ruhe eingekehrt und Olivier stiehlt sich aus der fürsorglichen Obhut seiner Mutter, die bei diesen dröhnenden Angriffen, welche meist auch mit feurigen Geschossen ausgeführt werden, immer wie Espenlaub zittert und ihn und seine Geschwister dann krampfhaft umklammert. Indes macht sich der Knabe auf die Suche nach seinem Vater. In geduckter Haltung rennt er den hölzernen Wehrgang auf der Brüstung der äußeren Befestigungsmauer entlang bis er seinen Vater schließlich zusammen mit seinem Ritter Guillem de Roquefort in ein Gespräch vertieft findet. Lauschend verlangsamt Olivier seinen Schritt und nähert sich verhalten den beiden heftig debattierenden Männern.
„Vergiss es, Raymond! Du hast doch wahrlich genug über diesen Simon de Montfort gehört! Der wird in hundert Jahren nicht von uns weichen. Wir müssen einen Ausfall machen und versuchen die Katapulte außer Gefecht zu setzen!“
„Ein Ausfall? Das wäre töricht!“, hört Olivier seinen Vater entgegenhalten. „Zum einen würden wir uns hier durch den felsigen, unbewachsenen Steilhang rund um die Burg dem Feind wie auf einer Tafel servieren. Zum anderen sind die Kreuzritter auch ohne Kriegsmaschinen viel zu zahlreich, um von uns bezwungen zu werden! Hat dir unsere misslungene Attacke auf die von unseren Belagerern so strategisch vortrefflich aufgebaute Mangonneau nicht gereicht? Dieses verdammte Katapult setzt uns erbärmlich zu und wir haben es nicht einmal gemeinsam mit der Dorfbevölkerung geschafft, dieses Teufelsding in Brand zu stecken und außer Gefecht zu setzen!“ erwidert der Baron wild gestikulierend mit hochrotem Kopf.
„Dennoch, lass es uns noch einmal versuchen! Immerhin hatten wir damals die Wachen erfolgreich in die Flucht geschlagen. Denen reichte schon unser Anblick! Alle dreihundert Sergeanten und sogar vier Kreuzritter sind kampflos abgehauen!“ entgegnet Guillem selbstsicher.
„Ja, aber ein feindlicher Ritter ist geblieben und hat das Satansgerät vor uns allen verteidigt. Nichts – gar nichts konnten wir ausrichten! Die Steinschleuder steht noch jetzt unerreichbar von den Felsen geschützt. Vierhundert Leute gegen einen! Und es ist nicht einmal Blut geflossen!“, schmettert Raymond den Einwand seines Ritters nieder.
Der schüttelt ratlos seinen Kopf. „Wir brauchen dringend Wasser! Wir können nicht immerzu Wein trinken, auch wenn davon reichlich vorhanden ist. Die meisten von uns sind bis zum Mittag besoffen und außerdem stinken wir bald mehr als die Kreuzfahrer. Selbst wenn wir als Gläubige die Reinigungsvorschriften nicht wie dein Bruder einhalten müssen, so nimmt es uns den letzten Rest an Würde!“
„Lass dich jetzt bloß nicht von Montfort demoralisieren, Guillem!“
„Aber mon Paire, die kleinen Kinder in der Burg brauchen dringend Wasser“, mischt sich Olivier ein, der bis jetzt von den beiden unbeachtet geblieben war und den die Sorgen der Erwachsenen nicht unberührt lassen.
„Olivier, was machst du schon wieder hier? Habe ich dich nicht zu deiner Mutter geschickt?“ Raymond ist wütender über die von seinem Sohn ausgesprochene Notlage als über dessen Anwesenheit. Traurig wendet sich Olivier um und geht. Er weiß, frisches Wasser wäre dringend nötig und er kann die Tatenlosigkeit seines Vaters nicht verstehen. Wenn er der Baron wäre, würde er Guillems Rat befolgen und noch einen Ausfall wagen. Vielleicht sind seinem Vater die Kinder völlig gleichgültig, folgert er enttäuscht. Er schickt ihn ja auch ständig weg. – Der Junge streicht im Vorbeilaufen an der Mauer entlang und tritt wütend mit seinem Schuh gegen den harten Stein.
Baron Raymond de Termes ärgert sich derweil über sich selbst und seine Unbeherrschtheit gegenüber dem Kind, das er mehr liebt, als alles andere auf der Welt. Er eilt ihm nach und hält den Knaben fest. „Nein, warte Olivier!“ Unbeholfen beißt sich der Baron auf die Lippen. „Bleib hier bei uns und hadere nicht länger mit dem Schicksal.“
Glücklich darüber, mit seinem Ungehorsam den Widerstand gebrochen zu haben und jetzt doch bei seinem Vater bleiben zu können, wischt sich Olivier die Tränen aus den Augen und ergreift versöhnend dessen Hand.
„Also, wie soll es nun weitergehen?“ hakt der Ritter nun noch einmal ungeduldig nach.
„Alles bleibt wie es war. Wir bessern die Schäden aus, welche die Katapulte in unsere Mauern schlagen und halten die Kreuzfahrer mit unserer Gegenwehr auf Abstand. – Wenn es wirklich notwendig wird, gibt es noch einen anderen Ausweg“, murmelt der Baron und wendet sich mit seinem Sohn Olivier an der Hand zum Gehen. „Komm, mein Sohn, wir machen unseren Rundgang und sehen nach dem Rechten.“
„Welchen Ausweg?“, ruft Guillem ihnen hinterher.
Doch Raymond hebt nur abwiegelnd die Hand und setzt seinen Weg fort.
Der Junge würde auch gerne Genaueres wissen, wagt es jetzt jedoch nicht, seinen Vater darauf anzusprechen. „Sind die Kreuzfahrer nicht ebenso Menschen wie wir?“, versucht er den drohenden Bann des Schweigens stattdessen zu brechen. „Und ist Simon de Montfort nicht ein christlicher Adliger, wie Ihr, mon Paire?“
„Da hast du wohl recht, mein Sohn. Aber diese Kreuzfahrer haben mit ihren Taten, die sie in den vergangenen Monaten begangen haben, bewiesen, dass sie keine wahren Ritter sind, die dem Ehrencodex folgen“, brummelt Raymond nachdenklich in seinen Bart.
„Sagt, mon Paire, ist dieser Simon de Montfort vielleicht sogar mit uns verwandt?“
„Gott bewahre, nein! Wie kommst du nur auf diese Idee?“ schreckt Raymond voller Abscheu auf.
„Nun, ich wundere mich nur, dass sein Wappen unserem so sehr ähnelt ...“
Òc, das hat mich auch schon erstaunt, wie ein so grobschlächtiger und ungehobelter Mensch einen edlen Löwen in seinem Wappen führen kann. Und dies noch in den gleichen Farben wie wir Barone von Termes! Es ist, als ob er sogar noch durch sein Wappen unser Ansehen zu besudeln sucht, dieser...“, Raymond zügelt seine hasserfüllten Bemerkungen und kneift die Lippen zusammen, als er den aufmerksamen Blick seines Sohnes wahrnimmt.
„Es gibt schon noch einen Unterschied“, beschwichtigt Olivier mit kindlichem Blick. „Montforts Wappen ist rot mit einem silbernen Löwen und unser Wappen ist silbern mit einem roten Löwen.“
„Der menschliche Unterschied ist noch weitaus größer. Diese sogenannten Edelleute aus dem Norden wissen nichts von Paratge, Mesura und Lerguesa.“
„Mon Paire, wie muss ein Edelmann handeln, wenn er nach unseren Sitten ein wahrer Ritter sein will?“, möchte der Knabe jetzt genauer wissen.
„Nun, Paratge bedeutet, respektvoll mit allen Menschen umzugehen; Mesura, sich untadelig zu benehmen und Lerguesa, Großherzigkeit zu üben“, erklärt Raymond nur knapp. Er ist noch immer in Gedanken mit der erschreckenden Möglichkeit beschäftigt, dass ihn jemand aufgrund seines Wappens mit Montfort verwechseln könnte.
Erst spät in der Nacht begibt sich Raymond in sein Schlafgemach. Er hört die gleichmäßigen Atemzüge seiner Kinder und legt vorsichtig sein Wams ab. Leise kriecht er unter die Bettdecke und tastet mit seiner Hand nach dem warmen Körper seiner Gemahlin. Ermessande schläft noch nicht. Als sie die suchenden Hände ihres Gatten bemerkt, regt sich in ihr das Verlangen nach Geborgenheit. Sie schmiegt ihren Rücken eng an seinen Bauch und genießt seine Nähe. Es dauert nicht lange und sie fühlt Raymonds Erregung. Er haucht ihr mit heißem, schwerem Atem Liebesschwüre ins Ohr und reibt sich an ihr. Seine Hände wandern unter ihr Nachthemd zu ihren runden, wohlgeformten Brüsten. Immer fordernder wird seine Erregung und er sucht nach der Quelle seiner Begierde. Seine heißen Küsse bedecken ihren Hals und ihre Wangen. Ermessande beantwortet sein Drängen und gibt sich bereitwillig seinem Wunsch hin.
Wenig später, als der Akt vollzogen ist, hört Ermessande leise Schlafgeräusche hinter sich, doch sie ist nun hellwach. Sie fühlt sich weiterhin von derselben unbefriedigenden Verlassenheit eingenommen wie vor seiner begehrenden Umarmung. Die halbe Nacht grübelt sie über ihre Lage nach, während ihr Gatte schließlich offenkundig friedlich schlummert.
Am anderen Morgen wird Raymond durch das Weinen des Säuglings geweckt. Sein Eheweib ist bereits auf und wiegt die kleine Blanche in ihren Armen, während sie leise eine Melodie summt. Ihr langes, schwarzes Haar fällt in lockigen Kaskaden hinab bis zu ihrem Gesäß, das sich unter dem weiten Nachtgewand nur schemenhaft abzeichnet. Als Raymond ihre Bewegungen beobachtet, regt sich schon wieder sein Verlangen. Doch er beherrscht seine Lust, kleidet sich an und schenkt seiner Gemahlin ein begrüßendes Lächeln. Ermessande erwidert es müde und füttert Blanche mit einem geriebenen Apfel. Die Kleine leckt gierig nach dem Saft. Schließlich richtet Ermessande scheinbar beiläufig mit einer überraschenden Frage das Wort an ihren Gatten: „Warum gibst du die Burg nicht einfach auf?“
Raymond ist es, als habe er nicht richtig gehört. Er fühlt sich schlagartig aus seiner romantischen Stimmung gerissen, die er gerne noch ausgekostet hätte. „Wie kommst du nur auf solch einen verrückten Gedanken?“, braust er auf. „Dann kann ich ja gleich diesen dahergelaufenen Edelmännern aus dem Norden mein Lehen schenken! Hier, nehmt Euch, was Ihr wollt, edle Herren. Ich leiste Euch gerne meinen Lehnseid und werde Euer Vasall!“ Raymond unterstreicht seine Argumente sarkastisch mit einer theatralischen Verbeugung. „Soll ich etwa ein Vasall des Papstes werden? – Und soll ich dann auch wie unser Landesherr Raymond de Toulouse das Kreuz nehmen und gegen mein eigenes Volk in den Kampf ziehen? – Und selbst wenn dies die letzte Möglichkeit wäre, uns alle am Leben zu erhalten, denkst du, man würde mir diesen Eid abkaufen?“
Ermessande versucht ihren Gemahl zu beschwichtigen. Inzwischen sind auch ihre übrigen Kinder von den lauten Worten im Raum geweckt worden. Olivier liegt mit halb geöffneten Augen auf seiner Bettstatt und folgt dem Streitgespräch seiner Eltern.
„Nun sei nicht gleich so unwirsch. Wir müssen uns ja nicht vor dem Papst beugen. Wir können Termes doch verlassen und auf meine Ländereien ziehen. Die liegen außerhalb des Einflusses der französischen Krone auf dem Gebiet von König Pedro von Aragon und genügen für unser Auskommen.“
„König Pedro! Auf den ist doch auch kein Verlass! Hast du vergessen, dass er ein Edikt erlassen hat, wonach jeder Katharer wie ein Hund aus dem Land vertrieben werden soll?“
„Aber das war doch schon vor dreizehn Jahren!“ kontert Ermessande.
„Denkst du, man nennt ihn umsonst den Katholik? Außerdem haben unsere Nachbarn und ich ihm unsere Ländereien schon angetragen. Und wenn ich die weiße Fahne jemals hissen sollte, dann erinnere dich daran, was Simon de Montfort nach dem Fall von Minerve vor vier Monaten meiner Cousine Rixovende angetan hat!“ schreit Raymond jetzt außer sich über soviel Unverständnis seiner Frau. „Nur weil sie die Witwe des Barons und vollkommenen Katharers Guilhem de Minerve war und sich für die gläubigen Bürger ihrer Stadt einsetzte, ließ Simon de Montfort sie auf dem Scheiterhaufen mit den hundertvierzig gesegneten Guten Christen verbrennen! Denkst du Montfort wird uns ziehen lassen? Wenn er uns nicht aufgrund seiner Glaubensüberzeugung und Papsthörigkeit meuchelt, dann mindestens, um jede weitere Anfechtung seines neu gewonnenen Besitzes für alle Ewigkeit auszuschließen!“
„Gleichwohl würde ich lieber in die Wildnis gehen als trotz deines fürsorglichen Schutzes hier zu darben. Ich kann diesen Lärm und die Erschütterungen durch den ständigen Beschuss nicht mehr aushalten“, entgegnet Ermessande uneinsichtig, stampft verzweifelt mit dem Fuß und bricht in Tränen aus. „Die Bewohner von Carcassonne haben sich ergeben und durften ziehen!“
„Ja, mit nichts bekleidet als ihren Sünden, wie der päpstliche Legat es anordnete! Und dies auch nur, weil der junge Vicomte Raymond-Roger de Trencavel sich geopfert hat! Willst du meinen Bruder kaltblütig in den Tod schicken und von deinem Glauben abschwören, nur um dein Leben zu retten? Würdest du das wirklich tun?“ Raymond ist aufgestanden und hat Ermessande bei den Schultern gepackt. Er sieht ihr prüfend in die Augen. Ihr Trotz ist verflogen. Der Säugling auf ihrem Arm schreit erschreckt. Sie fürchtet im Moment einen temperamentvollen Wutausbruch ihres Gatten mehr als alles andere. Ihre schwarzen, mandelförmigen Augen flehen tränengefüllt um Verständnis, was Raymond erweicht. Mit sanfter Stimme fährt er fort: „Ich habe lange nach einer Ehefrau gesucht, die meinen Glauben teilt und als würdige Baronin neben mir mein Volk führen könnte. Ich glaubte, in dir die Richtige gefunden zu haben. War es eine Täuschung?“
Dies bringt die Wand der Ablehnung zwischen Ermessande und Raymond zum Bröckeln. Er schaut ihr weiterhin forschend ins Gesicht, das sie schuldbewusst abzuwenden versucht. Doch er lässt nicht locker. Ihre Augen treffen sich und er kann sich darin wiederfinden. Er denkt an die Zeit, als sie sich kennen lernten: Sie war blutjung, erst vierzehn Lenze, Vollwaise und ihr einziger noch verbliebener Verwandter, ihr Onkel, war auch gerade entschlafen, als sie sich zu einer Heirat mit Raymond bereit erklärte. Zum einen waren es die aufdringlichen Anträge aller heiratswilligen Edelmänner in ihrer Umgebung, die ihre Notlage ausnutzen wollten und sie als leichte und reiche Beute ansahen. Zum anderen brauchte sie damals dringend einen respektablen, vertrauenswürdigen Ehemann an ihrer Seite, um mit genügend Nachdruck das Testament ihres verstorbenen Onkels anfechten zu können. Das Erbe ihrer Eltern, das zu diesem Zeitpunkt noch von ihrem Onkel treuhänderisch als ihrem Vormund zu verwalten war, hatte dieser der Abtei Arles-sur-Tech vermacht. Obwohl unrechtmäßige Nutznießer, waren die habgierigen Kirchenmänner nicht bereit, das Vermögen der eigentlichen Erbin, der zu jener Zeit noch nicht volljährigen Ermessande de Corsavy, freiwillig abzutreten. Es bedurfte eines Ehemannes, der für sie ihre Rechte vor Gericht vertrat, da sie als Unmündige ihr Erbe nicht einklagen konnte und auch nicht den Nonnenschleier nehmen wollte. Man könnte ihr Berechnung vorwerfen, denn ihre Wahl fiel auf ihn, Raymond, den jüngeren Bruder des damals noch herrschenden Barons Peire Olivier de Termes. Und Raymond war überglücklich, sein Junggesellendasein, das er trotz seines reifen Alters von über vierzig Jahren noch führte, beenden zu können. Auch ihm könnte man einen nicht ganz untadeligen Charakter unterstellen, wenn er sich unter diesen Voraussetzungen ein derart kindliches, je-doch reiches Waisenmädchen zur Frau nahm. Aber als jüngerer Bruder des Barons hatte er schlechte Chancen auf dem Heiratsmarkt. Welche Frau, die seinen Anforde-rungen genügend eine würdige Gattin mit katharischer Gesinnung wäre, noch nicht zu alt, um gesunde Nach-kommen zu gebären, und auch noch wohlhabend, um für ein Auskommen der Familie sorgen zu können, würde sich auf eine eheliche Verbindung mit einem Mann einlassen, der weder Vermögen noch jugendliche Männlichkeit vorweisen konnte? – Ermessande war die Einzige. Jetzt ist sie seine große Liebe. Ihr rosiger, immer noch mädchenhafter Mund, lächelt ihn an. Er muss sie küssen.
„Meinst du, Benoît würde Montfort als Opfer genügen?“ flüstert er ihr ins Ohr. „Ich müsste auch bleiben. Würdest du dich so leicht von mir trennen?“
Ermessande schüttelt den Kopf und bittet ihn mit ihren unschuldigen Augen um Vergebung. Sie weiß, dass er im Recht ist. Ihr Schwager Benoît würde mit Sicherheit auf dem Scheiterhaufen enden, da er seit dem päpstlich zugestandenen Disput vor drei Jahren in Montréal mit Dominikus Guzman über die Lehren des katharischen Glaubens und deren Vereinbarkeit mit der christlichen Doktrin in den Protokollen der römischen Kirche als häretischer Eiferer vermerkt ist. – Und Raymond? Er ist zwar erst seit dem Tod seines kinderlos verstorbenen Bruders Peire Olivier vor zwei Jahren der verantwortliche Baron von Termes, dennoch würde er sich sicherlich nicht verteidigen können, wenn die Anklage des vor dreißig Jahren verjagten Dorfpfarrers gegen ihn vorgebracht würde. Keine katholische Messe ist seither in Termes mehr gehalten und kein Zehnt an die Kirche mehr gezahlt worden.
Durch Ermessandes Blick ist Raymond wieder versöhnt. Er kleidet sich an und nimmt einen Schluck Wein aus der bereitstehenden Karaffe, um seinen trockenen Mund zu benetzen. Tief im Innern ist er jedoch unsicher geworden. Ob seine Haltung die Richtige ist? Sollte er mit den Kreuzfahrern doch verhandeln? – Er muss sich mit seinem Bruder beratschlagen.
Unverzüglich macht sich der Baron zur Kammer des Bonhomme auf, der wie immer um diese Zeit betend an seinem Fenster kniet. Raymoond spricht ihn mit einem kurzen „Benedicite, parcite nobis“ an und wartet die rituelle Antwort gar nicht erst ab. Wenn er seinen Bruder bei jeder Begegnung mit dem Melioramentum, der Ehrerweisung unter Katharern gegenüber ihren Vollkommenen, begrüßen wollte, hätte er viel zu tun. „Ich muss mit dir reden, Benoît“, sagt er kurz.
„Worum geht es?“ fragt der Bonhomme aufmerksam geworden und unterbricht sein Gebet.
„Alle liegen mir mit dem Wassermangel in den Ohren und ich weiß nicht mehr, was richtig ist: Die Burg und unser Lehen zu verteidigen oder zu kapitulieren. Wenn ich hart bleibe, werden die Schwächsten von uns bald ihr Leben aushauchen. Wenn ich aufgebe, ist es wahrscheinlich auch unser Ende, oder aber mindestens das deine.“
„Um mich mach dir keine Sorgen, Raymond. Ich kann auch versuchen, des Nachts durch die Schlucht zu fliehen. Und sollte es misslingen, komme ich durch die Hand der Kreuzfahrer direkt als Engel zu unserem Guten Gott. Es wäre eine Freude für mich, von dieser teuflischen Welt gehen zu können“, antwortet der Bonhomme gelassen. „Außerdem ist nach unserer Religion jegliche Gewalt verpönt, wie du weißt, und ich würde daher eine Kapitulation vorziehen.“
„Aber Montfort ist besessen! Er wird die Situation ausnutzen und uns endgültig vernichten!“ Raymond ist über diese Aussage seines Bruders mehr als erstaunt.
„Hast du nicht bemerkt, dass auch er in der Klemme steckt?“
„Du meinst, dass er seine Truppen nicht mehr versorgen kann?“ fragt der Baron unsicher zurück.
„Das ist es nicht alleine. Die Ritter laufen ihm allmählich davon. Simon de Montfort muss ihre Ungeduld befriedigen und die Belagerung zu einem Ende bringen. Und wenn du jetzt klug verhandelst, kannst du noch einiges für uns herausschlagen“, rät Benoît mit dem Nachdruck eines geübten Predigers.
„Bèn – dann werde ich mich überwinden und mit diesem Bastard reden.“, beschließt Raymond nachdenklich.
Stunden später steht Olivier zusammen mit seiner großen Schwester Raymonde an einem Schreibpult in der Kammer ihres Onkels Benoît. Ungeduldig krakelt er seine Lettern auf das Pergament. Er spitzelt auf Raymondes Blatt hinüber, das mit wohlgeformten Buchstabenreihen gefüllt ist. So sehr er sich auch bemüht, seine Worte sehen stets aus, als ob der Wind gerade darüber geweht wäre, während die seiner Schwester immer akkurat aufgereiht dastehen, wie die Ritter vor einem Buhurt. Er schnaubt vor Anstrengung und Unmut. Mit der linken Hand würde es ihm leichter fallen, aber sein Onkel lässt es nicht zu. Seine Finger schmerzen. Der Gänsekiel knirscht auf dem Pergament, droht an der Spitze gar zu splittern. Olivier linst hinüber zu dem Bonhomme, der in ein Buch vertieft in seinem Sessel sitzt. Darauf hoffend, dass sein Tun für eine Weile unentdeckt bleibt, wechselt der Knabe die Schreibhand und fährt mit fließenderen Schriftzügen zum Diktat seines Onkels mit dem Malen der Lettern fort. Benoît hat jedoch den heimlichen Blick seines Neffen bemerkt und sieht ihn aus seinen bernsteinfarbenen Augen tadelnd an:
„Olivier! Das Gebot der Ehrlichkeit gilt auch für das Schreibenlernen!“
Erschreckt zuckt der Junge zusammen, nimmt die Feder wieder in die Rechte und setzt seine Arbeit angestrengt fort. Anfangs hadert er noch mit Zwang, der ihm auch deshalb auferlegt wird, damit er in einigen Jahren im Nahkampf nicht als linkischer Ritter den Kürzeren ziehen wird. Doch schon bald verleitet ihn die monoton diktierende Stimme seines Onkels zum Träumen. Immer wieder sieht er hinüber zur Fensternische und kann das Ende der Unterrichtsstunden kaum abwarten. Endlich beschließt Benoît, dem die Unruhe seines Neffen nicht verborgen geblieben ist, die Erziehung der Kinder für heute zu beenden und sich seinem Gebet in der Kapelle zu widmen.
Olivier und Raymonde folgen ihm fröhlich nach draußen. Auf dem Weg zu der Kapelle kommen sie an einer gemau-erten Zisterne vorbei, die als erste von zweien schon seit Wochen trocken liegt. Die Kinder stecken ihre Köpfe in die Öffnung und rufen in den leeren Hohlraum, um dem dumpfen Echo zu lauschen. Sie lachen und werden immer dreister in ihrem Spiel, bis Oliviers Stimme zwischen den getünchten Wänden hallt: „Montfort, mala cadelada - Teufelsbrut!“ Er will sich noch mehr Schimpfworte einfallen lassen, aber seine Schwester hat ihn bei der Schulter gepackt und zeigt mit der anderen Hand auf ein kleines piepsendes Häufchen in einer Nische am Boden der Zisterne.
„Sei still, du erschreckst sie noch! Sind die nicht süß?“
„Das sind doch nur Mäuse“, sagt Olivier verächtlich, nimmt einen Stein und schleudert ihn auf die Nager.
„Nein!“, schreit seine Schwester entsetzt auf. „Du tust ihnen weh! Man darf nicht töten!“
Benoît tritt daraufhin interessiert hinzu und sieht prüfend in die Zisterne. „Doch, Raymonde, diese darf man töten. Denn es sind keine Tiere, durch die gefallene Engel wandern, wie Vierfüßler und Vögel.“
„Aber sie haben doch vier Füße!“ protestiert Raymonde.
„Mäuse gehören zu den Satanstieren“, erklärt ihr Onkel angewidert und wirft auch einen Stein. „Sie sind genau wie Schlangen, Kröten, Frösche, Eidechsen, Fische, Flöhe und Sechsfüßler unheimlich und böse.“
Raymonde wendet ihren Kopf ab. Die kleinen Mäuse tun ihr leid und sie ärgert sich, ihren Bruder auf die Tiere aufmerksam gemacht zu haben.
Im Laufe des Nachmittags stößt Olivier bei seinen Streifzügen durch die Burg im Nordostturm auf seinen Vater und gesellt sich zu ihm. Der Baron beobachtet seit Stunden immer wieder hoffnungsvoll den Himmel, an dem ein paar dunkle Wolken Regen verheißen. Bis jetzt hat sich die Schwüle vom gestrigen Tag gehalten, aber vielleicht würde das Schicksal endlich ein Einsehen mit ihnen haben, hofft er. Eine Brise aus dem Nordwesten bringt kühle Luft und noch mehr Wolken, die bis zum späten Nachmittag immer schwärzer werden. Vater und Sohn nützen derweil die Untätigkeit der Belagerer, mit denen der Baron einen Waffenstillstand bis zum morgigen Tag aushandeln konnte, um Oliviers Treffsicherheit beim Armbrustschiessen zu verbessern. Mit keinem Wort erwähnt Raymond gegenüber seinem Sohn, der ahnungslos seine Bolzen aus dem Strohsack zieht und unermüdlich den aufgemalten kleinen, roten Punkt auf der Jute anvisiert, den Kapitulationsvertrag.
Endlich erschallt ein dumpfer Schlag. Diesmal stammt er nicht von einem auf die Festungsmauern katapultierten Steingeschoss. Die Brise steigert sich plötzlich in starke Böen. Als Blitze über den Himmel zucken, sind auch die letzten der belagerten Bewohner beruhigt, ja glücklich, und eilen nach leeren Krügen, Fässern und Töpfen. Ehe Olivier die freudige Unruhe unter den Burgbewohnern verstehen kann, bricht das Gewitter mit aller Macht los. Jede freie Stelle auf dem Boden und den Plattformen wird zum Auffangen des kostbaren Wassers genutzt. In sintflutartigen Güssen stürzt der Regen herab. Die Belagerten eilen daraufhin alle nach draußen. Keiner sucht, wie sonst, Schutz vor der Nässe oder betet aus Angst vor den Blitzschlägen. Es wird gelacht und getanzt. Ermessande lässt Seifenstücke verteilen und unter fröhlichem Gekreische und Gespritze waschen sich Männer, Frauen und Kinder, im Regen stehend, die nasse Kleidung noch am Leib. Jeder genießt die Erlösung des Körpers vom klebrigen Schmutz aus Staub, Schweiß und Ungeziefer, der während der vergangenen, entbehrungsvollen Tage die Belagerten plagte.
Weiter unten am Berg, im Lager der Kreuzfahrer, ist man weniger erfreut. Glaubten sich die Streiter Gottes doch dem Ziel schon nahe. Jetzt brüllt Simon de Montfort seine Befehle. Am liebsten würde er die Burg stürmen. Die Belagerten schenken den Kreuzfahrertruppen zwar augenblicklich keine Beachtung, dennoch ist an einen Angriff nicht zu denken. Durch den flutartigen Regen losgelöstes Erdreich stürzt in Schlammlawinen über den felsigen Grund und droht die mächtigen Belagerungsmaschinen einfach wegzuspülen. Die Zelte der Söldner sind bereits unbrauchbar geworden. Jeder der Belagerer ist damit zugange, seine Habseligkeiten zu retten. Außerdem hat der Befehlshaber des Pilgerheeres erst vor ein paar Stunden einer Vereinbarung mit Raymond de Termes zugestimmt, wonach ihm die Festung morgen übergeben werden soll. Zähneknirschend hat der Edelmann aus dem Norden die unverschämten Bedingungen dieses ketzerischen Barons angenommen, welche besagen, ihm seine Ländereien zu lassen, allen freien Abzug zu gewähren und dieses Gemäuer dem Baron so bald als möglich nach Ostern wieder zurückzugeben. So eine Schmach, und das ihm! Nur weil einigen seiner edlen Kampfgefährten der Arsch langsam kalt wird, muss er diesen Teufelsanbeter ungestraft und unbeschadet laufen lassen! – Der Graf spuckt in die schlammige Erde zu seinen Füßen Wer weiß, ob Raymond de Termes sich noch an die Vereinbarung hält, jetzt, wo er doch wieder Wasser hat und ihn der Durst nicht mehr quält.
Auf der Burg dagegen herrscht Festtagsstimmung, da beide Zisternen wieder randvoll mit Wasser gefüllt sind. Der Regen hat das Überleben der Belagerten für weitere zwei Monate gesichert und die unbeschwerte Fröhlichkeit, die alle Bewohner so lange vermisst hatten, scheint zurück. Die schon fast lethargisch gewordenen Frauen sind in eine Geschäftigkeit verfallen, die den Kriegszustand vergessen macht. Es duftet nach frisch Gebackenem, Gebratenem und Gesottenem. Ermessande lässt den Rittersaal für ein Festmahl richten, das Tage andauern soll. Selbst Benoît de Termes ist von der Fröhlichkeit angesteckt und spaßt mit Olivier herum, bis ihn sein siebtes Tagesgebet in die Burgkapelle zieht.
Als wieder nächtliche Ruhe in die Burg eingekehrt ist, strebt auch Ermessande dem Andachtsraum zu. Die dunkle, kühle Kapelle ist im vorderen Teil nur von ein paar Kerzen erleuchtet, die auf einem schmucklosen Steinaltar stehen. Alle Attribute der Kirche Roms, wie Kreuze, Heiligenbilder und Taufbecken sind schon vor Jahrzehnten von ihrem Schwager entfernt worden, der vor dem Altar im diffusen Lichtschein kniet und seine sechzehn Paternoster murmelt.
Ermessande tritt neben ihn und erweist dem Bonhomme ihre Ehrerbietung nach dem katharischen Ritus, dem Melioramentum. Sie beugt ihr Knie, senkt ihr Haupt und spricht: „Benedicite, parcite nobis.“
„Diaus vos benesiga“, erwidert ihr Schwager mit rauer Stimme, aber in freundlichem Ton.
„Benedicite, parcite nobis“, wiederholt Ermessande demütig ihren Gruß und Benoît antwortet auf Okzitan: „Gott segne Euch!“
Ihrem dritten Gruß fügt Ermessande traurig dem Ritus, wie sie vor Zeiten gelernt hatte, hinzu: „Bittet Gott für mich Sünderin, dass er mich zu einer Guten Christin mache und zu einem guten Ende führe!“
„De Diaus las aiatz e de nos. – Von Gott mögt Ihr dies erhalten und von uns. – Was bedrückt Euch, Schwägerin?“
Mit dem gehetzten Blick einer Verzweifelten blickt Ermessande zu ihm auf. „Sagt, habt Ihr denn gar keine Angst vor dem Tod? Ihr wirkt immer ruhig und gelassen. Ich komme fast um vor Furcht! Und doch muss ich für jeden die über alles erhabene Baronin mimen. Unsere Untertanen beobachten mein Verhalten und wenn ich mich hier nicht zusammenreiße, wird die ganze Bevölkerung in Panik ausbrechen! – Und meine Kinder! Wenn ich an die Guten Leute von Minerve denke, die sogar freiwillig ins Feuer gegangen sein sollen ... “
„Ermessande, Ihr sorgt Euch unnötig. Gerade hat es geregnet und wir müssen nicht mehr verdursten. Ihr selbst habt ein Festessen für morgen vorbereiten lassen. Wozu diese Furcht?“
„Trotzdem kann es nicht immer so weiter gehen. Dieser Simon de Montfort ist ein Bluthund, der uns nicht in Ruhe lassen wird. Das glaubt auch Raymond. Er hat mir von der Kapitulationsvereinbarung erzählt. Aber er will sie nicht einhalten, weil er den Kreuzfahrern nicht über den Weg traut. Wenn sie erst einmal Macht über uns ausüben können, wer weiß, was dann geschieht ...“
„Wir haben jetzt noch genügend Vorräte, um über den Winter zu kommen und sitzen in einer warmen, schützenden Burg. Die Kreuzfahrer werden über kurz oder lang aufgeben müssen. Sie können den Winter hier in den Bergen nicht in Zelten überleben“, beruhigt sie Benoît. „Überdies ist es für einen Ritter unüblich, im Winter Krieg zu führen.“
Der Blick der Baronin ist immer noch fieberhaft auf den Katharerdiakon gerichtet. „Was Ihr sagt, klingt glaubhaft. Die Unruhe tief in mir drinnen lässt sich davon jedoch nicht beschwichtigen. Ich fürchte mich vor dem Tod, besonders vor dem Feuer.“
„Ihr seid keine Bonnedame. Ihr braucht das Feuer nicht zu fürchten.“
„Und was geschah mit Eurer Cousine Rixovende? Sie war auch keine Bonnedame, nur eine Anhängerin und Verteidigerin unseres Glaubens. Werden unsere Untertanen nicht den gleichen Heldenmut von mir erwarten?“
„Ermessande, Ihr dürft den bereitwilligen Tod nicht deshalb wählen, weil das Volk ihn vielleicht von Euch erwartet! Der Wunsch muss aus Eurer reinen Seele kommen! Außerdem liegt es nicht im Sinne des Guten Gottes, dass wir einen Märtyrertod sterben. Damit können wir den Auftrag der Weitergabe der reinen Lehre, die uns Jesus gab, nicht vollenden. Dennoch brauchen wir den Tod nicht zu fürchten. Im Gegensatz zu den Katholiken, die glauben, nach dem Tod die Hölle oder mindestens das Fegefeuer zu durchleiden, wissen wir, dass wir alle als gefallene Engel von unserem liebenden Gott erwartet werden. Und wenn wir die entsprechende Reinheit in diesem Leben nicht erreicht haben, so haben wir immer die Möglichkeit wiedergeboren zu werden und im nächsten Leben unsere Seele den Einflüssen des Teufels zu entziehen“, erwidert Benoît mit eindringlicher Stimme.
Ermessande wirkt noch immer niedergeschlagen. „Für den Fall, dass der Tod an mich herantritt, bitte ich Euch um die Convenentia, damit ich auch dann noch in die Gemeinschaft der vollendeten Christen aufgenommen werden kann, wenn ich nicht mehr bei vollem Verstand sein sollte.“
„Diese Bitte gewähre ich Euch gerne, Schwägerin. Und seid unbesorgt wegen Eures Todes. Ein Guter Christ fühlt keinen Schmerz bei der Trennung von seinem fleischlichen Körper. Unser eigentliches Wesen, unsere Seele, die ein Teil des liebenden Gottes ist, stirbt nicht. Das wisst Ihr doch?“
Nachdenklich senkt die Baronin ihren Blick und zieht sich nach einem erneut respektvoll ausgetauschten Gruß und Segen in ihre Gemächer zurück.
Der Rittersaal ist festlich geschmückt und es herrscht fröhliches Treiben, das den Feind vor den Mauern vergessen macht. Wer immer es sich zutraut, versucht sich als Troubadour und die Verse und Melodien spiegeln die Sehnsucht nach der Fin Amour, der reinen Liebe unter den Menschen, wieder. Es werden aber auch deftige Spottlieder auf die Kreuzfahrer zum Besten gegeben. Alle sitzen an einer Tafel zusammen, wie es der katharische Glauben der Gleichheit lehrt: Edelmänner mit Bauern, Ritter mit Knappen und Landsknechten, Damen mit Mägden. Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen. Nachdem die Speisen aufgetragen sind, erhebt sich Benoît de Termes von seinem Stuhl, hüllt eines der duftenden Brote in sein weißes Speisetuch, das niemand, außer ihm, sonst benutzen darf und hält es hoch über die Köpfe der Anwesenden. Alle stehen von ihren Plätzen auf. Ehrfürchtige Stille tritt ein. Der Katharerdiakon spricht das „Vaterunser“. Die wenigen Burgbewohner, die schon durch das Consolamentum zur Gemeinschaft der Vollkommenen gehören, stimmen mit ein, während die Übrigen das Haupt senken und andächtig zuhören. Zum Abschluss der gemeinsamen Andacht segnet Benoît das Brot mit den Worten: „Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit uns!“ Daraufhin teilt er das Brot in zwei Teile und reicht einen zu seiner linken an seinen Bruder und den anderen zu seiner rechten Seite weiter, auf dass sich jeder an der Tafel davon nehmen könne. Bald herrscht erneut lockere Feststimmung und das Stimmengewirr von schwatzenden, glücklichen Menschen erfüllt den Saal. Ein opulentes Mahl beginnt, das jedem bietet, was immer sein Herz begehrt. Es wird Weinsuppe mit Eiern und Gewürzen aufgetragen, in der Buttergebäck schwimmt, gekochte fette Hühnchen, Pasteten von Ringeltauben und von Lerchen, mit Ingwer und Kastanien gefüllte Schweinebraten, in der Pfanne gebackene Krapfen mit Eingesottenem bestrichen, in Milch gesottene Rüben, die in der Schüssel mit Speck angerichtet sind und schließlich süßer Haferbrei mit gekochtem Trockenobst und Nüssen.
„Benoît!“, ruft ein Ritter von seinem Platz weiter hinten im Saal. „Erzählt uns doch noch einmal von dem Disput in Montréal, den Ihr vor drei Jahren mit diesem rothaarigen, katholischen Wanderprediger aus Spanien geführt habt. – Wie hieß er doch gleich? ...“
„Dominikus Guzman!“, ruft ein anderer.
Der Bonhomme nickt, unterbricht sein karges, fleischloses Mahl, erhebt sich von seinem Platz und beginnt mit seiner rauen Stimme zu erzählen: „Ich fand mich als Abgeordneter der Katharer zusammen mit Guilhabert de Castres, Arnaud Hot und anderen Vollkommenen in Montréal ein. Wir wurden dort von zwei Legaten des Papstes erwartet, von denen der eine, der inzwischen von Seinesgleichen erschlagene Pierre de Castelnau, dessen Ermordung der Papst unserem Grafen als Vorwand für diesen Krieg unterschiebt, sogleich ein Streitgespräch mit uns begann Er versuchte natürlich unser Seelenheil zu retten und uns in den Schoß der römischen Kirche zurückzuführen. Am nächsten Tag sollte der öffentliche Disput in der Burg stattfinden und ich glaube, die beiden Legaten waren recht froh, noch Verstärkung durch den Bischof von Osma und seinen Unterprior, den besagten Dominikus Guzman, zu bekommen.“
Benoît kann sich bei seiner Rede ein verschmitztes Grienen nicht verkneifen, das von seinen begeisterten Zuhörern sofort aufgegriffen wird und die schon belustigte Stimmung hebt. Der Bonhomme fährt mit seiner Erzählung fort: „Die Katholiken brauchten tatsächlich etwas Unterstützung, denn das Publikum im Saal war ihnen wenig freundlich gesonnen. Der Legat Pierre de Castelnau hat zwar den Disput offiziell geleitet, aber dieser hitzige Dominikus, der Rangniedrigste von allen, war der eigentliche Rädelsführer. Wir fochten in heftigen Wortduellen mit ihm. Er versuchte uns immer wieder in Widersprüche zu verwickeln und die Legaten machten sich über uns lustig, wir wären des Lateinischen nicht mächtig und könnten deshalb unmöglich als geistige Führer einer Gemeinde vorstehen. Sie dachten, wir wären darum nicht bibelfest, aber wir belehrten sie eines Besseren. Wir studieren schließlich nicht die lateinisch abgefasste Bibel der römischen Kirche, die doch nur nach deren Nutzen verfälscht ist und die Lehre Jesu so verdreht darstellt, wie es dem Papst gerade gefällt. Wir haben, wie ihr alle wisst, schon seit Jahrzehnten unsere eigene Bibel, die getreu Gottes Wort in Okzitan übersetzt wurde. So konnten wir die Eiferer Lügen strafen!“ – Unter lauten Beifallsbekundungen der Anwesenden setzt Benoît, von Begeisterung ergriffen, seinen Vortrag fort: „Diese katholischen Kirchenmänner, besonders dieser Dominikus, haben kein Benehmen! Obwohl sie Maria zu einer Muttergöttin erhoben haben, kennen sie keinen Respekt vor Frauen! Die Schwester des Grafen nämlich, Esclarmonde de Foix, die als eine Bonnedame unserer Gemeinschaft die Anschuldigungen und haarsträubenden Glaubensansichten der Katholiken mit einem Einwand niederschmettern wollte, wurde von einem Gehilfen Guzmans mit den Worten: ‚Gehen Sie spinnen, Madame! Es ist nicht in Ordnung, dass Sie in einer solchen Debatte derart sprechen!’ barsch zurechtgewiesen und erniedrigt!“
Im Rittersaal ertönen auf diese Worte entrüstete Ausrufe. Der Bonhomme beschwichtigt jedoch die Anwesenden mit Handzeichen und erzählt weiter: „Die Zuhörer in Montréal waren genau so entsetzt wie ihr jetzt. Es war natürlich einer aus dem Norden, der unser edles Benehmen nicht gelernt hat!“
Nachdem sich das Geraune unter den Bewohnern von Termes gelegt hat, ruft ein anderer Edelmann nach vorne: „Erzählt von dem Wunder!“
Andere stimmen der Aufforderung zu und Benoît lässt sich nicht lange bitten. „Ja, das Wunder von Fanjeaux! Es war wirklich ein Wink Gottes, den die Katholiken aber nicht anerkennen wollen! Dabei haben sie selbst es heraufbeschworen!“
„Erzählt!“ „Ja, erzählt schon!“ ertönen die Rufe aus dem Saal.
„Während ebendieser Konferenz fertigte jede der Diskussionsparteien ein Pergament an, auf dem wir unsere Glaubensgrundsätze niederschrieben. Da wir mit den Katholischen nicht übereinkommen konnten und sich unsere Differenzen nicht beilegen ließen, verlangte Dominikus nach einem Gottesurteil, das den wahren Glauben bestätigen sollte. – Als ob Gott sich durch das Element des Teufels beweisen würde! – Das Pergament, das die Wahrheit beinhalte, solle bei diesem Ordal im göttlichen Feuer unversehrt liegen bleiben. Wir warfen also die Niederschriften ins Feuer. Unser Schriftstück blieb liegen und verbrannte. Das der Katholiken fing auch Feuer. Es wurde sogar aus den Flammen empor geschleudert und verkohlte einen Deckenbalken und zwar genau an der Stelle, an der er ihr ach so heiliges Kreuz bildet!“
Gejohle und höhnische Ausrufe der Belagerten schallen durch die Tischreihen im Saal und Benoît lässt sie mit selbstgefälligem Lächeln gewähren.
„Damit ist der von den Katholiken geforderte Beweis für die Irrsinnigkeit ihrer Kreuzverehrung doch erbracht!“ ruft jemand.
„Das dachte ich auch! Jedoch versteht die römische Satanskirche, wie wir an den überall entzündeten Scheiterhaufen sehen können, immer noch nicht, dass weder Feuer noch Kreuz heilbringend und gottgewollt sind“, ruft der Bonhomme zurück. „Die Schiedsrichter haben sich trotz dieses Zeichens geweigert, einen Sieger zu verkünden!“
Ein Troubadour greift die Geschichte auf, fasst sie in Verse und singt ein Spottlied auf den Papst, dessen Kehrvers von den belustigten Burgbewohnern lachend mitgegrölt wird, während noch eine Menge Wein fließt und der Tag zur Neige geht.
Flucht
22. November 1210
Raymond geht langsam den hölzernen Wehrgang ent-lang und überprüft, immer wieder die Bewegungen der Truppen Simon de Montforts unten am Berg beobachtend, die Mauern seiner Festung. Wut und Resignation vereinen sich in seinem Gesicht, wenn seine Augen über den Rand der Brüstung die steil abfallende Felswand hinunter zu den Zelten und Feuern seiner Feinde blicken, die sich unter den spärlichen Laubdächern an der Baumgrenze verstecken. Den starken Mauern von Termes konnten die Kreuzfahrer trotz ihrer gut postierten Belagerungsmaschinerie und großen Katapulten nichts an-haben. Und wenn doch, so haben Raymonds Gefolgsleute den Schaden immer wieder schnell beheben können. Nun aber beginnt sich die Zahl seiner tatkräftigen Getreuen rapide zu verringen. Die Ruhr breitet sich seit ein paar Tagen aus und lähmt den Lebensmut der Burgbewohner. Soweit Raymond feststellen konnte, hat auch die Truppenstärke seines Feindes merklich abgenommen. Doch wohl weniger durch Entbehrungen und Krankheit als durch den Ablauf der päpstlich angeordneten Dienstzeit bei der Kreuzfahrerarmee. Nach vierzig Tagen können die, denen es einzig um den versprochenen Sündenerlass und ihre Pflichterfüllung gegenüber dem Papst geht, die Waffen niederlegen und sich auf ihre Ländereien zurückziehen, die sie als weltliche Belohnung im Kampf gegen die Ketzer erworben haben. Aber Simon de Montfort dürfte es, wie bisher, nicht schwer fallen, neue kampfbereite Männer zu finden, die ihr Ansehen vor der Kirche und ihr Vermögen mehren wollen. Er ist ja nicht von der Außenwelt abgeschnitten.
Raymond trifft auf einen seiner Posten, klopft ihm auf die Schulter und sucht seinen Blick. Die Augen des Mannes sind klar und wach. Das Fieber hat ihn noch nicht ergriffen.
„Wie geht’s, Joan?“
„Danke, Monsénher, gut“, antwortet der junge Ritter sichtlich erfreut. Die Belagerung hatte seine Erhebung in den Ritterstand beschleunigt. Als kleiner Junge ist er vor Jahren auf die Festung Termes gekommen, um als Knappe in die Dienste des Barons zu treten. Er dient ihm gerne und mit Stolz. Der Baron ist ein gerechter Herr, der alle seine Untergebenen mit Respekt behandelt und die okzitanischen Werte beispielhaft vorlebt. Er liebt und verehrt ihn darum, wie seinen eigenen Vater.
Ein einzelner Pfeil fliegt surrend an der Schulter des Burgherrn vorbei, der einen kurzen Moment nicht auf seine Deckung geachtet hat. In noch tiefer gebückte Haltung gezwungen, macht er seinem Unmut darüber aufbrausend Luft und ballt die Fäuste.
„Na truissa – Widerwärtige Drecksau! Seit nunmehr vier Monaten belagert dieser Bastard von einem Franzosen mit seinen Männern, die nichts anderes sind, als vom Papst gedungene Mörder, mein Land und brandschatzt meine Dörfer! Ich habe sie satt, diese stinkenden Kreuzfahrer! Sie verpesten die Luft, die ich atme“, stößt Raymond aus und setzt seinen Rundgang weiter vor sich hin fluchend fort.
Der nächste Wachposten, auf den er trifft, sieht erschöpfter aus als Joan. Auf Raymonds Nachfrage versichert ihm der Mann jedoch, dass es mangelnder Schlaf und nicht die Krankheit sei, die seinen Körper schwächt. Wenig beruhigt steigt der Baron die steile Treppe vom Wehrgang in den Zwinger hinunter. Er kann und will jetzt nicht mehr länger aufschieben, was er schon vor einiger Zeit insgeheim beschlossen hat. Mit weit ausholenden Schritten eilt er die felsige Bergkuppe hoch in Richtung des Donjon, um seine Gemahlin darauf vorzubereiten. Die starke Steigung kann ihn in seiner mit Angst gepaarten Verärgerung kaum bremsen. Er reißt die schwere Holztür auf und ruft in den dahinter liegenden großen Saal hinein: „Wir werden Termes aufgeben, Ermessande! Es hat keinen Sinn mehr! Der Blutdurchfall greift unter den Leuten immer mehr um sich und es wird nicht mehr lange dauern, dann trifft es auch uns. Gehen wir, solange wir noch Kraft haben. Pack’ alles Nötige zusammen. Heute Nacht brechen wir auf!“
Ermessande ist wie erstarrt. Sie lässt ihre Stickerei sinken, mit der sie sich seit Wochen die trüben Gedanken vertreibt und schaut ihren Ehemann ungläubig an.
„Was hast du gerade gesagt? Du gibst auf? Ist Montfort schon im Castèl?“
Raymonde, die etwas verloren im Raum stand und ihre Eltern beobachtete, stürmt bei dieser letzten Frage ihrer Mutter verängstigt auf Ihren Vater zu, umschlingt seine kräftige Leibesmitte und schluchzt: „Mon Paire, müssen wir jetzt sterben?“
Ebenso von den harschen Worten des atemlosen Barons und dem Weinen des Mädchens erschreckt, springt auch eine Kammerfrau jäh von ihrer Sitzbank nahe dem Fenster auf und erstickt ihren entsetzten Schrei hinter vorgehaltenen Händen. Olivier, der sich still in der gegenüberliegenden Ecke des Raumes von seinem Spiel erhoben hat, betrachtet die Szenerie für einen Moment fassungslos. Dann tritt er ruhig zu seiner Mutter. Er fasst ihre Hand und drückt sie ganz fest. Nun erst wird Ermessande ihre ernste Lage und die Gefahr für Leib und Leben bewusst. Nein, sie will jetzt nicht mehr, dass Raymond die Burg aufgibt! Sie bereut ihr Drängen in den vergangenen Wochen. Mit großen, flehenden Augen sieht sie zu ihrem Gemahl auf, der die erlösenden Worte mit beschwichtigender Stimme spricht: „Wir werden nicht sterben! Montfort liegt immer noch vor den Mauern und kann nicht herein.“
„Warum willst du dann gehen?“
Raymond blickt Ermessande erstaunt an. „Woher dein Gesinnungswandel? Wolltest du dies nicht die ganze Zeit? Jetzt befolge ich deinen Rat und es ist dir wieder nicht recht?“
„Es tut mir leid, dich so bedrängt zu haben. Ich habe eingesehen, dass ein Verlassen der Burg Wahnsinn ist. Warum willst du es jetzt doch tun?“, fleht sie nun.
„Du weißt es selbst. Der Geruch der Pestilenz hängt in der Luft. Viele unserer Leute liegen im Sterben. Es ist nur eine Frage der Zeit und auch unsere eigenen Kinder werden krank.“, argumentiert er beinahe gelassen.
„Denkst du, Montfort wird uns ziehen lassen, wenn wir das Castèl aufgeben? Du erleichterst ihm die Sache nur!“, hält sie ihm sein einst eigenes Gegenargument vor.
„Nein, Ermessande. Es gibt einen Ausweg, von dem außer mir und Benoît keiner weiß: Einen Geheimgang, der durch den Berg in die dunkle Schlucht im Norden führt. Ich beobachte die Truppen Montforts schon seit Wochen. Endlich hat der seine Kreuzfahrer auf die entgegengesetzte Seite des Berges konzentriert. Es halten sich nur noch wenige feindliche Söldner in der Nähe des Tales auf, in welchem sich der Ausgang befindet. Bis zur Stunde haben sie ihn noch nicht entdeckt.“
Ermessande lässt ihren Blick über die Kinder schweifen. Den beiden Großen huschen Schatten der Furcht über ihre Gesichter. Die Kleinen wissen noch nichts von den Gefahren der Welt. Der dreijährige Bernard spielt auf dem Boden mit Holzklötzchen und Blanche schlummert friedlich in ihrer Wiege. Trotz der greifbar nahen Freiheit fällt es Ermessande schwer, die Burg zu verlassen, die nach dem frühen Tod ihrer Eltern ihr Heim geworden ist und ihnen in den letzten Monaten sicheren Schutz geboten hat. Wenn diese Mauern, die doch weit und breit als die starke und uneinnehmbare Festung der Barone von Termes gerühmt werden, sie nicht mehr vor den Kreuzfahrern schützen können, wo sollen sie sich dann in Sicherheit bringen?
Raymond kann die ängstlichen Gedanken aus den Gesichtszügen seiner Gemahlin erraten und nimmt sie wortlos in den Arm. Sie legt ihren Kopf auf seine Brust. Nach mehr als dreizehn Ehejahren fühlt sie sich ihm zum ersten Mal richtig nahe. Auch er geht mit bleischwerem Herzen. Schließlich überlässt er den Stammsitz seiner Vorfahren diesem verhassten Simon de Montfort und er wird seine Familie nie mehr wiedersehen, wenn sein nur Benoît bis ins Letzte bekannter Plan so endet, wie er befürchtet. Bei diesen Überlegungen möchte Raymond seinen Entschluss am liebsten wieder rückgängig machen. Er umschlingt seine Frau noch fester und nimmt auch seinen Sohn Olivier und seine Tochter Raymonde in die Umarmung mit auf. Ein paar Wimpernschläge lang stehen sie so aneinandergeschmiegt beisammen, bis Ermessande den Kreis auflöst und fragt: „Was wird aus den Kranken?“
Stockend antwortet der Baron seiner Gemahlin, während er sich zur Tür wendet: „So schwer es mir fällt, meine Getreuen allein zu lassen: sie sind bereits dem Tod geweiht. Die meisten haben schon das Consolamentum empfangen und die Endura begonnen. Für sie wird Montfort die Erlösung sein.“
Von diesem offen Ausgesprochenen getroffen beginnt eine der Edeldamen im Raum zu schluchzen, denn auch ihr Gemahl liegt seit gestern auf dem Krankenbett. Mit einem betrübten Blick auf die verzweifelte Frau verlässt Raymond den Saal. Er kennt ihren Mann. Es ist sein bester Freund, der Ritter Guillem de Roquefort.
Olivier fühlt die hilflose Verzweiflung der Erwachsenen und kann dennoch nicht recht fassen, was er gerade gehört hat. Wortlos eilt er seinem niedergeschlagenen Vater nach.
Tröstend tritt Ermessande derweil zu der laut klagenden Alazais und redet ihr sanft zu. Sie weiß, wie es um Guillem steht. Erst heute Morgen hat sie ihr bei seiner Pflege geholfen. Sie mag die beiden und weiß, wie sehr die Edeldame ihren Gatten liebt. Und noch etwas verbindet sie mit ihr: Sie ist etwa im gleichen Alter und auch sie kommt aus der Gegend von Vallespir im Königreich Aragon. „Raymonde, bitte bleib’ hier bei deinen kleinen Geschwistern und packe soviel von euren Sachen zusammen, wie du und Olivier tragen könnt. Ich gehe mit Alazais noch einmal zu den Kranken“, weist Ermessande ihre Tochter an und schiebt die weinende Frau nach draußen.
Auf Anordnung des Barons hat man alle mit der Ruhr infizierten Burgbewohner in dem großen, luftigen Mannschaftssaal an der südöstlichen Ecke der äußeren Festungsmauer einquartiert, um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu unterbinden. Etwa zwei Dutzend Menschen auf leinenbespannten Bahren, vorwiegend Männer, verteilen sich über den Raum. Vorhänge aus weißem Linnen trennen die Krankenlager voneinander ab. Alazais lässt sich kaum beruhigen. Auch nicht von ihrem Mann, dem sie schluchzend die Entscheidung des Barons mitteilt. Guillem ist fiebrig und leidet offensichtlich an starken Krämpfen. Die Baronin versucht, ihm etwas warmen Kräuteraufguss mit aufgeweichtem Brot einzuflößen. Doch mit jedem Krampfanfall scheidet er die spärliche Nahrung wieder aus. Der Blutdurchfall hat seinen im Kampf gestählten Körper schon so weit geschwächt, dass er wie die anderen im Saal kaum noch in der Lage ist, seine Notdurft in dem etwa einhundert Schritte entfernten Latrinenraum zu verrichten. Immer wieder müssen von Angehörigen und Mägden die Laken gewechselt, die Körper gewaschen und die Töpfe mit dem blutigen, eitrigen Kot nach draußen gebracht werden. Über dem ganzen Raum liegt ein süßlicher Gestank. Zu den Schmerzen kommt die Scham, die die Kranken quält. Guillem sind die helfenden Hände der Baronin äußerst unangenehm und so überlässt sie ihn ganz der Pflege seiner Gemahlin.
Ermessande geht zur nächsten Krankenzelle. Hinter dem Vorhang hört sie die leise flüsternde Stimme ihres Schwagers Benoît. Beim Eintreten in die Zelle findet sie ihn vor dem Lager des Schmiedes aus der Siedlung im Tal vor, der wie alle Dorfbewohner kurz vor der Belagerung durch Simon de Montfort hier innerhalb der Festung mit seiner großen Familie Schutz gesucht hat. Der massige, schwitzende Körper des Schmiedes auf dem Krankenlager bietet sowohl ein groteskes als auch ein beängstigendes Bild neben der geschmeidigen, weißgekleideten Gestalt des Vollkommenen. Obwohl die Zelle übervoll mit Familienangehörigen des Kranken ist, rücken die Leute bereitwillig zusammen, um ihrer Herrin einen angemessenen Platz neben ihrem Schwager anbieten zu können und den Katharerdiakon vor der Verlegenheit zu bewahren, mit dem Körper einer Frau in Berührung zu kommen. Ermessande begrüßt den Bonhomme demütig, der mit seinem Segen antwortet. Sie wiederholt ihren Gruß wie üblich noch zweimal und Benoît erwidert: „Gott sei gebeten, dass er Euch zu einer Guten Christin mache!“
Dann wendet sich der Bonhomme wieder dem kranken Schmied zu. „Wünscht Ihr das Consolamentum, die Tröstung, zu empfangen, um dem ewigen Kreis der Wiedergeburt zu entrinnen und in die Gemeinschaft der vollendeten Katharer eingehen zu können?“
„Ja, ich will“, flüstert die schwache Stimme des Kranken.
„Widersagt Ihr somit dem Teufel und seiner weltlichen Schöpfung, allem Sichtbaren und Vergänglichen, wie dem Fleisch?“
„Ja, ich widersage.“
„Wollt Ihr nun Eure Seele, die wie alles vom Guten Gott Geschaffene ewig und unsichtbar ist, in seine Hände geben? Und erklärt Ihr, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr diese gereinigte Seele nicht wieder mit Irdischem beschmutzt?“
„Ja, ich will.“
Feierlich legt Benoît dem Kranken daraufhin sein Buch mit dem Johannes-Evangelium auf das Haupt und spricht: „Dann übergebe ich Euch das Gebet unseres Herrn, das Ihr von nun an als reines Mitglied der katharischen Gemeinschaft sprechen dürft: Pater noster, ...“
Ermessande folgt den inbrünstig gesprochenen Worten ihres Schwagers nicht mehr. Sie ist in Gedanken bei der von ihrem Gemahl geplanten Flucht. Wieso hatte sie ihm nur immer mit dieser verrückten Idee in den Ohren gelegen? Was wird jetzt aus ihnen werden? Es ist November. Die Nächte sind empfindlich kalt und für die beiden Kleinen ist diese Flucht lebensgefährlich!
Unterdessen hat Benoît den Weiheritus des Consolamentums mit der segnenden Handauflegung beendet und verabschiedet sich von den demütig verneigenden Angehörigen, um seinen Weg durch die Zellen der Kranken fortzusetzen.
Noch ganz benommen von den sich überstürzenden Ereignissen wendet sich Ermessande wieder Alazais und Guillem zu. Inzwischen konnte der Ritter seine Frau davon überzeugen, die Burg zu verlassen. Alazais weint noch immer und ihre Augen sind rot und verquollen. Sie halten sich die Hände und sehen sich wortlos an. Die Vorstellung einer Trennung des Paares scheint unmöglich. Da richtet Guillem an die Baronin das Wort und bittet: „Dame Ermessande, senden Sie uns den Bonhomme. Auch ich möchte das Consolamentum empfangen und in die Herrlichkeit des Guten Gottes eingehen. – Und bitte kümmern sie sich nach Ihrer Flucht um meine Alazais. Sie will fortan ihr Leben als Vollkommene führen und möchte Novizin bei einer Bonnedame werden.“