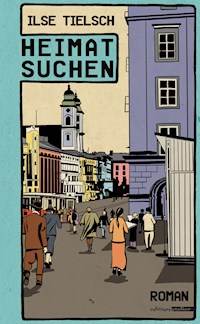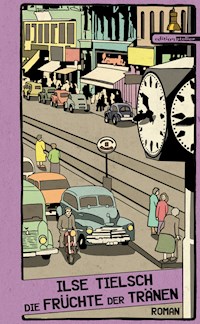
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Anni lebt mit ihrem Mann Bernhard inmitten der Aufbruchsstimmung der 1950er-Jahre. Sie studiert und arbeitet nebenbei in einer Buchhandlung, abends feiern sie mit ihren Freunden in der kleinen Wohnung ausgelassene Feste. Sie alle haben den Krieg und die Flucht aus Mähren durchgestanden, aber sie leben in der Gegenwart, fest dazu entschlossen, das Leben zu genießen. Ilse Tielsch zeigt den Neubeginn und den Wiederaufbau in den 1950er-Jahren inmitten der zeitgeschichtlichen Ereignisse und Entwicklungen, mit denen die Menschen konfrontiert waren. Die aufkeimende Hoffnung in der Zeit des Wirtschaftswunders auf eine neue, bessere Welt wird 1956 jäh von der Niederschlagung des Ungarnaufstands durchbrochen. Und es kommen neue Verjagte, neue Flüchtlinge, wieder Menschen, die ihre Heimat verloren haben ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ILSE TIELSCH
DIE FRÜCHTEDER TRÄNEN
ROMAN
Für RUDOLF,unsere KinderSTEFAN und CORNELIAund unseren EnkelBERNHARD
Wozu erinnerst du dich?Leb jetzt! Leb jetzt!Aber ich erinnere mich doch nur,um jetzt zu leben.
ELIAS CANETTI
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Nachts, wenn es dunkel ist, klingen die Stimmen fremd, auch jene, die es nicht sein dürften.
Judith ist tot, sagte die Stimme.
Die Hand hielt den Telefonhörer umklammert, die Bakelitmuschel lag kalt am Ohr. Es war kein Licht im Zimmer, nur der schwache Schein der Straßenbeleuchtung hing in den Vorhängen, und vom Herbstwind bewegte Baumzweige warfen zitternde Schatten. Die Stimme sprach in abgerissenen Sätzen, sie berichtete und versuchte zu erklären, was sich nicht erklären ließ, sprach Vermutungen aus, die, später von anderen ergänzt, dennoch Vermutungen bleiben würden. Tote wehren sich nicht, sie stellen nicht richtig, sie beantworten keine Fragen. Tote verteidigen sich nicht, beschuldigen niemanden, und sie weinen nicht mehr. Tote sind IN EINER ANDEREN WELT, aber Judith war plötzlich in meinem Zimmer, sie löste sich aus dem Schatten und nahm Farben an, ihre helle Haut, ihre graublauen Augen, ihr dunkles Haar, lockig abstehend vom Kinderkopf, lang auf Schultern und Rücken fallend, wie sie es als Fünfzehnjährige getragen hat.
Während die fremd gewordene Stimme sprach, erschienen Bilder.
Judith, die geschickteste Ballspielerin auf dem Schulhof, BALL ÜBER DIE SCHNUR, Judith im knappen Badeanzug auf dem Sprungbrett des neuen Schwimmbades in der Stadt, in der wir das Gymnasium besuchten, ein braun gebrannter Mädchenkörper, der viele Blicke auf sich zog, die beste Schwimmerin unseres Alters, Klassenbeste in Mathematik und Latein. Judith, über ihre Geige gebeugt im Schulorchester, schön an ihrem fünfzehnten Geburtstag im neuen, blau-weiß gemusterten Kleid. Judith, die überall Mittelpunkt war, wohin sie kam, auch später in Wien, als sie wieder unter uns lebte und wir ausgingen und uns mit Freunden trafen. Dann kein Bild mehr, nur einmal ein Zeitungsfoto, von dem wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob es sie wirklich darstellt. Erst später jene Schwarzweißfotografie, auf der sie als Braut zu sehen ist, schüchtern lächelnd und fremd, an die Schulter eines jungen Mannes gelehnt, dessen Blick entschlossen auf etwas gerichtet ist, das wahrscheinlich ZUKUNFT bedeutet hat.
Das Begräbnis ist Mittwoch, sagte Christians fremd klingende Stimme, hoffentlich wird es dir möglich sein, zu kommen.
Die Bilder verschwammen im Dunkel, ich sah nur noch jenes eine, das ich von der Fotografie her kannte, die ich seither oft betrachtet hatte. In Judiths Gesicht floß mit einemmal vieles von dem zusammen, was wir damals dachten und waren, es stand symbolhaft für unsere jungen Jahre.
Das Wort JUGEND zwang sich mir auf, eigentlich war es mehr ein Gefühl als ein Wort, eine Art sanfter Schmerz.
Natürlich werde ich kommen, sagte ich.
1
Wir nehmen, wenn es uns möglich ist, an der Beerdigung teil, wenn jemand aus unserer Gegend gestorben ist, auch wenn wir nicht mit ihm verwandt oder näher befreundet gewesen sind. Wir drücken den Angehörigen die Hand, sagen ihnen teilnehmende Worte und nennen unsere Namen, die ja auch die Namen der Eltern und der Großeltern gewesen sind, damit sie die Stelle in ihrer Erinnerung finden, in die sie uns einbringen können. Die Geistlichen flechten in ihre Ansprachen Sätze über den Verlust der Heimat und über das schwere Schicksal des Verstorbenen ein, vergessen nicht, darauf hinzuweisen, daß er hier, wo er nun schon seit so vielen Jahren lebte, eine zweite Heimat gefunden hatte, ehe sie auf das verheißene Wiedersehen in der ewigen Heimat hinweisen. Wir gehen dann mit im Zug der Trauernden, werfen Erde ins offene Grab, es kommt vor, daß einer der Alten ein winziges Säckchen aus der Tasche zieht und es über dem Sarg entleert, von einer Reise mitgebrachte Erde aus Böhmen, aus Mähren, aus dem Adler-, dem Riesen-, dem Altvatergebirge, Erde aus dem Schönhengstgau, aus dem Egerland, aus dem südmährischen Hügelland. Muß der Verstorbene schon in fremder Erde ruhen, dann soll doch ein Stäubchen Heimaterde um ihn sein. Es kommt auch vor, daß einer der Alten nicht den ganzen Inhalt eines solchen Säckchens auf den Sarg streut, sondern ihm nur einen Teil der Erde entnimmt, das Säckchen wieder verschließt und in die Tasche zurücksteckt. Den verbliebenen Rest bewahrt er für seine eigene Beerdigung auf. Die Erde der neuen Heimat bleibt fremd für die Toten, die darin begraben werden, fremder als jene, in der schon die Eltern und Großeltern ruhen, vielleicht schon deren Vorfahren, zurück über mehrere hundert Jahre.
Ein Stück Heimat verläßt uns mit jedem, der stirbt, dies ist einer der Gründe dafür, daß wir manchmal viele Kilometer weit fahren, um einen Verwandten auf seinem letzten Weg zu begleiten. Daß wir einander bei solchen Anlässen wiedersehen, ist ein weiterer Grund dafür. Wir sitzen dann beisammen und sprechen von lange vergangenen Zeiten, wir berichten einander von unserem Leben, sprechen auch von Leuten aus unserer Gegend, die nicht gekommen sind oder nicht kommen konnten, von denen wir jedoch wissen, wo sie leben und wie es ihnen ergangen ist. Kommt bei einer solchen Gelegenheit jemand, den wir lange nicht gesehen haben, dahin, wo wir selbst jetzt leben, dann laden wir ihn ein, bei uns zu übernachten, wir nehmen ihn auf, stellen ihm unsere Kinder vor, wir kramen in Schubladen und Schränken nach alten Fotografien, nach Bildern von Schulschlußfeiern, Ausflügen, Sportveranstaltungen oder Sommerfesten, auf denen wir selbst als Kinder oder junge Leute zu sehen sind, meist sind es kleine, oft schon abgegriffene Schwarzweißfotografien, die wir durch Zufall gerettet haben oder die uns von anderen, die sie besaßen, geschenkt worden sind. Manchmal finden sich Gruppenaufnahmen in Fotoalben oder unter den Papieren verstorbener Verwandter, dann nehmen wir sie an uns, notieren nach und nach die Namen der Abgebildeten auf der Rückseite, weil wir die Lücken der Erinnerung erst im Lauf der Jahre und mit Hilfe anderer zu füllen vermögen. Wir hüten diese alten Fotografien, auch jene, auf denen nicht Menschen, sondern Landschaften abgebildet sind, die uns vertraut waren, Häuser, in denen wir gewohnt, Dörfer und Städte, in denen wir als Kinder gelebt haben. Wir lassen Reproduktionen anfertigen und tauschen sie untereinander aus. Der Prozeß der Veränderung ist uns bewußt, der dort, wo wir herkommen, wie überall abgelaufen ist, in solchen Stunden jedoch überspringen wir die Jahrzehnte, als wären sie nicht gewesen. Dies ist unser Dorf, unsere Stadt, unsere Kirche, unsere Schule, auch wenn es das Dorf, die Kirche, die Schule schon längst nicht mehr gibt, dies ist der Spielplatz, dies ist das Haustor, durch das wir täglich eingetreten sind, dies ist unser Weinberg, unsere Scheune, unser Weizenfeld. Wir kramen in Erinnerungen, wir sitzen bis spät nachts beisammen und erzählen einander Geschichten, und weil der Verstorbene ja aus derselben Gegend stammte, wie wir selbst, ist er bei solchen Gesprächen dabei.
Auch bei anderen Anlässen, bei denen wir einander begegnen, zum Beispiel bei Heimattreffen, werden Geschichten erzählt, die wir mitnehmen und die uns im Gedächtnis bleiben, wie zum Beispiel jene des alten Schmieds von Mühlfraun.
2
Als man dem alten Schmied von Mühlfraun bei Znaim mitgeteilt hatte, daß er die Heimat verlassen müsse, sperrte er das Tor seiner Schmiede ab und machte sich auf den Weg nach Westen. Er war zu diesem Zeitpunkt achtundachtzig Jahre alt und noch rüstig, seine Beine waren gesund, und er wußte über die Himmelsrichtungen Bescheid. Den Norden dachte er sich zu kalt, daher kam er nicht in Betracht, der Süden schien ihm in seiner Vorstellung von den Landstrichen jenseits des Äquators zu heiß, im Osten lag Rußland, dorthin wollte er nicht. Es blieb nur die westliche Richtung, und diese schlug er ein.
Er wollte nach Amerika, sagt sein Enkel, er hatte in seiner Jugend mehrere Leute gekannt, die dorthin ausgewandert waren, und man hörte später, es ginge ihnen sehr gut. Vielleicht hatte er selbst zu jenem Zeitpunkt einmal an eine Auswanderung gedacht. Vielleicht hatte er auch die Hoffnung gehabt, jenseits des großen Ozeans seinen ältesten Sohn wiederzufinden, der schon zu Beginn des Jahrhunderts, als blutjunger Mensch, dorthin gezogen war, um sein Glück zu versuchen, daß dieser Sohn schon 1936 verstorben war, hatte er niemals wirklich geglaubt, oder er hatte es vergessen.
Wahrscheinlich hatte der alte Schmied von Mühlfraun keine konkreten Vorstellungen davon, wie weit es von seinem Dorf bis Amerika war, und wahrscheinlich unternahm er auch nicht einmal den Versuch, sich diese Entfernung auch nur annähernd vorzustellen. Man zwang ihn, von allem wegzugehen, was er geliebt und besessen hatte, nun brauchte er einen Ort, an dem es sich anzukommen lohnte, an dem er bleiben würde, bis man ihm erlaubte, in die Heimat zurückzukehren, Amerika schien ihm dieser Ort zu sein.
Er ging also von seinem Anwesen weg, immer der untergehenden Sonne entgegen, er hatte sich diese Tageszeit, der Orientierung wegen, ausgesucht, und ein Blick auf die Landkarten gibt ihm recht. Immerhin kommt man, wenn man geradeaus und querfeldein geht und wenn man sich nur einigermaßen an die Himmelsrichtung hält, von Mühlfraun über Alt Edelspitz, nördlich an Deutsch Konitz und Poppitz vorbei, über Raabs, Straubing, Pforzheim, Paris an die Küste und nach Überquerung des Atlantischen Ozeans nach Neufundland, hält man sich auf dem Großen Wasser südwestlich, gelingt die Ankunft vielleicht sogar direkt in New York. Hindernisse wie hohe Gebirge und Flüsse sowie die Tatsache, daß auch die kleinen Straßen und Wege nicht immer in die gewünschte Richtung laufen, sind in dieser Überlegung allerdings nicht enthalten. Umwege werden notwendig gewesen sein, aber täglich ging ja die Sonne in derselben Richtung unter, man weiß, daß der Frühling des Jahres 1945 ein prächtiger Frühling gewesen ist, in dem sie fast ununterbrochen vom wolkenlosen Himmel schien, und immer wird der alte Mann ja auch nicht gewandert sein.
Der alte Schmied verließ das Dorf Mühlfraun in einem Augenblick, in dem niemand auf ihn achten konnte, man suchte nach ihm, so gut es in jenen schrecklichen Tagen überhaupt möglich war, man gab später Suchanzeigen an die dafür zuständigen Stellen auf, alle Bemühungen blieben erfolglos, schließlich hielt man, so sagt sein Enkel, den Großvater für tot. Es gab sehr viele Tote in jenen Wochen und Monaten, Greise und Kinder, das ist bekannt. Ein Achtundachtzigjähriger, den man aus seiner Heimat vertrieben hatte, ein Mensch also, der aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr lange zu leben gehabt hätte, konnte, bei den Zuständen, die damals herrschten, und in der Verwirrung seines Schmerzes, das jedenfalls glaubte man annehmen zu müssen, nicht weit gekommen sein. Man trauerte um den Großvater, den man nicht lebend wiedersehen würde, noch dann, als man selbst aus der Heimat vertrieben und irgendwo in Deutschland angekommen war, man resignierte eines Tages und gab keine Suchanzeigen mehr auf.
Inzwischen wanderte der alte Mann der österreichischen Grenze entgegen, überschritt sie irgendwo zwischen Feldern, durchquerte das nördliche Niederösterreich, passierte wiederum eine Grenze und ging auf den Böhmerwald zu. Da und dort nahm man ihn auf, gab ihm eine Kleinigkeit zu essen, obwohl man selbst nicht viel hatte, erlaubte ihm, in einer Scheune zu schlafen, er bot dafür seine Dienste an, half auf den Feldern mit und reparierte fachkundig defektes Gerät, immerhin kannte er sich dabei aus, und Männer waren selten in jener ersten Zeit nach dem Ende des Krieges, mit Ausnahme der fremden Soldaten, von diesen jedoch konnte man keine Hilfe erwarten. Es ist durchaus möglich, daß man da und dort froh war, wenn er nicht gleich wieder weiter wollte, sondern eine Zeitlang auf einem Bauernhof blieb. Vielleicht hat er den Winter von fünfundvierzig auf sechsundvierzig, den ersten Friedenswinter, der für sehr viele ein furchtbarer Winter gewesen ist, noch auf einem österreichischen Hof verbracht, ist dann im Frühling erst weitergegangen, durch die Täler des Böhmerwaldes und des Bayrischen Waldes, vielleicht hat er im Sommer sechsundvierzig in bayrischen Viehställen ausgeholfen, ist dort wiederum über die kalten Monate untergekrochen, erst im darauffolgenden Frühling wieder aufgebrochen, um weiterzuziehen, immer der untergehenden Sonne nach, immer in Richtung Amerika. Er durchwanderte Deutschland in westlicher Richtung, er muß überall auf Leute gestoßen sein, die aus der Heimat vertrieben waren wie er, das Land war überschwemmt mit Flüchtlingen und Vertriebenen, immer schwieriger wird es für ihn geworden sein, einen Schlafplatz zu finden, ein Stück Brot, einen Teller Suppe zu bekommen, immer häufiger wird man ihn von den Türen gewiesen haben. Trotzdem muß er irgendwo untergekommen sein, noch einen dritten Winter verbracht haben, bis er eines Tages, ohne es zu bemerken, wiederum eine Grenze passierte. Er sei, erzählte er später, nachdem er in einer Scheune geschlafen habe, von Leuten geweckt worden, deren Sprache er nicht verstanden habe. Am Klang ihrer Stimmen habe er gemerkt, daß er in Frankreich sei.
Nein, Amerika hat der alte Schmied von Mühlfraun nicht erreicht, obwohl es ihm zuzutrauen gewesen wäre. Er war jetzt einundneunzig Jahre alt und immer noch rüstig, aber er wird wohl schon etwas müde gewesen sein von dem weiten Weg, denn er ließ sich ohne Widerspruch von den Leuten des Roten Kreuzes, die man verständigt hatte, abholen, er ließ sich in ein Altersheim in Baden-Württemberg bringen.
Als der Enkel des Schmieds diese Geschichte erzählte, war es an unserem Tisch ganz still geworden. Unser Tisch bildete eine kleine, schweigsame Insel inmitten des Lärms. Wir saßen unter einem Baum am Rand der Wiese, doch nahe genug am Zelt, aus dem das Geräusch der Stimmen wie ein dumpfes Brausen zu uns herüberdrang, wenn die Blaskapelle schwieg. Um uns herum, an den anderen Tischen, war Lachen und lautes Gespräch, Leute kamen und gingen, der Geruch von Bratwurst und Grillhuhn mischte sich mit den Gerüchen von Backwerk, in der Hitze dampfender Erde und zertretenem Gras. Die Heimattreffen unserer Gegend finden im Hochsommer statt.
Daß der Großvater bis zu seinem Tod gehofft hatte, die Heimat wiederzusehen, sagte der Enkel des alten Schmieds, sei mit Sicherheit anzunehmen gewesen. Im Nachtkästchen neben seinem Bett im Altersheim habe er zahllose Päckchen mit den verschiedensten Samen gehabt, ständig habe er neue Samen dazugekauft, die Pflegerinnen hätten ihre liebe Not damit gehabt, die alten, schon keimenden Samen zu entfernen, ohne daß er es merkte. Salat, Kraut, Karotten und Sellerie, Gurken, Erbsen und Kürbis, alles, was daheim auf den Feldern und in den Hausgärten gewachsen sei, aber auch Getreide, Weizen, Gerste und Hafer, all dies, sagte er, müsse man ja wieder anbauen können, wenn man in die Heimat zurückkäme, er jedenfalls würde für diesen neuen Anfang gerüstet sein. Hier, habe er zu seinem Enkel gesagt, als ihn dieser besuchte, hier habe ich alles, was wir dann brauchen.
Immer und überall habe der Großvater auch eine alte Weste bei sich gehabt und getragen, er habe sich geweigert, sich davon zu trennen, selbst beim Baden durften sie ihm die Pflegerinnen nicht wegnehmen, er saß dann in der Wanne und hielt sie in der hochgehobenen Hand, um sie vor dem Naßwerden zu schützen. Niemand wußte, was es mit diesem Kleidungsstück für eine Bewandtnis hatte, man ließ ihm seinen Willen, um ihn nicht unnötig aufzuregen oder zu kränken. Als er, erst 1954, starb, einfach an Altersschwäche und ohne krank gewesen zu sein, gab man es ihm mit in den Sarg. Der Enkel wollte den Großvater noch einmal sehen, er nahm die Weste an sich, bemerkte, daß etwas darin eingenäht war, bemerkte auch eine mit unbeholfenen Fingern genähte Stelle, trennte sie auf, hielt ein sorgsam verschnürtes Päckchen in der Hand.
Wissen Sie, was in dem Päckchen gewesen ist?
Der Schlüssel ist in dem Päckchen gewesen, der Schlüssel zur Schmiede in Mühlfraun.
Eine still gewordene Tischrunde, von den übrigen Tischen Lachen und Lärm. Hitze, die uns den Atem nimmt, die Blaskapelle spielt mit Gefühl DA DRUNT IM BÖHMERWALD, WO MEINE WIEGE STAND. Der Enkel des alten Schmieds aus Mühlfraun wendet sein Gesicht zur Seite, er schämt sich der Tränen.
Wir fahren oft viele hundert Kilometer weit, um beisammen zu sitzen und solche oder ähnliche Geschichten zu hören, oder um einander zu berichten, wie es uns seit dem Verlassen der Heimat ergangen ist. Wir überspringen in unseren Gesprächen auch jene Grenze, die unser Leben in zwei ungleiche Teile teilt, wir erinnern uns an unsere Anfänge, damit sie uns nicht verlorengehen. Neben den alten Fotografien, auf denen die Dörfer und Städte zu sehen sind, wie sie waren, als wir dort lebten, zeigen wir einander auch andere, auf denen man sieht, wie sie sich im Lauf der Jahrzehnte verändert haben. In unseren Gesprächen fügen wir die beiden auseinandergerissenen Teile unserer Existenz aneinander, versuchen, ein Ganzes daraus zu machen, die Bilder helfen uns dabei, unsere verlorengegangene Vergangenheit wiederzufinden, sie mit der Gegenwart zu verbinden. DIES IST MEIN DORF bedeutet, daß dieser Ort, der vielleicht nur noch auf einer abgegriffenen Schwarzweißfotografie existiert, zu unserem Bewußtsein gehört, wie wir zu ihm gehören, daß mit unserer Vergangenheit ein Teil von uns selbst dort geblieben ist, den wir nicht löschen können, daß wir nicht wären ohne dieses Dorf, ohne die Sprache, die dort gesprochen wurde, ohne die Landschaft, die es umgibt.
(Seit 1945 sind über tausend Dörfer mit deutschen Namen von den Landkarten verschwunden, es gibt von ihnen keine Spuren mehr. Die von den Besitzern verlassenen Häuser und Bauernhöfe zerfielen, die Reste der Trümmer wurden beseitigt, die Friedhöfe eingeebnet, die verfallenden Kirchen und Ruinen gesprengt.
Die Stadt Brüx gibt es nicht mehr. Wo früher schöne Bürgerhäuser den weiten Stadtplatz umstanden, Kaufleute ihre Waren anboten, Kinder spielten, Spaziergänger unterwegs waren, dehnen sich die Abraumhalden der Kohlengruben. Man hat eine neue Stadt gebaut, sie heißt MOST, ein Wort, das ebenfalls BRÜCKE bedeutet, die alte Stadt mußte dem Kohlenabbau weichen. Nur die Kirche hat man auf Rollen, fünf Kilometer weit, an den Rand der Flöze gebracht. Anderes zerstörte, auf der Suche nach Zielobjekten, das Militär mit Kampfflugzeugen und Artillerie. Manches zerstörten Schnee, Regen und Wind. Ganze Stadtteile zerbröckelten, historische Schlösser verfielen, standen eine Zeitlang noch als Ruinen da, bis man ihren Anblick nicht mehr ertrug und die Reste sprengte, wegbrachte, anderweitig verwendete, was noch verwendbar war. In den Gebirgen mit den berühmten Namen sterben die Wälder. Über Gärten wuchert das Gras. Von manchem, was HEIMAT gewesen ist, sind nur noch Reste geblieben.)
Auf der Fahrt zu einem Heimattreffen bei Stuttgart erzählt ein Mann, der aus Mähren stammt, lange und liebevoll von seinem Heimatdorf. Natürlich fahre ich oft wieder hin, sagt er, erst im vergangenen Sommer bin ich wieder dort gewesen.
Wollen Sie mein Dorf sehen, sagt der Mann, greift in die Innentasche seiner Jacke, holt eine Brieftasche heraus, sucht in der Brieftasche nach einer Fotografie, hält sie mir dann entgegen. Das Bild zeigt eine Straße, die sich durch flaches Land zieht, rechts und links von der Straße wuchert vereinzelt Akaziengebüsch. Zwei Frauen beugen sich zum Boden hinab, als suchten sie dort etwas. Weit und breit ist kein Gebäude zu sehen.
Das ist mein Dorf, sagt der Mann, und dort, wo die beiden stehen, meine Frau und meine Schwägerin, dort ist mein Elternhaus.
Sie sehen nichts? sagt der Mann. Aber ich habe Ihnen doch alles genau beschrieben. Es ist ein Straßendorf, rechts und links an unser Haus schließen die Nachbarhäuser an, dahinter liegen die Höfe. Dort ist das Schulhaus und schräg gegenüber die Kirche. Und der kleine Bub, der die Gänse zum Bach treibt, bin ich. Ihr Fehler ist, sagt der Mann, daß Sie das Bild nur mit den Augen sehen. Ich, sagt er, sehe es anders. Ich sehe es innen.
Kann ein Stück flaches Land, von dem alle Spuren menschlichen Lebens getilgt sind, auf dem nicht ein Stein, nicht ein Baum oder Strauch, kein Fußabdruck, keine Wagenspur mehr an die Menschen erinnert, die dort gelebt haben, noch heimatlich berühren? Schon die Kontur eines Hügels, den wir als Kinder kannten, schon der Geruch des Unkrauts am Straßenrand, selbst der Staub, den der Wind von den Äckern treibt, bewegt unser Herz.
Bei Judiths Begräbnis, oder vielmehr davor oder danach, würde, das wußte ich, vor allem von Judith gesprochen werden. Es würden Vermutungen angestellt werden, die nicht beweisbar sein würden, verschiedene Leute würden verschiedene Geschichten erzählen. Aber auch unsere Herkunftsorte würden wiedererstehen, ihre Häuser und Straßen würden sich mit Leben füllen. Wir würden durch die Jahrzehnte zurückfallen und wieder zu jenen Kindern werden, die wir einmal waren. In unseren Erzählungen würden die Spiele, die wir gespielt hatten, wilder, die Streiche, die wir ausgeheckt hatten, verwegener sein, als sie in Wirklichkeit gewesen sind. Anni würde wieder zum Leben erwachen, das Kind, das auf seinem weinroten Fahrrad über den abschüssigen Stadtplatz von B. gefahren ist, mit wehenden Zöpfen und so wild, daß es stürzte und sich die Knie aufschlug, das auf der Wiese hinter dem Haus über die Springschnur sprang, mit von der Sonne erhitzter Haut auf den hölzernen Liegebrettern des Schwimmbads lag und Helga, der blonden Freundin, Geheimnisse ins Ohr flüsterte, von dieser wiederum Geheimnisse erfuhr. Judith würde im Zusammenhang mit dieser Erinnerung ebenfalls wieder Kind sein, Judith, die niemals vom Rad fiel, weil sie weniger wild als Anni war, die alles besser konnte als andere, die alle Geheimnisse kannte. Nein, darüber würde nicht gesprochen werden, aber ich, Anna, würde mich daran erinnern, auch an die älter gewordene Anni, die Feldpostbriefe von Christian in der Tasche trug, MEINE LIEBE ANNI, die sie beantwortete, MEIN LIEBER CHRISTIAN, die, mit Christian über eine weit im Ungewissen liegende Zukunft sprechend, die Angst zu verdrängen versuchte, WENN DER KRIEG ZU ENDE IST, WENN WIR ES ÜBERLEBEN, die von Christian im April fünfundvierzig Abschied nahm.
Auch daran würde ich mich erinnern, wie Judith auf den silbernen Ring wies, den Anni von einem bestimmten Zeitpunkt an am Ringfinger trug.
Was hast du da für einen Ring, hatte Judith gesagt.
Der ist von Christian, erwiderte Anni, Trotz und Triumph mischten sich in ihrer Stimme.
Judith wurde rot im Gesicht, wußte es, wendete sich ab, weil sie dachte, daß Anni es dann nicht bemerken würde.
Das verzeih ich dir nie, sagte sie, schon im Gehen, nein, sie schrie es, schrie es Anni über die Schulter zurück zu. DAS VERZEIHE ICH DIR NIE!
3
Anfang September neunundvierzig stand Europa unter dem Einfluß eines Hochdruckgebietes. In Wien lagen die Tagestemperaturen trotz nächtlicher Abkühlung zwischen dreiundzwanzig und fünfundzwanzig Grad, während der Herbstmesse herrschte ausnahmslos schönes, für die Jahreszeit viel zu warmes Spätsommerwetter. Auf dem Ausstellungsgelände im Prater drängten sich die Besucher zu Tausenden vom frühen Vormittag bis zum Abend, die angebotenen Waren lockten, obwohl sie nicht für den Einzelkäufer gedacht waren und den meisten Besuchern zum Kauf ohnedies das nötige Geld gefehlt hätte. Sehen wollte man, sich an der Vielfalt des Gebotenen erfreuen. Zu lange hatte man die Entbehrungen der Notzeit tragen müssen. Auch eine Weinkost gab es. Die Hallen waren überfüllt, die Luft war gesättigt von Schweißgeruch.
Auch im Pavillon der Erfinder gab es Sehenswertes. Eine Schmutzauffangspachtel für Zimmermaler, ein raumsparendes Brillenetui, spangenlose Ohrenschützer, eine zusammenlegbare Rodel. Die Menge staute sich vor den Kojen, ein Strumpfhalter ohne Knöpfe wurde vorgeführt, ein Schraubenzieher mit biegsamer Welle, ein Kunststopfapparat. Hinter dem Tisch, auf einem elektrischen Kocher, brodelte Milch in einem Topf, ein dürres Männchen in weißem Mantel wies mit dem Kochlöffel auf die dampfende Milch und wiederholte mit schriller Stimme immer das gleiche Satzfragment: GEHT NICHT IEBER! GEHT NICHT IEBER!
Heute noch, sagt Bernhard, habe ich diese Stimme und diese Worte im Ohr.
Bernhard und Anni schoben sich durch die Menge, auf ein Schild zu, das die Aufschrift RAUMSPARENDE MÖBEL trug. Schon von weitem sahen sie Plotzner, der, mit rudernden Armbewegungen auf einzelne Möbel zeigend, die von ihm ausgestellten Stücke anpries. Sein Hemd unter der aufgeknöpften Jacke war, der Mode entsprechend, aus weißem Nylongewebe, es zog klebrige Falten, er war hochrot im Gesicht. Ununterbrochen redete er auf die vor seiner Koje versammelte Menge ein. Hinter ihm, auf einem Podest, als Mittelpunkt der sorgfältig arrangierten Wohnzimmereinrichtung, stand eine mit rostrotem Boucléstoff bezogene Polsterbank, die sich, wie er beteuerte, vollkommen mühelos in ein bequemes Doppelbett verwandeln ließ.
Auch in Wien waren unzählige Wohnungen durch Bomben zerstört worden, auch hier herrschte bitterste Wohnungsnot. Die neuen Wohnungen, die gebaut wurden, waren klein, jene Glücklichen, die sie beziehen durften, brauchten geeignete Möbel dazu, nur die wenigsten konnten sich den Luxus eines eigenen Schlafzimmers leisten. Eine Polsterbank, die man ohne viel Mühe in eine bequeme Bettstatt verwandeln konnte, war eine vernünftige Lösung vieler Probleme.
Das Podest, auf dem die Polsterbank stand, war von zwei kleinen Fauteuils mit hölzernen Armstützen, einem quadratischen Tischchen und einem Hocker umgeben, der sich bei Raumnot unter das Tischchen schieben ließ, in der Ecke, der Polsterbank gegenüber, verdeckten Gummibäume eine mit grünem Stoff bespannte trennende Wand.
Plotzner, mit den Armen rudernd, redete ununterbrochen. Was Sie hier sehen, meine hochgeschätzten Damen und Herren, rief er, während ihm der Schweiß von der Stirn und in die Augen lief, ist das Bett unserer Zeit, nein, es ist das Bett unseres Jahrhunderts. Sie brauchen sich, wenn Sie abends müde von der Arbeit nach Hause kommen, nicht anzustrengen, um es aufzuziehen, Sie brauchen dazu nicht zwei Hände, nicht eine Hand, nein, – er machte eine effektvolle Pause – Sie brauchen gar keine Hand dazu.
Aus dem Krieg waren viele mit nur einer Hand heimgekommen, manche hatten auch keine Hände mehr, Plotzner war sich der Geschmacklosigkeit seiner Anspielung wahrscheinlich nicht bewußt. Sie glauben mir nicht, fuhr er fort, ich werde es Ihnen beweisen.
Er drehte sich um und ging auf die Polsterbank zu. Dieses Bett, rief er, ist ein Wunderbett, es öffnet sich, wenn Sie es wünschen, Sie brauchen es nicht zu berühren, Sie brauchen nur zu blasen, wie ich es Ihnen jetzt zeige. Er neigte seinen massigen Körper nach vorne und blies aus vollen Backen dorthin, wo die beiden Sitzpolster sich aneinanderfügten, das Wunder geschah, die rostroten Polster schoben sich beinahe geräuschlos nach vorne, die Polster, welche die Lehne gebildet hatten, klappten nach rückwärts um, auf dem Podest stand ein breites Bett.
Die Menge staunte und applaudierte, beifälliges Gemurmel wurde laut, die Leute fragten nach dem Preis, Plotzner nannte ihn, einer wollte selbst blasen, Plotzner erlaubte es, nachdem er das Bett wieder zur Bank zusammengeschoben hatte, der Mann blies, das Wunder ereignete sich tatsächlich zum zweitenmal. Die Menge schwieg staunend, beinahe ergriffen, schließlich streckten sich Hände vor, Plotzner verteilte Karten mit seiner Geschäftsadresse.
Na endlich, sagte Plotzner zu Bernhard, Sie müssen mich ablösen. Haben Sie aufgepaßt, wie ich es gemacht habe?
Ja, sagte Bernhard, aber den Trick müssen Sie mir erst noch erklären.
Über Plotzners Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. Ja, der Trick, sagte er, Herr Student. Ideen muß man heute haben, Ideen sind das Wichtigste in dieser Zeit. Rechts vor der Bank, sagte er, gleich neben der Stelle, auf der ich gestanden bin, ist ein Knopf im Boden, auf den müssen Sie treten, während Sie blasen, oder während ein anderer bläst, wie vorhin. Wenn Sie auf den Knopf treten, leuchtet hinter dem Wandschirm eine kleine Lampe auf. Wenn die Lampe aufleuchtet, zieht meine Frau an dem Nylonseil. Das Nylonseil läuft unter dem Tisch und unter den Sesseln durch, wenn man an dem Seil zieht, dann öffnet sich das Bett.
Wenn ein anderer auf das Bett bläst, müssen Sie auch auf den Knopf treten, sagte Plotzner.
Hinter dem Wandschirm saß Frau Plotzner, eine hagere Blondine, sie saß auf einem Sessel und hielt das Ende des Nylonseils in der Hand.
Ich werde noch eine Weile hier stehenbleiben und Sie beobachten, sagte Plotzner. Ihre Freundin kann das Seil betätigen, wenn die Lampe aufleuchtet. Machen Sie alles ordentlich und ruinieren Sie mir nicht mein Geschäft.
Ja, sagte Bernhard.
Wenn Sie es nicht ordentlich machen, bekommen Sie kein Geld, sagte Plotzner, und wenn Sie mir mein Geschäft ruinieren, werde ich Schritte unternehmen.
Bernhard trat aus der Ecke hinter dem Wandschirm heraus, die Blondine stand auf, und Anni setzte sich auf ihren Sessel und nahm das Seilende in die Hand. Plotzner lehnte sich an die Wand.
Geh inzwischen etwas essen, sagte er zu seiner Frau, ich komme nach, wenn das hier richtig funktioniert. Frau Plotzner entfernte sich.
Bernhard machte seine Sache gut, vielleicht noch besser als Plotzner selbst. Eine Menschentraube hatte sich neuerlich vor der Koje versammelt, man hörte ihm mit Interesse zu. Bernhard blies, und die kleine Lampe leuchtete auf.
Jetzt! flüsterte Plotzner.
Anni zog an dem Seil, aber das Wunder ereignete sich nicht, die Bank blieb geschlossen.
Fester, zischte Plotzner, ziehen Sie!
Anni riß an dem Seil, aber das Seil hatte sich irgendwo festgeklemmt, Plotzner traten Schweißperlen auf die Stirn, er stürzte auf Anni zu und riß ihr das Nylonseil aus der Hand. Anni erschrak, sprang von ihrem Sessel auf, stieß an den Wandschirm, der Wandschirm kippte nach vorn über die Gummibäume, Plotzner stand mit dem Seil in der Hand da, das Publikum starrte einen Augenblick lang überrascht, brach dann, als es begriffen hatte, in Gelächter aus.
Bernhard nützte die Schrecksekunde, packte Anni an der Hand und zog sie hinter sich her aus dem Lokal und über das Gelände, zwischen den Ausstellungshallen hindurch, erst als sie sicher sein konnten, daß Plotzner ihnen nicht folgte, blieben sie stehen.
Diese Geldquelle ist versiegt, sagte Bernhard.
Sie sahen einander an, dann begannen sie gleichzeitig zu lachen. Über Plotzner und seine raumsparenden Möbel lachten sie, über seine Idee mit dem Nylonseil, über die ganze, miese Geschichte. Sie lachten auch aus Erleichterung darüber, daß sie Plotzner entkommen waren.
Ich habe den Verdacht, sagte Bernhard schließlich, daß wir es auf solche Art nicht zu Reichtum bringen werden.
Würdest du gerne wie dieser Plotzner sein, fragte Anni.
Nein, sagte Bernhard, das nicht.
Da kommt Judith, sagte Anni.
Judith bog eben um die Ecke der Halle, in der die Haushaltsgeräte ausgestellt waren, die von vielen bewundert wurden und die kaum jemand kaufen konnte, weil sie zu teuer waren, sie kam auf die beiden zu. Sie trug einen roten Rock zur weißen, schulterfreien Bluse, das dunkle Haar hatte sie auf dem Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, der Pferdeschwanz wehte im leichten Wind, der weite Rock flatterte, sie sah sehr hübsch aus, und die Leute drehten sich nach ihr um. Man hatte, was Kleidung betraf, in jener Zeit nur geringe Möglichkeiten, jedenfalls wenn man arm war und wenn man dazu auch nicht auf Bestände zurückgreifen durfte, die Mütter oder Tanten über den Krieg gerettet hatten und die man umarbeiten konnte. Judith aber gelang es immer, irgendwo ein Stück Stoff zu bekommen, aus dem ein Kleidungsstück zu fertigen war, sie nähte sich ihre Kleider selbst, und da sie keine Nähmaschine besaß, nähte sie mit der Hand. Aus einer alten Decke zauberte sie eine Jacke, aus einem Tischtuch, einem Vorhang eine Bluse oder ein Kleid, sie brachte es fertig, immer auf eine besondere Art modisch gekleidet zu sein, und sie genoß es, dadurch die Blicke auf sich zu ziehen und auf angenehme Art aufzufallen.
Hallo, sagt Judith, was macht ihr da.
Bernhard berichtete, was sich ereignet hatte.
Da wäre ich gern dabeigewesen, sagte Judith.
Anni, auch Judith, sind aus der Erinnerung aufgetaucht und verschwinden wieder. Zurück bleibt ein von Karl Plotzner gesprochener Satz, der als Brücke zu jenen Geschichten benützt werden kann, die erzählt werden müssen, damit aus einzelnen aneinandergefügten, miteinander verwobenen Teilen ein Bild entsteht.
IDEEN MUSS MAN HABEN, hatte Plotzner gesagt, IDEEN SIND DAS WICHTIGSTE IN DIESER ZEIT.
Ein Vater ging mit seinem Sohn durch den Bayrischen Wald bei Kraiburg, die beiden gingen ein Flüßchen entlang, der Sohn blieb stehen und hob aus dem seichten Uferwasser eine Muschel heraus. Die Muschel schillerte an der Innenseite, außen war sie grau, das Tier hatte sein Gehäuse schon verlassen, die Schale lag halbrund und fest in der Hand des Buben, ein schöner, unbeschädigter Gegenstand inmitten der Zerstörungen, welche der Krieg und hier im Wald auch die Nachkriegsaktivitäten der Besatzungsmacht angerichtet hatten.
Was kann man daraus machen, fragte der Sohn.
Der Vater nahm die Muschel aus seiner Hand, wendete sie hin und her und betrachtete sie. Vielleicht Knöpfe, sagte er.
Er hatte mit Knöpfen bis dahin nur soweit zu tun gehabt, als er sie zum Verschließen seiner Kleidung benötigte, aber jetzt, beim Betrachten der Muschel, kam ihm eine IDEE. Er versuchte sich in der Herstellung von Knöpfen aus Muscheln und aus Walnußschalen. Aus diesen kleinsten Anfängen entstand eine Knopffabrik.
WAS KANN MAN DARAUS MACHEN, das war eine der wichtigsten Formeln für jene, die aus den Baracken, den Holzverschlägen, den Viehställen und Scheunen kamen oder noch darin saßen, die sich auf die Suche nach einer Arbeitsmöglichkeit, nach den Anfängen einer neuen Existenz begaben. Aus alten Autoreifen wurden Schuhsohlen, aus Konservenbüchsen wurden Schmuck und Christbaumbehang, aus Eisenstückchen wurden Werkzeuge, aus Maschinentrümmern funktionierende Maschinen, aus geeigneten Holzstückchen wurden Trommelstöcke und Flöten. In der Geigenbauersiedlung Bubenreuth bei Erlangen bewahrt man eine Geige, die aus Barackentrümmern gefertigt worden ist. WAS KANN MAN DARAUS MACHEN, fragten sich jene Vertriebenen, die man in das Lager Pürten bei Kraiburg gebracht hatte, als sie im Mühlbacher Hart auf die Trümmer und Reste der nur zum Teil zerstörten Munitionsfabriken und Bunker jener Anlagen stießen, welche die Deutsche Sprengstoffchemie während des Krieges errichtet hatte. Der Bombenkrieg hatte die gut getarnten Anlagen nicht zerstört, aber die amerikanischen Besatzer hatten gesprengt und demontiert. Nur ein Teil der Baracken und Bunker war erhalten geblieben, dazwischen lagen die Trümmer, gewaltige Blöcke aus schwerstem Beton, aus denen rostige Eisenstangen gefährlich hervorragten, dazwischen wucherte der Wald. Sie dachten ARBEIT, als sie auf die Maschinenteile stießen, die noch verwendbar waren. Die in der Heimat Fabriken besessen hatten, dachten AUFBAU und PRODUKTION. Sie zogen aus den Lagern in den Wald, sie bezogen diejenigen der Bunker, die noch beziehbar waren, von den Betonwänden rann das Wasser, sie brachen in monatelanger Schwerstarbeit Fensteröffnungen in die Wände. Sie wohnten und arbeiteten unter elendsten Verhältnissen, sie rodeten und gruben wie einst ihre Vorfahren in den böhmischen Ländern, wie jene, die man gerufen hatte, um aus Urwäldern fruchtbare Äcker zu machen. Sie hatte man nicht gerufen, und ihre Not war größer als jene der Vorfahren je gewesen war, denn jene waren als Arbeitskräfte und Siedler willkommen gewesen, sie aber waren als unerwünschte Eindringlinge gekommen. Immer wieder wurde, während sie bauten, demontiert und gesprengt, aber sie ließen sich nicht vertreiben, sie waren zäh, sie krallten sich fest an diesem Stück Waldgelände, sie hatten nichts zu essen und nichts, das sie hätten gegen Eßbares eintauschen können, sie bastelten Wäscheklammern aus Holzstückchen, die sie im Wald auflasen, und liefen damit zu den Bauern, um ein wenig Milch für die Kinder zu bekommen, jeder rostige Nagel, jeder Stoffetzen, jedes verwertbare Holzstück waren wertvolle Funde für sie. Buchstäblich aus dem Müll gruben sie die Anfänge ihrer Existenz.
Was hätten diese Leute aus dem Müll unserer Tage gemacht, sagt Bernhard, diese Frage drängt sich einem ja auf, wenn man das liest.
Ich, Anna F., bin auf der Suche nach Anfängen, die sich rund um den eigenen Anfang begeben haben, in die meine Anfänge eingebettet sind. Ich fühle mich als Einzelperson eingebunden in ein Geflecht verschiedenster sozialer und menschlicher Abläufe, die sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgespult haben wie Fäden und die jene Menschengruppe betreffen, der ich nach Herkunft und Schicksal zuzuzählen bin. Ich gehe herum und sammle die Fäden, wo ich sie finden kann, ich verfolge sie zu den Anfängen zurück. Ich lasse mir Geschichten erzählen, fahre mit dem Wagen durch Gegenden, in denen ich nie vorher gewesen bin, und sammle Landschaften, in die es die Menschen meiner Heimat verschlagen hat, ich lasse mir Bilder zeigen, alte Schwarzweißfotografien, die aus diesen Anfängen stammen und aus denen die Veränderungen erkennbar werden, die vorgegangen sind. Ich will, indem ich dies tue, eine Verbindung herstellen zwischen Früher und Jetzt, vielleicht eine Art Band flechten aus den gesammelten Fäden, das Halt gibt und zusammenhält. Ich weiß, indem ich darüber nachdenke, daß diese Vorstellung einer Art Wunschdenken entspringt, das eigentlich jeder realen Basis entbehrt, ebenso wie die ebenfalls mögliche Vorstellung, aus den gesammelten Fäden ließe sich etwas spinnen wie ein Kokon, dessen Inneres Schutz und Geborgenheit bieten kann. Beides, das unzerreißbare Band wie auch der Kokon, gehören in den Bereich der Illusion.
Wen oder was also will ich retten, wen oder was will ich bergen oder zu bewahren versuchen?
Laß die Vergangenheit, hätte Judith gesagt, was geht sie uns an. Wir leben HEUTE, und wir haben nur dieses eine Leben.
Ich aber weiß, daß spätere Entwicklungen ohne die Anfänge nicht vorstellbar sind.
Die ersten der Vorfahren, von denen wir wissen, sagte der Vater, sind aus dem Adlergebirge gekommen.
Einer der Fäden, die ich zu den Anfängen zurückverfolgt habe, führt in die Stadt zurück, die auf dem Bunkergelände bei Kraiburg entstanden ist und die man Waldkraiburg genannt hat. Sie ist vielen Adlergebirglern zur zweiten Heimat geworden.
Erzählt mir, wie es gewesen ist, sage ich zu den Leuten, die mir in Waldkraiburg begegnen. Sie berichten, woran sie sich erinnern, wie es war, als die ersten von ihnen durch die Wälder gegangen sind. Der erste Kaufmann berichtet, wie er mit dem Fahrrad bis nach München gefahren ist und die Lebensmittel geholt hat, die zugeteilt worden sind. Wie er mit dem Schubkarren nach Kraiburg gefahren ist oder nach Mühldorf um Mehl oder Brot.
Zweiundzwanzig Kilometer weit nach Altötting, siebzehn Kilometer nach Mühldorf, dort habe er mit dem Rucksack die Wurst geholt. Als es zum erstenmal Rübensirup ohne Marken zu kaufen gab, fuhr er mit dem Fahrrad dreißig Kilometer weit, ebensoweit wieder zurück in den Wald, rechts und links je einen Eimer mit Sirup an die Lenkstange gehängt, weil die Eimer bald leer waren, legte er die gleiche Wegstrecke gleich noch einmal zurück. UNTERWEGS IST MIR DANN NOCH DIE GABEL GEBROCHEN. DIE STRASSEN WAREN JA NOCH VOLLER LÖCHER, NICHTS WAR ASPHALTIERT.
Von der Frau erzählen sie, welche die Kinder einsammelte und in einer Baracke den ersten Schulunterricht gab. Nein, nichts mit Behörden und so, das sei erst später gewesen.
Auch der erste Gottesdienst wurde in einer Baracke gehalten. Ein Leintuch als Altardecke, jeder brachte einen Sessel mit. Ein Brautschleier zu Ostern für das Heilige Grab. Dieser Brautschleier sei auch zu Hochzeiten oft verliehen worden.
(Auch Anni ist, etwa zur gleichen Zeit, in geliehenem Brautkleid, mit geliehenem Schleier, über den Teppich der Churhauskapelle nächst Sankt Stephan in Wien gegangen.)
Eine Barackenschule, eine Barackenkirche, ein Barackenkindergarten. Später eine erste feste Kirche in einem Bunker. DAS WAR NOCH EINE RICHTIGE KIRCHE, DA HAT MAN SICH NOCH IN GOTTES NÄHE GEFÜHLT.
Wie die ersten Häuser am Annabergplatz gebaut worden sind, erzählen sie, wie Oskar F. seine ersten Möbel aus Pulverkisten gebaut hat, die Angeln aus Draht für die Türen, die Nägel aus den Dornen des Stacheldrahtes, das habe er in der Gefangenschaft in Rußland gelernt.
Erst Anfang der fünfziger Jahre sei es langsam aufwärts gegangen, da habe es dann schon eiserne Militärbetten gegeben.
Von den Anfängen muß gesprochen werden. Wie sie nacheinander gekommen sind, erzählt Dr. K., der Apotheker, wie der Doktor, der Armeechirurg gewesen war, bei dem amerikanischen Offizier einen Blinddarmdurchbruch diagnostiziert hat, wie der Amerikaner ihn aufgefordert hat, ihn zu operieren.
Yes, habe der Doktor gesagt, ich werde operieren, habe den Amerikaner in der Baracke auf einen Tisch gelegt und mit seinen mehr als bescheidenen Instrumenten so operiert, daß er überlebte. Das hast du gut gemacht, sagte der Offizier, du wirst Chefarzt hier im Krankenhaus.
Was man überhaupt für Möglichkeiten gehabt hat, was man alles werden konnte, wenn man durch Zufall auf die maßgeblichen Leute der Besatzungsmacht gestoßen ist, wenn man es verstanden hat, die Möglichkeiten, die sich boten, wahrzunehmen.
Wie sie einander halfen, wenn ein Kind zur Welt kam, wie die Uralten sich der Kinder annahmen, weil die Jüngeren zur Arbeit gebraucht wurden. DA WAR DIE FAMILIE WICHTIG, DA WAR EINER AUF DEN ANDEREN ANGEWIESEN.
Im Wald hatte man rauchloses Pulver erzeugt, Granaten, Munition für den Krieg, den wenige gewollt hatten, der so viele Opfer gekostet hatte, der auch viel später noch Opfer forderte, weil Unzählige an den Spätfolgen, die sich einstellten, starben. Sie richteten sich in diesem Wald ein, um darin zu leben, sie gingen nicht, als man ihnen die Bewilligung zum Aufbau entzog, bauten mit dem Risiko, wieder vertrieben zu werden, erste, kleine Betriebe auf, blieben und arbeiteten mit Zähigkeit und Fleiß, halfen einander weiter, ließen sich nicht entmutigen, überzeugten schließlich die Behörden und die Besatzungsmacht. Sie erzeugten Ofenrohre, Puppen, Musikinstrumente, Spielwaren, Knöpfe, sie bearbeiteten und veredelten Glas. Von den Unternehmen, zu denen sie damals den Grundstein legten, haben mehrere internationale Bedeutung erlangt. Auch nordböhmische Glasfachleute waren in die Kraiburger Wälder gekommen, Glas sollte in der neuen Siedlung eine bedeutende Rolle spielen.
(Wenn Anna und Bernhard Gäste bewirten, dann trinken diese Wasser und Wein aus Gläsern, die in Waldkraiburg hergestellt worden sind.)
Ich bin durch Waldkraiburg gegangen und habe die Namen der Straßen gelesen, die an die alte Heimat erinnern. Troppauer Straße, Neutitscheiner Weg, Tilsiter Straße, Prager Straße, Adlergebirgsstraße. Ich habe in einem Hotel in der Berliner Straße geschlafen, das zu einem Teil noch aus einem der übriggebliebenen Bunker besteht. Oskar F. hat mir die anderen, noch existierenden Bunker gezeigt, das Jugendzentrum, die Polizeidienststelle in der Nähe des Annabergplatzes, eine Schlosserei. Der Jugendstilmaler Ferdinand Staeger hat bis zu seinem Tod in einem Bunker gewohnt, ich, Anna, habe ihn dort noch besuchen dürfen. Auch jene ersten Häuser, die man am Annabergplatz gebaut hat, sind noch bewohnt.
In einem Bildband sieht man die schmale Straße, die damals über das Bahngeleise geführt hat, hinter dem Bahngeleise ragt hoher Fichtenwald.
Überall ist hier Wald gewesen, sagt Oskar F., und hier war die alte Kirche, die Bunkerkirche, von der meine Frau erzählt hat, man hat sie erst vor ein paar Jahren abgerissen.
Hier liegt noch etwas Schutt davon.
Ich habe mir gedacht, daß Sie das sehen wollen, sagte Oskar F. Auf dem Waldfriedhof gibt es eine Gedenkstätte für die in der Heimat zurückgebliebenen Toten, sie ist aus Ziegeln erbaut, man konnte einen solchen Ziegel kaufen und die Namen und Daten der in der Heimat zurückgebliebenen Toten einbrennen lassen. Ich suchte im Telefonbuch nach Leuten aus dem Adlergebirge, die den gleichen Familiennamen tragen, der auch der meine gewesen ist, es könnten Nachkommen meines Vorfahren Adam, des um 1580 Geborenen, sein. Was ich nicht zu hoffen gewagt hatte, trat ein. Es fand sich eine Familie dieses Namens.
Was hatte ich, als ich die Nummer wählte, eigentlich gehofft?
Ja, sagte die Frau, die sich meldete, sie heiße so und sie stamme auch aus dem Adlergebirge.
Tschenkowitz, ja, das sei ihr bekannt.
Nein, sagte die Frau, es interessiere sie nicht, mit mir in Kontakt zu treten.
Warum denn? fragte die Frau.
Der Plotzner kommt, sagte Anni erschrocken, gehen wir schnell weg.
Nein, sagte Bernhard, das hat keinen Sinn, er hat uns ja schon gesehen.
Ihr werdet euch doch nicht fürchten, sagte Judith.
Plotzner kam mit rudernden Armbewegungen direkt auf sie zu, ein Zweifel war ausgeschlossen, er hatte sie gesucht und auch gefunden. Kleine Schweißtropfen standen auf seiner Stirn, er schien gelaufen zu sein.
So geht das nicht, Herr Student, sagte er zu Bernhard, das können Sie mit mir nicht machen. Zuerst machen Sie mich lächerlich vor den Leuten, und dann rennen Sie einfach davon.
Anni blickte besorgt, sie dachte daran, was Plotzner ihnen angedroht hatte, er würde Schritte unternehmen, hatte er gesagt, es blieb abzuwarten, wie das gemeint gewesen war.
Das Seil ist hängengeblieben, sagte sie, wir können gar nichts dafür, daß das passiert ist.
Das müssen Sie mir nicht sagen, das haben wir ja alle gesehen, bemerkte Plotzner, aber deswegen brauchen Sie ja nicht den Wandschirm umzuwerfen.
Sie hat sich vor Ihnen gefürchtet, sagte Bernhard.
Lächerlich, sagte Plotzner, und ein Gummibaum ist auch abgebrochen.
Was kostet ein Gummibaum, rechnete Anni. Plotzners Schritte würden den Preis eines Gummibaums einbeziehen.
Sie sind auf sie zugestürzt wie ein wild gewordener Hund, sagte Bernhard.
Hund, wiederholte Plotzner drohend, das sagen Sie nicht noch einmal zu mir, Herr Student!
Ich wollte Sie nicht beleidigen, erwiderte Bernhard. Aber Sie hätten sich sehen sollen, wie Sie losgestürzt sind.
Ja, sagte Anni, das ist wahr.
Plotzner zog ein Taschentuch aus der Rocktasche und wischte sich damit den Schweiß von der Stirn. Sie können leicht reden, sagte er, Sie kommen her, spielen ein bißchen Theater und wollen noch Geld dafür, aber ich muß dieses Geld erst verdienen. Ich muß Ideen haben, ich muß mir etwas einfallen lassen, damit die Leute später in die Geschäfte gehen und meine Möbel kaufen und keine anderen. Es sind gute Möbel, und auf das Bett habe ich schließlich ein Patent, es geht ganz leicht auf, auch ohne das Seil, es gibt andere Ausziehbetten.
Und warum machen Sie dann das ganze Theater, fragte Anni.
Junge Frau, entgegnete Plotzner, verstehen Sie denn überhaupt nichts vom Geschäft? Die Leute brauchen das, man muß ihnen etwas bieten, was sie nicht überall sehen. So lang hat man bei uns nichts zu kaufen bekommen, die Geschäfte waren leer, jetzt wird überall angeboten, seit achtunddreißig oder neununddreißig haben die Leute nicht mehr so viele verschiedene Sachen gesehen. Wenn sie von dieser Messe nach Hause kommen, haben sie ein Durcheinander von Sachen im Kopf, die sie alle gesehen haben und die sie sich gerne kaufen würden, wenn sie das Geld dazu hätten.
Aber sie haben ja das Geld gar nicht, sagte Anni, die meisten haben es nicht.
Eben, sagte Plotzner. Jetzt haben Sie ins Schwarze getroffen, junge Frau. Es gibt zwar wieder Leute, die Geld haben, aber die haben auch andere Wohnungen und die brauchen auch keine Ausziehbetten, die Ausziehbetten sind für die kleinen Wohnungen und für die armen Leute gedacht. Die Leute, für die sie erfunden sind, müssen sparen, ehe sie sich ein Möbelstück kaufen können, und weil sie sparen müssen, überlegen sie sich gut, was sie kaufen. Das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, junge Frau, das muß ein Geschäftsmann heute bedenken. Sie wissen ja nicht, was ein Geschäftsmann alles bedenken muß. Überall werden jetzt raumsparende Möbel angeboten, überall werden sie gemacht, deshalb ist es wichtig, daß man den Leuten etwas Besonderes bietet, etwas, was ihnen im Gedächtnis bleibt.
Die Leute, die meine Koje besuchen, sagte Plotzner, wissen sehr gut, daß das mit dem Blasen ein Trick ist, sie sind ja nicht blöd. Aber wie dieser Trick funktioniert, das können sie nicht so leicht herausbekommen, das Nylonseil ist ja beinahe unsichtbar, und außerdem ist es unter dem Teppich versteckt, und die Leute achten nur auf das Bett, sie kommen nicht dahinter, wie es gemacht wird, wenn nicht jemand daherkommt wie Sie und den Wandschirm umwirft. Die Leute stehen da und sehen, wie das Bett aufgeht, ohne daß jemand es auch nur anrührt, sie versuchen, dahinterzukommen, wie das funktioniert, aber normalerweise kommen sie nicht dahinter, das freut sie, das bringt Spannung in die Sache. Sie sind dankbar für den gut gemachten Trick, die Leute, das ist fast wie wenn sie im Zirkus gewesen wären, aber sie mußten dazu nicht in den Zirkus gehen und Geld ausgeben, sie haben den Trick ganz umsonst mit dem Eintrittsgeld für die Messe mitgekauft. Und wenn sie dann wieder zu Hause sind, erinnern sie sich daran und reden davon.
Zum Glück ist ja ein ständiges Kommen und Gehen auf dieser Messe, sagte Plotzner, also einmal ist keinmal, die Sache ist nicht so schlimm.
Da bin ich aber beruhigt, sagte Bernhard.
Komm, sagte er zu Anni, wir gehen.
Plotzner packte ihn am Arm. Nein, sagte er, so ist das nicht gemeint. Sie haben mir versprochen, mich abzulösen, ich brauche eine Pause bei diesem Betrieb und bei dieser Hitze, auch meine Frau braucht eine Pause. Wir haben einen Preis für die Stunde ausgemacht. Wo soll ich jetzt, mitten im Messebetrieb, jemand anderen herbekommen?
Sie haben doch einen Sohn, sagte Bernhard.
Der Peter ist im Geschäft, sagte Plotzner. Einer muß im Geschäft sein, sonst machen die Angestellten, was sie wollen. Kommen Sie, sagte er, ich gebe Ihnen einen Schilling mehr für die Stunde.
Das Angebot würde ich annehmen, sagte Judith.
Na ja, meinte Anni.
Also gut, sagte Bernhard, gehen wir.
Ich komme mit, sagte Judith.
Sie schoben sich wieder durch das Gedränge, an dem Mann mit dem Milchtopf vorbei, der Erfinder des Schraubenziehers drehte immer noch Schrauben in ein Stück Holz, die Dame mit dem Strumpfhalter ohne Knöpfe schob ihren Rock hoch und wies auf ihr Bein, der Student, der die Dachziegel anpries, warf ihnen einen vielsagenden Blick zu, er deutete auf die Koje, vor der sich schon wieder die Menge staute. Auf dem Patentbett, das jetzt aufgeschlagen war, lag ein junger Mann, die Arme unter dem Kopf verschränkt, und täuschte laute Schnarchtöne vor.
Plotzner zog sein Taschentuch aus der Rocktasche, wischte damit über die Stirn und steckte es wieder ein. Wünsche wohl geruht zu haben auf Plotzners Patentbett, sagte er scharf.
Plotzner junior öffnete die Augen und gähnte. Die Menge brach in Gelächter aus. Plotzner senior tat, als wäre die Sache mit Absicht so arrangiert worden, er vermied im Hinblick auf die drohende Blamage einen Familienstreit und nützte die Situation.
Peter Plotzner schüttelte Bernhard und Anni die Hand und entfernte sich, er hatte den beiden den Nebenverdienst in der Möbelkoje seines Vaters vermittelt. Viel Spaß und überarbeitet euch nicht, rief er ihnen noch zu, dann war er verschwunden.
Diesmal lief alles zu Karl Plotzners Zufriedenheit ab. Bernhard hielt seinen Vortrag über die Qualitäten der raumsparenden Möbel, vor allem der Polsterbank, Anni zog im richtigen Augenblick kräftig am Seil, das sich nicht verklemmt hatte, sondern prompt funktionierte. Die Bank glitt lautlos nach vorne und öffnete sich zum Bett, das Publikum staunte und applaudierte.
Plotzner, hinter dem Wandschirm stehend, nickte zufrieden. So müssen Sie es machen, so ist es richtig, sagte er zu Anni, wenn Sie es jedesmal so machen, dann wird es ein Erfolg, dann lasse ich vielleicht mit mir reden und gebe Ihnen noch einen Schilling mehr.
Im selben Augenblick ereignete sich draußen auf dem Podest etwas, womit er nicht gerechnet hatte. Judith, die unten im Publikum gestanden war und die Vorstellung interessiert verfolgt hatte, sprang, ihren roten Rock mit beiden Händen festhaltend, auf das Podest. Dieses prachtvolle Bett muß man aber auch ausprobieren, rief sie, ich möchte wissen, wie man darauf schläft. Ehe Bernhard es verhindern konnte, war sie, leicht wie eine Tänzerin, auf das Patentbett gesprungen, nicht ohne die Schuhe vorher abzustreifen, hatte, auf und ab hüpfend, die Federung erprobt, sich dann hingelegt, der Länge nach ausgestreckt. Nun räkelte sie sich behaglich auf den rotbraunen Polstern, ihr Rock verrutschte, eines ihrer schlanken Beine wurde bis zum Schenkel hinauf sichtbar, wofür sich vor allem der männliche Teil der Zuschauer mit lautem Beifall bedankte.
Plotzner, der mit geschärftem Ohr die zu diesem Zeitpunkt nicht erwartete Bewegung in der Menge wahrgenommen hatte, lugte durch einen Spalt im Wandschirm, erblickte zwischen den Blättern eines der Gummibäume Judiths roten Rock und Judiths nacktes Bein, wollte erst wütend aus seiner Ecke hervorbrechen, die freche Person von seinem Patentbett verjagen, besann sich dann, blieb still und wartete ab. Er vernahm, wie die Menge, nachdem Bernhard Judith endlich bewogen hatte, sich wieder aufzurichten und das Bett zu verlassen, Unmut darüber äußerte, daß die Vorstellung zu Ende war, dann lachend weiterzog. Erst dann trat er hinter dem Wandschirm hervor und auf Judith zu, die eben dabei war, ihre Schuhe wieder anzuziehen.
Fräulein, sagte Plotzner, Sie verstehen etwas vom Geschäft, Sie müssen das unbedingt wiederholen.
Judith sah ihn erschrocken an. Das fällt mir nicht ein, sagte sie zornig.
Aber Fräulein, sagte Plotzner, haben Sie nicht gesehen, was für ein Erfolg das war?
Judith hörte ihn nicht mehr, sie hatte sich schon durch die Menge gedrängt und lief durch die Halle dem Ausgang zu.
(Ich, Anna, sehe Judith mit wehendem roten Rock durch die Tür der Halle verschwinden. Ich sehe Anni und Bernhard wiederum das Podest besteigen, auf dem Plotzners Patentmöbel stehen. Sie werden, indem sie diese anpreisen, mithelfen, eine Epoche zu prägen. Die Verhältnisse werden sich bessern, aber die Architekten werden auf ihren Reißbrettern weiterhin kleinräumige Wohnungen entwerfen, das kleine Glück wird in kleine Räume gedrängt bleiben, auch dann noch, wenn keine Patentbetten mehr nötig sind. Manches wird überflüssig werden, weil es in den zu kleinen Zimmern keinen Platz mehr dafür geben wird, zum Beispiel Klaviere. Die Kinder werden nicht mehr Klavier spielen lernen wie Anni, wie Heinrich, wie auch Valerie, sie werden auf Knöpfe drücken, Knöpfe erfordern nur wenig Platz. Die Knopffabriken werden erweitern, in großen Hallen werden kleine Knöpfe erzeugt werden, die Knöpfe werden an kleinen Apparaten angebracht werden, die Apparate werden in den kleinen Wohnzimmern die Klaviere ersetzen. Die Zeit wird anbrechen, in der man Klaviere nachts heimlich von den Brücken in die Donau kippt, weil niemand sie mehr braucht und niemand sie mehr haben will, vielleicht auch in andere Flüsse von einiger Breite und Tiefe, Architektur und Technik werden den heimlichen Tod der Klaviere verursacht haben, das Ertrinken der Klaviere, das Verstummen der Klaviere. Niemand wird mehr Klavierauszüge von Opern oder Operetten auf Notenpulte legen und daraus Opern- oder Operettenmusik spielen.
Anni vor dem schwarzen Flügel, auf dem in Goldbuchstaben HANSMANN geschrieben steht, Valerie vor dem braunen Flügel im Bauernhaus ihrer Eltern in B., Heinrich vor dem Flügel in Mährisch Trübau, Friederike vor dem Flügel in Sankt Ägyd, Kinder, die Musik durch Klavierspiel erzeugen, nur der Musik zuliebe, dies alles wird Vergangenheit sein.
Heinrich ging, im Ersten Weltkrieg in Polen, auf ein fremdes Klavier zu, das in einem polnischen Herrenhaus stand, er spielte Musik von Lehár und Strauß. Klaviermusik, spontan auf fremden Klavieren gespielt, wird es kaum noch geben, was bleiben wird, werden die Kriege sein. Der Tod der Klaviere, das Verschwinden der Klaviere wird nicht dazu beitragen, die Welt friedlicher werden zu lassen, die Knöpfe werden eine furchtbare Bedeutung erlangen. Dies aber sind Entwicklungen, die Plotzners Patentbett nicht direkt verursacht hat.)
4
Der fünfte Winter nach dem Ende des Krieges war kalt. Eine böse Zeit für jene, die noch in Notunterkünften saßen, keine warme Kleidung, keine festen Schuhe hatten, kaum Brennmaterial und die nötigsten Lebensmittel kaufen konnten. Zwei Jahre nach der Währungsreform war im Westen Deutschlands die Rationalisierung der Lebensmittel zum großen Teil aufgehoben worden, trotzdem spürte man den Mangel überall, denn es fehlte an Arbeitsplätzen und damit auch an Geld. Ein Ei kostete achtzehn Pfennig, die Butter konnte man um zwei Mark fünfzig für das halbe Kilo kaufen, ein Kilo Brot kostete eine Mark. Hedwig hatte mit hundertvierzig Mark im Monat für die Familie auszukommen. Sie war eine der 469.000 Kriegerwitwen, die zu versorgen waren.
Obwohl man den Flüchtlingen und Vertriebenen in Deutschland Renten und Unterstützung gewährte, konnten diese, bei den herrschenden Verhältnissen, nur niedrig sein. Auch die Arbeitslosigkeit war im Steigen begriffen. Im deutschen Bundesgebiet erreichte die Zahl der Menschen, die ohne Beschäftigung waren, die Zweimillionengrenze, in Nürnberg allein waren 13.180 Arbeitslose gezählt worden, die Schlangen vor den Arbeitsämtern wurden von Tag zu Tag länger. Von den Unternehmern wurden nur voll einsatzfähige Arbeitskräfte beschäftigt, Angestellte, die auf Grund ihres schlechten Gesundheitszustandes den Anforderungen nicht entsprechen konnten, wurden in den meisten Fällen entlassen. Ständig kamen neue Arbeitsuchende hinzu, Heimkehrer, illegale Grenzgänger, auf verschiedenen Wegen Zugezogene. Die allgemeine Not war groß, beinahe katastrophal. Trotzdem schrieb die New York Times, sich auf Berichte aus Frankfurt berufend, die Deutschen äßen jetzt besser, als sie je nach dem Krieg gegessen hätten, und sie hätten vor, IM NEUEN JAHR ZU GUT ZU LEBEN. Die Administratoren, hieß es, seien besorgt, daß die deutsche Bevölkerung sich AN EIN ZU UMFANGREICHES MENU GEWÖHNEN könnte und daß es eines Tages zu neuerlichen Einschränkungen kommen würde, etwa dann, wenn die mögliche Einstellung der amerikanischen Hilfe mit einer schlechten Ernte zusammenfiele. Dies würde dann EINE RÜCKKEHR ZUM MAGEREN TISCH bedeuten.
(Hier ist daran zu erinnern, daß Annis Großeltern, Josef und Anna, mit ihrer Tochter Hedwig und deren beiden Kindern Heidi und Günter nach ihrer Vertreibung von Haus und Hof und einer Zwischenstation im nördlichen Niederösterreich in ein sehr kleines Dorf bei Erlangen gebracht wurden, wo sie in einem Häuschen zwei Dachkammern bewohnten. Heidi und Günter erklären, daß der Tisch der Familie in jenen Jahren mehr als mager gedeckt gewesen sei. Sie waren zu diesem Zeitpunkt, von dem hier die Rede ist, sieben und zehn Jahre alt und können sich nicht daran erinnern, damals GUT UND REICHLICH gegessen zu haben.
Präsente, die man den Großen machte, spiegeln die Lage der Zeit deutlicher als der zitierte Zeitungsbericht. Zum vierundsiebzigsten Geburtstag des Bundeskanzlers Adenauer stellten sich die Länder mit Lebensmittelgeschenken ein. Bayern soll sechs Hühnereier, Schleswig-Holstein ein halbes Pfund Butter gespendet haben.)
Der Winter also war kalt, und die Familie fror, obwohl Großvater Josef Holz aus dem Wald heranbrachte und der kleine eiserne Ofen, der in einer der beiden Kammern stand, geheizt werden konnte. Die Wände blieben kalt, und durch die Fugen der klapprigen Fenster pfiff ein eisiger Wind.
Großmutter Anna war schon mehrmals schwer krank gewesen, sie war über siebzig Jahre alt und geschwächt. Hedwig hatte die Sorge um die tägliche Nahrung für die fünfköpfige Familie und zu ihrem Kummer um den in Rußland verschollenen Mann Richard auch noch jene um die kranke Mutter zu tragen.
Die Schwägerin in Wien versuchte zu helfen, sie stellte ein Weihnachtspaket zusammen und gab es einer Frau mit, die zu Verwandten nach Nürnberg fuhr. Irgendwann um die Weihnachtszeit kam dann der von der Zensurstelle geöffnete und wieder verklebte Brief, in dem Hedwig mitgeteilt wurde, daß das Paket unter einer genannten Adresse in Nürnberg zu holen sei.
Hedwig war bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in der nahen Stadt Nürnberg gewesen, die Gelegenheit hatte sich nicht ergeben, jetzt mußte sie diese Fahrt unternehmen, obwohl die Mutter wieder erkrankt war und sie dringend gebraucht hätte. Das Paket und sein Inhalt waren wichtig, und sie entschloß sich zur Reise.
Sie zog den Mantel an, den eine befreundete Frau ihr aus einem alten Männerrock und einer Jacke genäht hatte. Nein, einen richtigen Mantel habe sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehabt.
(Wenig später wurde in Nürnberg ein Winterschlußverkauf eröffnet, in den zwischen den Ruinen errichteten Behelfsläden gab es Damenwintermäntel aus umgearbeiteter US-Ware, BESTE, STRAPAZIERFÄHIGE QUALITÄT, mit Webpelzfutter, sie kosteten fünfundzwanzig bis dreißig Mark.
Das hätte mir auch nichts genützt, auch wenn ich es gewußt hätte, sagt Hedwig. Soviel Geld habe ich für mich nicht ausgeben können, soviel Geld habe ich gar nicht gehabt.
Arbeitsjacken aus Wolle kosteten drei Mark fünfundsechzig, Gummiüberschuhe drei Mark fünfzehn bis vier Mark fünfzig. Die Ware war liegengeblieben, die Leute hatten sie nicht gekauft. Überall machte sich Geldnot bemerkbar.
Mit der Währungsreform, heißt es allgemein, habe der Konsum begonnen. Die Leute hätten die Geschäfte gestürmt und gekauft, was kaufbar gewesen sei.
Das ist ein Märchen, sagt Hedwig, davon sind nur sehr wenige betroffen gewesen. Die meisten Leute sind vor den Geschäften gestanden und haben in die Auslagen geschaut und die Sachen bestaunt, die es schon wieder gegeben hat. Wirklich kaufen konnten die wenigsten. Alles spricht von dem Aufschwung, sagt ein Geschäftsmann, der Ende der fünfziger Jahre nach Amerika ausgewandert ist, niemand spricht von der FLAUTE nach der Währungsreform.
Das zu Unrecht erworbene Geld der Schwarzhändler und Schieber war abgeschöpft worden, das durch Schwarzhandel und Betrug erworbene Geld, Haufen von Papiergeld waren zu wenigen Scheinen geschmolzen oder zu einem Häuflein Münzen, die Währungsreform hatte die neuen Reichen wieder arm gemacht, aber die Armen waren dadurch nicht reicher geworden.)