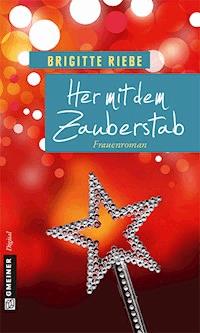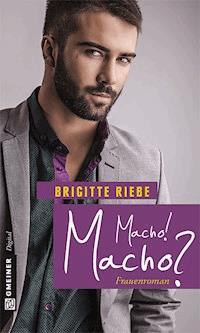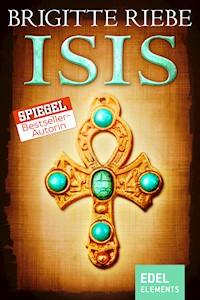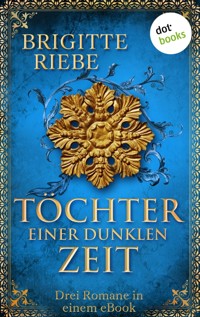9,99 €
Mehr erfahren.
Die dunkle Geschichte eines Meisterwerks
Wittenberg 1528: Bettelarm verschlägt es die ehemalige Nonne Susanna in die Lutherstadt. Dort trifft sie den Maler Jan aus der Werkstatt von Lucas Cranach, der drei junge Frauen nackt porträtieren soll. Mit verhängnisvollen Folgen: Kaum ist die erste der Grazien gemalt, wird sie tot aufgefunden. Eine zweite Frau steht Modell und wird lebendig begraben. Susanna, längst in Jan verliebt, bietet sich als Lockvogel an ...
Mehr als zehn Jahre sind vergangen, seit Martin Luther mit dem Anschlag der 95 Thesen dem Papst und der römischen Kirche den Kampf ansagte. Inzwischen lebt er zurückgezogen im Schwarzen Kloster zu Wittenberg, als Malerfürst Lucas Cranach der Ältere von einem geheimnisvollen Kunstsammler den Auftrag für das bis heute berühmte Bildnis der drei Grazien erhält. Zwei der ausgewählten Frauen stehen nackt Modell – und werden kurz darauf grausam getötet. Als der Auftraggeber Luthers Frau Katharina als Dritte im Bunde fordert, befürchtet der Reformator einen Racheakt für seine weltverändernde Kritik. Muss seine Frau dafür mit ihrem Leben bezahlen? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
BRIGITTE RIEBE
DIE GEHEIME
BRAUT
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Copyright © 2013 by Diana Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion | Dr. Herbert Neumaier
Umschlaggestaltung | t.mutzenbach design, München
Umschlagmotiv |© CollaborationJS/Arcangel Images
Vorsatz |© bpk | RMN – Grand Palais | Stéphane Maréchalle
Autorenfoto |© Schelke Umbach
Satz | Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ePub-ISBN 978-3-641-09036-4V002
www.diana-verlag.de
Für Susanna und Sibylle
Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen.
ALBERT EINSTEIN
Bevor man mit dem Malen beginnt, muss man Herz, Hand und Gedanken in der Pinselspitze haben.
CHI PO SHI
ERSTES BUCH: AGLAIA
ERSTES BUCH
AGLAIA
EINS
EINS
Bloß keine Angst. Wie eine endlose Litanei kreisten diese Worte in ihrem Kopf, ein schmales Scheit, an das sie sich verzweifelt klammerte, einziger Halt in einem Meer voller Ungewissheit.
Bloß keine Angst!
Das hatte sie auch Bini immer wieder gepredigt, die mit weißen Lippen neben ihr hergehumpelt war, auch wenn sie tapfer behauptete, sie könne noch tagelang weiterlaufen.
Sie waren aus Leipzig geflohen, Hals über Kopf, lediglich angetrieben von diffuser Hoffnung: Alles würde, alles musste besser werden in Wittenberg, doch jetzt …
»Nichts ist mir mehr zuwider als dreistes Diebesgesindel. Vor allem, wenn es blonde Locken hat und einen Rock trägt.«
Die Finger, die Susannas Handgelenk umklammert hielten, waren kräftig und von Farbspritzern übersät. Der Blick des Mannes, der auf sie herabschaute, kalt.
Sie spürte, wie Röte ihr Gesicht überflutete. Hatte sie gerade noch durchgefroren die Nähe des offenen Feuers gesucht, so glühte sie auf einmal am ganzen Körper. Die dumpfen Gerüche der Taverne nach Bier und Fett empörten ihren leeren Magen.
Plötzlich war ihr speiübel.
Warum nur tat sich kein gnädiges Loch auf, in dem sie versinken konnte?
»Das bin ich nicht«, stieß sie hervor.
Wie feig ihre Antwort klang, wie kraftlos! Hätte sie doch nur noch singen können wie früher, sie wären niemals in diese verzweifelte Lage geraten.
»Ach nein?« Seine Stimme troff vor Hohn. »Und was zum Teufel hatte deine Hand dann gerade in meinem Wams verloren?«
Sie schluckte, blieb ihm die Antwort schuldig.
»Ach, du wolltest mich eigentlich gar nicht bestehlen, sondern lediglich ein wenig aufreizen?«, fuhr er fort. »Dass ich da nicht gleich darauf gekommen bin! Nun, dann solltest du aber ein wenig mehr auf dein Äußeres achten. Wir haben hier in Wittenberg äußerst knusprige Hübschlerinnen, die ihre Dienste anbieten – und das nicht zu knapp.«
Sein Griff wurde härter. Mit der Linken hielt er sie wie in einem eisernen Schraubstock.
Susanna entfuhr ein Schmerzenslaut.
»Lass sie los – du tust ihr ja weh!« Bini, die sich bis jetzt im Hintergrund gehalten hatte, schoss wie ein zerzauster Sperling auf den Tisch zu. Zwischen den massiven Holzbänken und Tischen sah sie winzig aus, mit ihren staubigen Röcken, den wild fuchtelnden Händen und den aufsässigen Haaren, die wie ein rotblonder Heiligenschein vom Kopf abstanden. »Ja, wir haben Bärenhunger«, rief sie. »Mein kranker Fuß bräuchte dringend ein heilsames Kraut. Und wo wir heute Nacht schlafen sollen, wissen wir auch noch nicht.«
Zu Susannas Überraschung gab er sie tatsächlich frei, lehnte sich zurück und brach in schallendes Gelächter aus.
Die Köpfe der Männer an den Nebentischen flogen zu ihnenherum, alle jung, die meisten von ihnen vermutlich Studenten. Manche starrten sie nur an, andere lachten oder machten anzügliche Gesten. Binnen Kurzem würde die ganze schäbige Taverne wissen, dass sie soeben versucht hatte, diesem Mann an den Beutel zu gehen.
Öffentlich als Diebin bloßgestellt zu werden!
Susannas Scham hätte größer nicht sein können.
Wo waren die hellen Tage geblieben, aufgefädelt wie an einer endlosen Kette? Die Zweige der Birnbäume im Klostergarten, die ein Geflecht aus Licht und Schatten auf die jungen Beete geworfen hatten? Das Lied der Glocken, das sie viele Jahre beschützt und das Halt geboten hatte wie ein fest geknüpftes Netz?
Die Sehnsucht nach Sonnefeld schnürte ihr die Kehle zu.
Sie hatten nicht nur ihr Zuhause verloren, sondern auch alles andere dazu. Niemande waren sie nun, vogelfreies Pack, das von der Hand in den Mund leben und Tag für Tag um sein Leben bangen musste.
»Ihr arbeitet also zusammen, diese magere Kleine und du.« Der Mann schien sich nur langsam beruhigen zu können. Sein Blick war noch immer skeptisch, aber nicht mehr ganz so eisig. »Offenbar nicht erst seit gestern. Und durchaus erfolgreich, wie mir scheint.«
»Du hast ja nicht die geringste Ahnung«, wehrte Bini sich empört.
»Dann verrat mir doch, wie ihr es anstellt. Oder soll ich es dir sagen? Ich denke, es läuft so: Die eine macht drollige Scherze und wackelt dabei mit dem Hinterteil, während die andere den Männern an die Börse geht. Wie weit würdet ihr zwei es wohl treiben – sogar bis ins Stroh, nur um an ein paar Kupfermünzen zu kommen?«
»Wir sind ehrbare Frauen«, brachte Susanna mühsam hervor. »Bis vor Kurzem habe ich in Tavernen gesungen …«
»Eine Musikantin bist du?« In seinen Augen glomm ein Funken von Interesse. »Nun, das könnte mich unter Umständen milder stimmen. Dann lass hören, was du zu bieten hast!«
Ein paar Burschen am Nebentisch applaudierten, was Susanna nur noch verlegener machte.
Stumm schüttelte sie den Kopf.
»Meine Stimme – ist gebrochen«, sagte sie schließlich. »Mein Gesang klingt nur noch wie rostiges Krächzen. Das würde dir gewiss nicht gefallen.«
Sie neigte den Kopf bittend zur Seite. »Lass uns gehen, ich flehe dich an! Dir ist doch kein Schaden entstanden. Und du wirst uns auch niemals wiedersehen, das gelobe ich hoch und heilig.«
»Ja, wir werden gehen«, sagte er. »Gemeinsam.« Sein Blick glitt zu Bini, die ihn mit offenem Mund anstarrte. »Und ihr werdet keinen Fluchtversuch machen. Oder soll ich die Büttel rufen lassen, damit ihr einsichtig werdet?«
Mit gesenktem Kopf folgten sie ihm nach draußen. Die Blicke der Studenten bohrten sich in ihren Rücken. Bini humpelte inzwischen so stark, dass sie fast so unsicher ging wie eine Greisin.
Ein kühler Wind hatte sich erhoben, der die Wärme des Frühlingstages rasch vertrieb. Von Westen her zogen dunkle Wolken auf, die wie auch schon an den vorangegangenen Abenden Regen verhießen. Doch was die Bauern begrüßen mochten, die ausreichend Wasser für die junge Saat brauchten, war für jemanden, der kein Dach über dem Kopf hatte, eine Herausforderung.
Er war vor dem Gasthaus stehen geblieben und deutete nach Süden. »Von dort kommt ihr, stimmt’s?«
Susanna nickte vage.
»Und von wo genau?«, setzte er nach. »Aus Leipzig? Was hattet ihr dort zu schaffen?«
Die beiden Frauen tauschten einen raschen Blick. Sie hatten vereinbart, so wenig wie möglich über diesen Teil ihrer Vergangenheit zu verraten. Die bloße Erinnerung war schmerzlich genug.
»Ach, wir sind schon eine ganze Weile unterwegs«, murmelte Bini schließlich. »Mal hier, mal da …«
Offenbar hatte er nicht vor, weiter zu bohren, was sie verblüffte.
»Im Elbtor, durch das ihr gekommen seid, ist auch der Kerker Wittenbergs«, fuhr er stattdessen fort. »Ein finsteres Verlies, voller Ratten und anderem Ungeziefer, das auf Diebesgesindel wie euch nur wartet. Es sei denn, ihr zieht es vor, am Pranger zu stehen oder gar einen Daumen zu verlieren …«
»Hör sofort damit auf!«, fiel Bini ihm ins Wort. »Susanna und ich waren bis vor nicht allzu langer Zeit Bräute des Herrn, damit du es nur weißt! Und hätte man unser schönes Kloster nicht von einem Tag auf den anderen zugesperrt, so wären wir noch heute fromme Schwestern.«
»Ihr wart – Nonnen?« Die verdutzte Miene spiegelte seine Überraschung wider. »Ordensfrauen? Oder ist das nur eine neue freche Lüge?«
»Nein«, sagte Susanna, die erst jetzt spürte, wie unendlich müde sie war. Jeder einzelne Knochen tat ihr weh, und das Loch im Bauch fühlte sich so groß an wie ein Scheunentor. »Das ist die Wahrheit. Zisterzienserinnen waren wir, schon seit Jugendtagen. Aber unser Kloster gibt es nicht mehr. Und auch keine Familie, zu der wir zurückkehren könnten. So mussten Binea und ich eben zusehen, wie wir anderweitig zurechtkommen. Was beileibe nicht immer einfach war.« Ihre Lippen wurden schmal.
Seine Miene dagegen war plötzlich entschieden freundlicher geworden.
»Zwei Nonnen – ich fass es nicht! Dann braucht ihr erst einmal etwas Anständiges zu essen, gewiss nicht diesen Schweinefraß, den sie hier im Schwan auftischen. Ich werde euch ins Brauhaus bringen, das liegt direkt am Markt. Dort könnt ihr euch stärken.« Er wandte sich an Bini. »Wirst du es bis dorthin mit deinem lädierten Fuß auch schaffen? Gleich nebenan ist die Apotheke.«
»Meilenweit!«, versicherte sie, obwohl ihr stoßweiser Atem bei jeder Bewegung genau das Gegenteil verriet. »Aber wir haben kein Geld mehr. Nicht einen einzigen Pfennig – weder für Essen, und erst recht nicht für Verbände oder teure Salben.«
Er lachte erneut. Dieses Mal heller.
»Deine Offenheit gefällt mir«, sagte er, und in seiner Stimme schwang plötzlich Wärme. »Vielleicht habe ich ja sogar schon eine Idee, wo ihr später unterkommen könnt.«
Susanna musterte ihn beklommen.
Neben seinem linken Auge leuchtete ein violetter Fleck. Und deutete nicht auch der lange, kaum verschorfte Kratzer am Hals auf eine heftige körperliche Auseinandersetzung hin? An wen waren sie da geraten – an einen Maulhelden und Raufbold, vor dem sie Angst haben mussten?
»Wieso sollten wir ausgerechnet dir trauen?« Sie wich zurück. »Gerade eben wolltest du uns noch einsperren oder sogar verstümmeln lassen!«
»Habt ihr denn eine andere Wahl?«, fragte er zurück. »Außerdem mag ich Nonnen. Das hat mir schon meine Großmutter beigebracht, als ich noch ein kleiner Bub war. Anna hieß sie, lebte in Prag, und ich spreche beim Beten noch heute jeden Tag mit ihr. Worauf also wartet ihr?«
Sie trabten mit ihm, wortlos und in einigem Abstand, was ihn zu irritieren schien, denn er blieb immer wieder stehen, als befürchtete er, sie könnten es sich doch noch anders überlegen. Schließlich kam der Marktplatz in Sicht, gepflastert, von zwei- bis dreistöckigen Häusern umgeben, die alle in gutem Zustand schienen.
»Hier ist das Brauhaus.« Er war stehen geblieben. »Hinein mit euch!«
Der Gastraum war niedrig und gut besucht. Nur im hinteren Eck fand sich ein freier Tisch, an den er die beiden drängte. Ohne lange zu fragen, bestellte er Speisen und Getränke, dann begann er zu reden.
Bald schon kannten sie seinen Namen: Jan Seman aus Prag, Geselle beim berühmten Maler Lucas Cranach, der gleich nebenan eine große Werkstatt betrieb und sich vor Aufträgen kaum retten konnte. Das alles erzählte Jan wortreich, untermalt von zahlreichen Gesten, während Susanna und Bini schweigend ihren Hunger mit dem Dinkeleintopf stillten, in dem reichlich Schwarte schwamm. Zwei randvolle Teller hatte jede von ihnen bereits ausgelöffelt. Und auch von dem Brotlaib, den die rotwangige Wirtin auf den Tisch gestellt hatte, war kaum noch etwas übrig.
»Seit Monaten hab ich nicht mehr so gut gegessen!« Bini räkelte sich wohlig.
»Für fromme Schwestern zeigt ihr in der Tat erstaunlichen Appetit«, sagte Jan. »Und das hiesige Bier scheint euch ebenfalls zu schmecken. Soll ich noch einen Krug bringen lassen?«
Bini war schon drauf und dran zu nicken, doch Susannas besorgte Miene hinderte sie daran.
»Wieso tust du das?«, sprach sie Jan direkt an. »Du kennst uns nicht, und das Geld für das Essen müssen wir dir schuldig bleiben. Falls du dir allerdings einbilden solltest, wir würden dich auf andere Weise entlohnen …«
Sein Gesicht war auf einmal ganz nah.
»Sieh mich an!«, verlangte er. »Ich will, dass dir keines meiner Worte entgeht.«
Notgedrungen gehorchte sie.
»Ich muss mir keine Weiber kaufen«, sagte er, und sein singendes Deutsch hatte auf einen Schlag die warme Klangfarbe verloren. »Bislang sind sie alle noch immer freiwillig zu mir gekommen. Das solltest du dir merken!«
Seine Augen hatten die Farbe von dunklem Waldhonig. Die Nase war kräftig, aber nicht zu breit. Er schien noch keinen seiner Zähne verloren zu haben. Wenn er den Mund öffnete, schimmerten sie hell zwischen den vollen Lippen. Eine braune Strähne fiel ihm immer wieder in die hohe Stirn. Am anziehendsten aber war das Grübchen im Kinn, das ihm etwas Vorwitziges gab.
Susanna senkte den Blick.
Es gehörte sich nicht, Männer derart schamlos anzustarren, und sie nahm es ihm übel, dass er sie dazu gezwungen hatte. Sie wurde nicht recht schlau aus diesem Kerl, dessen Stimmungen so schnell zu wechseln schienen wie das Wetter an einem launischen Apriltag. Wieso nur war sie im Schwan ausgerechnet an ihn geraten?
»Wir brauchen keine Hilfe«, sagte sie trotzig. »Bisher sind wir auch allein ganz gut zurechtgekommen. Wir werden uns eine Scheune suchen und dort unser Nachtlager aufschlagen.«
»Ach ja? Dann wünsche ich dabei recht viel Vergnügen!«, entgegnete Jan grinsend. »Wittenberg wimmelt nur so von unbeweibten jungen Burschen. Für einen Besuch im Hurenhaus fehlt den meisten Studenten das Geld. Und die hiesigen Handwerksmeister halten ein scharfes Auge auf ihre ledigen Töchter, das darfst du mir glauben. Deshalb ist den Kerlen auch jede Gelegenheit willkommen …«
»Was genau hättest du uns denn anzubieten?«, fiel Bini ihm rasch ins Wort.
»Das beste Haus der ganzen Stadt«, sagte Jan. »Solltet ihr allerdings wagen, dort auch nur ein einziges Krümelchen zu stibitzen, bekommt ihr es mit mir zu tun!«
*
Die Frau, die ihnen im Torbogen entgegentrat, trug ein braunes Kleid, das ein hoher heller Kragen schmückte. Ihr rötliches Haar wurde von einem Netz zusammengehalten. In ihren Armen lag ein schlafender Säugling, während ein blondes Kleinkind an ihrem Rock zerrte.
»Hansi ist schon den ganzen Tag unruhig«, sagte sie, und in den schräg liegenden Augen erschien ein Lächeln. »Vorhin hat er so fest gegen die Wiege getreten, dass Elisabeth aufgewacht ist und wie am Spieß zu schreien begonnen hat. Seitdem trage ich sie lieber herum.«
»Ob er wohl eifersüchtig ist?« Jan beugte sich über das schlafende Mädchen. »Jetzt, wo dein kleiner Hans die mütterliche Liebe auf einmal teilen muss. Ist ihr Fieber denn inzwischen vorbei?«
»Du verstehst die Seele der Kinder wie kein anderer«, erwiderte die Frau. »Wahrscheinlich sind deshalb auch deine Rötelzeichnungen von ihnen so lebendig. Ich wünschte, du würdest bald neue machen. Unsere Kleinen verändern sich so schnell!« Sie wirkte auf einmal erschöpft. »Ja, Elisabeth wird gottlob langsam wieder gesund. Aber meine Angst bleibt. Sie erscheint mir wie ein zartes Blümchen, das schon der leiseste Windhauch zausen kann, während unser Johannes stark wie ein junger Baum ist.« Ihr Blick glitt zu den beiden Frauen, die schweigend zugehört hatten. »Wen bringst du mir da?«
»Hattest du nicht neulich gesagt, dass du dringend eine Magd brauchst, verehrte Lutherin? Ich weiß doch genau, wie bescheiden du immer bist. Deshalb bin ich auch gleich mit zweien auf einmal gekommen.«
Susanna und Bini wagten kaum noch zu atmen. Katharina von Bora – die Frau des Reformators!
In Sonnefeld hatten die Nonnen sich die Mäuler über sie zerrissen. Sie habe Luther verführt, sei eine Teufelshure und verdiene das Höllenfeuer, hatten die einen gegeifert, während andere neidisch alles verfolgten, was über sie zu ihnen drang. Kaltgelassen jedenfalls hatte keine der Schwestern das unerhörte Schicksal von Mönch und Nonne, die den Bund der Ehe geschlossen hatten. Alles Mögliche hatten sie sich unter dieser Katharina von Bora vorgestellt.
Doch jetzt stand eine anziehende junge Frau vor ihnen, mit starken Hüften und einem schlanken Hals. Sie roch ganz schwach säuerlich, das stieg Susanna als Erstes in die Nase. Genauso hatte die Tochter ihrer Leipziger Wirtin nach der Niederkunft gerochen. Was bedeutete, dass die Lutherin ihre Kleine noch stillte.
»Lieb gemeint, Jan Seman!« Katharina lächelte. »Aber in meinen Truhen herrscht leider wieder einmal Ebbe. Wir bräuchten dringend einen neuen Zaun, damit die Wildschweine nicht alles zertrampeln, das Dach ist undicht, und seit gestern leckt auch noch mein großer Wasserkessel, während Doktor Martinius unverdrossen über seinen Büchern hockt und von alledem nichts sieht und hört …«
Sie stieß einen Seufzer aus.
»Bin schon heilfroh, dass endlich Frühling ist und wenigstens in meinem Garten alles wieder sprießt und wächst. Wie sonst sollte ich die vielen hungrigen Mäuler an unserer Tafel satt bekommen?«
Hansi hatte sich losgemacht und lief zu Jan, der ihn hochhob und auf den Arm nahm. Die rundlichen Kinderbeinchen stießen ungeduldig gegen seinen Bauch.
»Fliegen!«, schrie der Kleine. »Hansi will fliegen!«
Jan warf ihn in die Luft, wieder und wieder, was der Kleine mit lautem Juchzen quittierte.
»Du wirst sie als Mägde nehmen, Kind, sei doch nicht dumm!« Energisch wurde Katharina von einer älteren Frau beiseitegeschoben. Über ihr knöchellanges Nachtgewand hatte sie ein dunkles Wolltuch geworfen. Ein dünner silberner Zopf baumelte über der linken Schulter.
»Muhme Lene – dass du niemals hören magst! Habe ich nicht ausdrücklich gesagt, du sollst im Bett bleiben und erst einmal dein Reißen auskurieren?«
»Ach was! Vom Herumliegen wird mein krummer Rücken auch nicht mehr gerade. Aber vier fleißige Hände könnten für uns alle äußerst nützlich sein.« Sie schob sich nah an Susanna und Bini heran und musterte sie ungeniert. »Eure Gesichter gefallen mir«, murmelte sie. »Mager, aber ehrlich. Sieht aus, als könntet ihr zupacken. Und das werdet ihr bei uns auch müssen. Jetzt will ich noch hören, woher ihr kommt und wie ihr heißt.«
»Es sind zwei ehemalige Nonnen«, antwortete Jan. »Mir haben sie gesagt …«
»Wir haben im Kloster Sonnefeld gelebt«, sagte Susanna schnell. »Ich bin Susanna, und das ist Binea, meine ehemalige Mitschwester. Und ja, wir würden sehr gerne für Euch arbeiten.«
»Nonnen? Das behaupten jetzt sehr viele. Und beileibe nicht alle sagen die Wahrheit.« Katharina reckte ihr Kinn und wirkte plötzlich unnahbar.
Bini schloss Daumen und Zeigefinger der linken Hand zu einem Kreis zusammen, eines der vielen stummen Zeichen, die sie im Kloster in den langen Schweigeperioden benutzt hatten.
Die traut uns nicht, bedeutete das. Sie fuhr mit der rechten Hand darüber. Wir werden sie überzeugen müssen.
Susanna hob den rechten Arm und berührte kurz ihre linke Hand an der Außenkante.
Schwierig! Wir werden uns nicht anbiedern. Nicht einmal hier.
Katharinas Blick war diesem stummen Dialog gefolgt. Ihr Mund hatte dabei seine Härte verloren.
»Ich kann euch nicht mehr als eine Kammer anbieten. Ja, ihr kommt aus einem Kloster, das weiß ich jetzt, sonst wären euch diese Zeichen nicht bekannt.« Ihre Stimme klang neutral. »Dazu freie Kost. Wenn die Herrn Studenten, die bei uns untergekommen sind, endlich ihre Börse zücken, möglicherweise auch ein paar Heller. Aber die Arbeit ist hart, beginnt früh und endet spät. Zeit zum Ausruhen gibt es kaum.«
»Daran sind wir gewöhnt«, sagte Susanna. »An harte Arbeit in einem christlichen Haus.«
Eine Antwort, die Katharinas Augen aufleuchten ließ.
»Wir könnten es miteinander versuchen«, sagte sie. »Einen Monat zunächst. Danach sehen wir weiter.«
Jan stellte Hansi zurück auf den Boden, der sofort zu weinen begann.
»Dann seid ihr also einig geworden«, sagte er. »Und ich kann zurück in die Werkstatt. Der Meister erwartet mich sicherlich bereits.«
»Fliegen! Fliegen!«, plärrte Hansi und streckte ihm trotzig die Ärmchen entgegen.
»Ganz bald wieder«, versprach ihm Jan, sah aber dabei Susanna eindringlich an. »Ich hoffe, ich bekomme nur Gutes über euch zu hören.«
Sie starrte zu Boden. Wenn er nur endlich weg wäre!
Seine bloße Anwesenheit schien ihre Haut zu verbrennen. Und wenn er schließlich doch noch sein freches Mundwerk auftat und preisgab, dass sie versucht hatte …
Jan schien dies nicht vorzuhaben, zumindest nicht heute. Er zog sich die Schaube halb über den Kopf, weil die ersten dicken Tropfen fielen, machte auf dem Absatz kehrt und ging schnell davon.
»Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man alles verloren hat«, drang Katharinas Stimme nach einer Weile an Susannas Ohr. »Vielleicht kann euch ja das ehemalige Schwarze Kloster zur neuen Heimat werden.«
»An uns soll es nicht liegen.« Bini machte einen unüberlegten Schritt nach vorn. Sofort wurde ihr Gesicht weiß und spitz vor Schmerz.
»Das mit deinem Fuß muss ich mir gleich einmal näher ansehen. Hab schon gesehen, wie unbeholfen du humpelst. Was ist es? Bloß wundgelaufen oder ein Fremdkörper, der sich ins Fleisch gebohrt hat?«
Binis Augen schienen auf einmal übergroß. Sie öffnete den Mund und schloss ihn wieder, ohne einen Laut von sich zu geben.
»Keine Angst, das wird schon wieder! Komm mit mir in die Küche, wo ich nebenan in der Speisekammer meine Kräuter aufbewahre. Dort wird sich sicherlich das Richtige für dich finden.« Katharina legte Susanna die kleine Elisabeth in den Arm. »Kennst du dich mit kleinen Kindern aus?«, fragte sie, ohne eine Antwort abzuwarten. »Nun, wenn nicht, dann wirst du es hier ganz schnell lernen. Schau nur, Hansi zupft schon verstohlen an deinem Rock!«
*
Der Alte hatte übelste Laune, das erkannte Jan schon beim Eintreten. Den Kopf nach vorn gereckt, den massigen Hals eingezogen, starrte Lucas Cranach finster auf die Risszeichnung, die sein Geselle Ambrosius auf eine mit Kreidegrund bearbeitete Holztafel übertragen hatte.
»Ich weiß wirklich nicht, weshalb ich dich überhaupt noch weiter durchfüttere«, brummte Cranach. »Das würde sogar mein Sohn Hans besser hinbekommen – und der ist gerade mal im zweiten Lehrjahr.«
Der fünfzehnjährige Hans Cranach begann breit zu grinsen, während Ambrosius’ eckige Schultern noch tiefer sackten. Der hartnäckige Husten, der den Gesellen den ganzen Winter über gequält hatte, war noch nicht gänzlich verschwunden und hatte nicht nur das Fleisch von seinen Knochen gefressen, sondern ihn zudem noch anfällig für allerlei weitere Leiden gemacht. Dabei war er einer der Besten, was Landschaften betraf, und das wusste der Alte nur zu genau. Trotzdem hatte er ausgerechnet Ambrosius damit beauftragt, das ungleiche Paar, einen betagten Mann und sein junges Weib, zu skizzieren.
Die Pest, die Wittenberg im vergangenen Jahr gebeutelt hatte, hatte auch die Besetzung der Werkstatt stark dezimiert. Zwei Gesellen und drei Lehrlinge waren an der Seuche gestorben. Jetzt gab es außer Jan und Ambrosius nur noch die Gesellen Simon und Paul, beide ungefähr in Jans Alter, sowie die zwei Cranach-Söhne Hans und Luc, die vom Vater ausgebildet wurden. Nachschub sollte irgendwann eintreffen, denn Cranachs Kunst war im ganzen Reich bekannt.
Die Frage war lediglich, wann.
Schon lange musste die Arbeit an den Bildern aufgeteilt werden, denn Cranach hatte mit seinen Hauserwerbungen und Wiederverkäufen, der Apotheke, den Druckaufträgen, in die er viel investiert hatte, und regelmäßigen Sitzungen im Stadtrat bereits jede Menge zu tun.
»Das lässt sich doch rasch wieder ausbügeln«, sagte Jan, den der Gescholtene rührte. »Ein paar Striche – und das gesamte Ensemble …«
»Ach, auch endlich zurück?« Cranach fuhr zu ihm herum. »Ich hatte beinahe befürchtet, dass der werte Herr Seman uns womöglich erst morgen früh wieder mit seiner Anwesenheit beehren würde.«
»Ihr hattet mir den Nachmittag freigegeben«, erwiderte Jan ruhig. »Und den Abend dazu. Schon vergessen?«
Die beiden starrten sich an. Nicht das erste Mal, dass sie aneinandergerieten. Schließlich machte Cranach eine ungeduldige Handbewegung.
»Egal. Jetzt bist du ja da. Ambrosius soll sich um die Lasur der Tafel für das neue Frauenporträt kümmern. Das zumindest wird er ja wohl zustande bringen! Und ihr Buben säubert die Pinsel – ordentlich, sonst könnt ihr was erleben.« Er griff nach seinem schwarzen Barett. »Komm, wir gehen!«
»Du willst noch einmal fort?« Die hohe Stimme von Barbara Cranach, die unbemerkt die Werkstatt betreten hatte, durchschnitt die angespannte Stille. »Aber das Essen ist so gut wie fertig. Und jeder Braten wird trocken und zäh, wenn man ihn zu lange auf dem Feuer lässt.«
Sie besitzt die Eigenschaft, sich unsichtbar zu machen, dachte Jan, kann kommen und gehen wie ein Geist. Selbst wenn man sie eine ganze Weile anschaut, weiß man doch hinterher nicht mehr genau, was man gesehen hat. Dabei ist ihr volles Gesicht mit den hellblauen Augen alles andere als unansehnlich, und im flachsblonden Haar schimmern noch keine Silberfäden. Fünf Kinder hat sie dem Alten geboren – und ist doch auf keinem einzigen seiner bisherigen Gemälde verewigt, als vergesse der Maler zwischendrin selbst, mit wem er eigentlich verheiratet ist.
»Hör auf, meine Frau so gierig anzustarren!«, sagte Cranach ungehalten. »Du weißt ganz genau, dass ich das nicht leiden kann. Deine stadtbekannten Possen als Weiberheld sind in diesen Mauern nichts wert, Seman! Was du in den Elb-Auen anstellst, soll mir egal sein. Aber bis du eine anständige Braut freien kannst, musst du noch deutlich an Fleiß und Ausdauer zulegen, sonst wird nichts daraus.«
Er zwinkerte Barbara zu.
»Und jetzt will ich sofort ein freundliches Gesicht sehen. Denn wäre dein Mann nicht so geschickt im Auftreiben neuer Aufträge, gäbe es weder dieses geräumige Haus noch die Küche, in der du nach Herzenslust befehlen kannst. Also hör auf zu lamentieren, gieß lieber ein bisschen Bier zum Braten, und heb uns zwei anständige Portionen auf, damit wir unseren Hunger später stillen können!«
Er griff nach einer Laterne, die er schon bereitgestellt hatte, und ging so schnell hinaus, dass Jan sich anstrengen musste, ihm zu folgen.
Schon nach wenigen Schritten war Jan klar, wohin es ging.
»Ihr wollt zum Schloss?«, fragte er halblaut. »Dann ist es also der Kurfürst, der …«
»Ist es nicht«, unterbrach ihn Cranach. »Seine Hoheit weilt in Meißen. Und dir rate ich, den vorlauten Schnabel heute Abend nicht allzu weit aufzureißen. Mein Auftraggeber wünscht äußerste Diskretion. Die wird er auch bekommen.«
»Wozu braucht Ihr dann mich?«
»Das wirst du schon noch rechtzeitig erfahren.« Inzwischen ging Cranach so schnell, dass Jan Seitenstechen bekam. Er verstummte für den Rest des Weges und konzentrierte sich darauf, gleichmäßig zu atmen.
Lucas Cranach steuerte nicht das Hauptportal des Schlosses an, sondern einen Seiteneingang, den man sehr leicht hätte übersehen können. Aber der Maler hatte die ersten Jahre seiner Zeit in Wittenberg in der Residenz gelebt und kannte sich daher bestens dort aus.
Er ließ den grünspanigen Klopfer gegen das Holz schlagen. Erst geschah nichts, dann öffnete sich die Tür, und sie wurden eingelassen.
Ein gebeugter Diener führte sie eine schmale Treppe hinauf. Die Holzstufen knarrten unter ihren Stiefeln. Dann waren sie in einem dunklen Gang angekommen.
Der Diener verbeugte sich und verschwand.
»Du verziehst dich jetzt auf der Stelle in das Gemach zur Linken.« Cranachs Stimme klang auf einmal heiser vor Anspannung. »An der Wand hängt eine große Leinwand. Diese wirst du eine halbe Handbreit nach rechts rücken – behutsam, versteht sich. Durch den Spalt kannst du nach nebenan schauen. Und alles mitanhören, was gesprochen wird.«
»Aber wozu …« Jan erhielt einen kräftigen Stoß, der ihn taumeln ließ.
»Tu einfach, was ich dir sage! Wenn du mich dreimal klopfen hörst, kannst du wieder herauskommen.« Cranach nahm ihm die Laterne aus der Hand und schob ihn durch die Tür.
Drinnen mussten sich Jans Augen erst einmal an die Dunkelheit gewöhnen. Ein Tisch mit vier hohen Stühlen, zwei schwere geschnitzte Truhen. An der Längsseite hing eine große Leinwand.
Er näherte sich, schob sie vorsichtig zur Seite.
Nicht einen Augenblick zu früh.
»Ihr seid spät, Meister Cranach.« Die Stimme des Mannes, die zu ihm drang, war tief und melodisch. »Dann scheint es also zu stimmen, was von Euch behauptet wird – dass Ihr satt und träge geworden seid?«
»Keineswegs, Herr …«
»Keine Namen!« Die tiefe Stimme war schärfer geworden. »Das hatten wir doch vereinbart.«
»Ganz, wie Ihr wünscht.« Cranach verbeugte sich leicht.
Das Gemach nebenan war spärlichst erleuchtet. Ein Kandelaber mit zwei brennenden Kerzen, das war alles, was es an Licht gab.
»Dann lasst uns rasch zum Eigentlichen kommen. Ich hasse es, unnötig Zeit zu verlieren. Ich wünsche mir ein Gemälde von Euch, Meister Cranach – ein spezielles Gemälde. Das Motiv dürfte Euch nicht unbekannt sein, vermutlich aber die besondere Ausführung, die ich mir vorgestellt habe.«
Der Mann hatte seine Position verändert. Er war schlank und mittelgroß, mit den ausgewogenen Proportionen eines Reiters.
Ein Soldat, dachte Jan unwillkürlich. Jede seiner Bewegungen verrät Geschmeidigkeit und Kraft.
»Die drei Grazien sollen es sein«, fuhr der Mann fort. »Aglaia,Thalia, Euphrosyne.« War das ein unterdrücktes Lachen? »Wenn Ihr unbedingt wollt, könnt Ihr sie mit durchsichtigen Schleiern ausstatten. Mehr allerdings sollten sie nicht am Leibe tragen.«
»Ein Nacktbild also«, sagte Lucas Cranach. »Dafür hättet Ihr Euch den ganzen Aufwand allerdings sparen können! Wie Ihr wisst, habe ich schon viele mythologische Motive gemalt …«
»Ich war noch nicht ganz zu Ende«, sagte der Mann. »Und schreibt mir nicht vor, was ich zu tun oder zu lassen habe, sonst werden unsere Wege sich rasch wieder trennen. Dieses Mal werdet Ihr keine der Vorlagen aus Eurer Werkstatt nehmen, wie Ihr sie so gern verwendet, verstanden? Ich verlange, dass Ihr mit lebenden Modellen arbeitet. An anderem bin ich nicht interessiert.« Er hatte hastig gesprochen, als läge ihm daran, die Angelegenheit rasch hinter sich zu bringen.
»Ich könnte im Frauenhaus anfragen.« Cranach klang wenig begeistert. »Ab und an ist schon mal eine bereit, sich für Geld nackt malen zu lassen.«
»Keine Huren!«, rief der Mann. »Von denen will ich keine auf diesem Gemälde haben. Nein, es sollen anständige Frauen sein, die den drei Grazien Gesicht und Körper leihen – frei von jeglicher Täuschung, wenn Ihr versteht, was ich meine.«
In der Erregung hatte er beim Reden seinen Kopf seitlich gedreht, und Jan konnte sehen, was die ungewissen Lichtverhältnisse bislang verborgen hatten. Die linke Gesichtshälfte des Mannes schimmerte schwärzlich. Er trug eine Halbmaske aus Metall, die ihn abstoßend, ja, fast diabolisch wirken ließ.
Unwillkürlich trat Jan einen Schritt zurück, um gleich danach die Stirn noch fester gegen die Wand zu pressen.
»Ihr wisst, dass das unmöglich ist.« Cranach sprach beschwichtigend wie zu einem aufsässigen Kind. »Keine anständige Frau würde sich unbekleidet einem Maler zeigen.«
»Dann macht es möglich! Es soll Euer Schaden nicht sein. Ganz im Gegenteil.« Der Mann hatte eine Börse hervorgezogen und wedelte damit vor Cranach hin und her, bevor er die Geldstücke auf den Tisch schüttete. »Und das für ein kleines Ölbild auf Holz – na, ist das vielleicht kein verlockendes Angebot?«
»Aber das sind ja hundertfünfzig Gulden«, murmelte Cranach erschrocken.
Jan stockte der Atem.
Die Summe war horrend. Maßlos. Und doch überaus verführerisch.
»Fünfzig als Anzahlung. Die könnt Ihr gleich mitnehmen, falls wir uns einig werden. Fünfzig, wenn zwei der Frauen fertig gemalt sind, und der Rest nach Fertigstellung. Allerdings muss ich noch weitere Bedingungen stellen. Ihr werdet mit der Figur der Aglaia beginnen.«
»Wenn Ihr denn unbedingt wollt …«
»Modell dafür wird Euch Margaretha Relin stehen, die junge Frau des Apothekers.«
»Wir stellt Ihr Euch das vor?«, fuhr Cranach auf. »Die beiden sind gerade mal zwei Jahre verheiratet!«
»Eure Angelegenheit, nicht meine«, sagte der Mann mit der Maske. »Gehört die Apotheke nicht Euch? Dann dürfte es doch nicht allzu schwer sein, Relin dazu zu bewegen.«
»Er ist mein Angestellter, nicht mein Sklave«, sagte der Maler dumpf. »Und was sein Weib betrifft, so …«
Eine behandschuhte Hand schob die schweren Münzen zurück in die Börse.
»Dann vergesst unser kleines Gespräch von eben sofort wieder! Es hat niemals stattgefunden«, sagte der Mann. »Einen schönen Abend noch, Meister Cranach!« Er wandte sich zum Gehen.
»Halt! So wartet doch!« Cranach hatte den fetten Köder geschluckt, das war Jan klar. »Ihr müsst mir schon ein wenig Zeit geben, mich an solch eine Vorstellung zu gewöhnen.«
»Zeit?« Das Lachen des Maskenmanns klang bitter. »Damit wären wir schon bei der nächsten meiner Bedingungen angelangt. Das Bild muss fertig sein bis zum Fest von Mariä Himmelfahrt. Schafft Ihr das?« Er hatte die Börse erneut geöffnet und zählte fünfzig harte Gulden auf den Tisch.
»Das ist ja ein Höllentempo, was Ihr von mir verlangt! Und die anderen beiden nackten Frauen?«, rief Cranach. »Wer sollen die sein? Etwa Fürstinnen? Oder gar Königinnen? Was an Unvorstellbarem habt Ihr Euch weiter ausgedacht?«
»Gemach, gemach!«, rief der Maskenmann. »Ihr werdet es als Erster erfahren. Zur rechten Zeit.« Er streckte ihm die Hand entgegen. »So sind wir also miteinander im Geschäft, Meister Cranach?«
Jan sah, wie der Alte eine Weile zauderte, dann aber schlug er ein.
Jan trat von der Wand zurück, schob die Leinwand zurück an die richtige Stelle. Als wenig später die drei vereinbarten Klopftöne erklangen, verließ er rasch das Gemach.
Sie blieben beide stumm, den ganzen Weg die Treppe hinunter, und auch noch, als sie das Schloss durch den Nebeneingang wieder verlassen hatten. Ein paar Tropfen fielen, und der Wind hatte aufgefrischt. Jan konnte spüren, wie die Spannung wuchs, bis sie wie ein blankes Schwert zwischen ihnen schwebte.
Plötzlich hielt es er nicht länger aus.
»Ihr wisst, ich kann schweigen«, brach es aus ihm heraus. »Und selbst wenn es Euch inzwischen leidtun sollte, dass Ihr mich mitgenommen habt …«
»Tut es nicht. Ganz im Gegenteil.« Cranach war unvermittelt stehen geblieben. »Ganz Wittenberg tuschelt darüber, wie sehr du dir die Weiber gewogen zu machen verstehst. Jetzt wirst du Gelegenheit erhalten, deine Kunstfertigkeit auch für mich unter Beweis zu stellen.«
»Was wollt Ihr damit sagen?«, fragte Jan misstrauisch.
»Nun, ganz einfach: Du wirst es sein, der für unseren Kunden Margaretha Relin als nackte Aglaia malen wird.«
*
Griet Hutinger war besser als die Frauenwirte, die er jemals erlebt hatte, strenger als Kunz Rieger, der für ihn zunächst das Freudenhaus am Markt von Leipzig geführt hatte, unvergleichlich ehrlicher als dessen Nachfolger Jörg Brandmann, dem er ständig auf die Finger hatte schauen müssen, weil er gestohlen hatte wie ein Rabe.
Und auch das Haus am Elstertor erwies sich schon nach Kurzem als Glücksgriff: weit genug von der Marienkirche entfernt, um nicht die Gemüter der ehrbaren Bürger zu erhitzen, aber doch bequem genug zu erreichen, wenn jemanden nach käuflicher Gesellschaft verlangte. Dabei hatte er anfangs mit der Anmietung des zweistöckigen Gebäudes gezögert, weil ihm die zwölf Kammern zu niedrig und eng und die beiden Stuben zu schäbig erschienen waren, um zu Weinkonsum und Glücksspiel einzuladen. Doch kaum hatte das neue Frauenhaus seine Pforten geöffnet, strömten schon die Freier herbei, mittlerweile so zahlreich, dass das alteingesessene Hurenhaus am nördlichen Holzmarkt um seine Existenz zu fürchten hatte.
Natürlich kam ihm entgegen, dass die Lehre Luthers die meisten der einstmals katholischen Feiertage hatte verschwinden lassen, an denen ein Besuch im Frauenhaus streng verboten gewesen war – einer der Gründe, warum er sich für Wittenberg entschieden hatte, doch bei Weitem nicht der einzige.
Er trat in eine Toreinfahrt, nahm den Umhang ab und wendete ihn. Das schlichte Grau, mit dem er bislang durch die Stadt gegangen war, machte prächtigem karmesinroten Tuch Platz, das als Innenfutter verborgen gewesen war. Als er nun auch die Maske angelegt hatte, kam er sich unbesiegbar vor.
Sein Plan würde gelingen.
An Tagen wie diesem zweifelte er nicht länger daran. Allen würde er zeigen, mit wem sie zu rechnen hatten: einem stolzen, kühnen Mann, den nichts und niemand von seinem Vorhaben abhalten konnte.
Trotzdem sah er sich nach allen Seiten um, bevor er den Schlüssel hervorkramte und in das Schloss der rückwärtigen Tür steckte.
Geschmeidig sprang sie auf, wonach er den Gang entlanglief und schließlich die untere Stube betrat.
»Patron!« Griet sprang sofort auf. Außer ihr war niemand in dem niedrigen Raum, was bedeutete, dass alle Hübschlerinnen bei der Arbeit waren, ein Gedanke, der ihm gefiel. »Eigentlich hatte ich erst morgen mit Euch gerechnet …«
»Hast du die Abrechnung fertig?«
»Gewiss. Ich geh sie sofort holen.«
»Warte!« Er ließ sich auf die Bank fallen. »Was ist mit der kleinen Schwangeren?«
»Das Problem ist gottlob inzwischen aus der Welt«, sagte sie. »Erst wollte Els das Gebräu aus Immergrün, Lorbeer und Nelkensud nicht trinken. Da mussten wir leider ein wenig nachdrücklich werden.« Sie schob sich eine dunkle Locke hinter das Ohr. Griet war füllig und heißblütig, hatte schwere Brüste und wiegende Hüften, die ihr enges helles Kleid unterstrich. Der Typ Weib, der Männer rasch um den Verstand bringen konnte – und doch offenbar heilfroh, nicht mehr selbst die Beine breit machen zu müssen. »Ein, zwei Wochen vielleicht, dann ist sie wieder einsatzbereit. Im Grunde macht sie ihre Arbeit gar nicht schlecht. Els muss nur noch lernen, mehr aus sich herauszugehen. Das mögen die Männer nämlich.«
»Gut. Du kannst sie ja anlernen. Damit wäre uns allen geholfen. Und jetzt gib mir einen Becher Wein!«
Sie schenkte ihm ein, er trank, schluckte aber den Roten nicht hinunter, sondern spie ihn ihr angeekelt entgegen.
»Was ist das denn für ein widerlicher Fusel! Willst du unsere Freier mit aller Macht vergraulen?«
»Aber ich dachte …« Ihre Hände fuhren an ihr besudeltes Mieder, dann sanken sie wieder hinab. » Wir sollten sparsam wirtschaften …«
»Zum Denken hast du mich, verstanden?«, bellte er. Sie nickte rasch. »Du wirst bezahlt, damit du meine Anordnungen ausführst. Kapiert?«
Sie nickte abermals.
»Du kümmerst dich sofort um besseren Wein, denn wer mehr trinkt, kommt nicht nur schneller auf geile Gedanken, sondern auch in Spiellaune.« Dass alle Würfel im Frauenhaus präpariert waren, bedurfte keiner Erwähnung. »War teuer genug, eine Schankgenehmigung vom Rat der Stadt zu erhalten! Jetzt geht es darum, all das schöne Geld so schnell wie möglich wieder hereinzuholen.«
Die Genehmigung lief auf Griet, wie so manches andere auch. Ihm war es gelungen, sich gänzlich im Hintergrund zu halten. Niemand konnte seinen Namen mit dem neuen Frauenhaus in Verbindung bringen. Darauf hatte er peinlich geachtet.
»Ihr werdet zufrieden sein, Patron. Wir haben mehr als anständige Einnahmen.« Griet strich ihre Röcke glatt und wollte schnell an ihm vorbei.
Er packte ihre Hand, zwang sie, nah neben ihm stehen zu bleiben.
»Und wenn ich eines Tages dein Kunde sein wollte?«, fragte er heiser. »Was dann, schöne Griet?«
Sie drehte den Kopf zur Seite, weil sie seinen Geruch nicht ertragen konnte. Gleichzeitig wehte sie etwas Kaltes an, das ihr die Kehle eng werden ließ. Einmal nur hatte er eine der Frauen angerührt, sie aber dabei so übel zugerichtet, dass sie ungeachtet ihrer Blessuren heimlich aus Wittenberg geflohen war. Ein Student hatte später berichtet, sie sei in Jena bei einem Bader untergekommen. Dem Patron hatte sie kein Wort davon verraten – und genauso würde sie es auch weiterhin halten.
»Ich führe doch hier Eure Geschäfte«, sagte sie mit einem bemühten Lachen, das sie schwer genug ankam. »Wie könnte ich mich da mit Euch zum Vergnügen auf dem Lager wälzen?«
Er lachte ebenfalls, doch es klang auch gequält.
Und während Griet nach oben lief, um die dunkle Holztruhe mit den blanken Münzen zu holen, schlug ihr Herz so fest gegen die Brust, dass sie Angst bekam, es würde beim nächsten Atemzug herausspringen.
*
Etwas Weiches streifte ihr Kinn, und als Susanna es wegwischen wollte, drang ein hohes Fiepen an ihr Ohr.
»Bissu wach?«
Das Kitzeln wurde stärker. Das Fiepen lauter.
Sie öffnete die Lider – und blickte direkt in Hansis wasserhelle Augen. Auf ihrer Brust saß ein rotweiß gestreiftes Kätzchen, kaum größer als eine Männerhand.
Es schien Hansi zu gefallen, dass sie nicht länger schlief, denn er griff nach ihrem Zopf und zog beherzt daran.
»Aua!« Susanna fuhr hoch, und die kleine Katze purzelte fiepend hinunter. »Willst du mir vielleicht die Haare einzeln vom Kopf reißen?«
Ein Gedanke, der ihm zu gefallen schien, denn er brach in lautes Juchzen aus.
»Isse wach!«, krähte er. »Susa isse wach!«
Wie rasch man sich an so ein kleines Wesen gewöhnen konnte!
Susanna packte Hansi, drückte ihn fest an sich und begann nun ihn zu kitzeln. Er wand sich und strampelte, lachte aber dabei aus vollem Hals.
»Hansi will fliegen!«, verlangte er, als sie ihn wieder losgelassen hatte.
»Freilich«, sagte Susanna und sprang auf. »Den ganzen Tag nur fliegen – das würde dir so passen. Aber dazu wirst du mir langsam zu schwer, junger Mann.«
Der Lärm hatte auch Bini geweckt, die schlaftrunken zu ihnen herüberblinzelte. Die Kammer, die Katharina von Bora ihnen zugewiesen hatte, bestand aus zwei ehemaligen Zellen, zwischen denen man die Wand herausgerissen hatte. Sie war gerade geräumig genug, um Platz für zwei Strohsäcke zu schaffen und die paar Habseligkeiten, die sie auf ihrer Flucht mitgenommen hatten.
»Ich bin noch so müde, dass ich heulen könnte«, murmelte Bini. »Dabei sind wir doch im Kloster noch viel früher aufgestanden!«
»Aber da hatten wir wenigstens feste Zeiten zum Beten und Meditieren. Hier dagegen schuften wir von morgens bis in die Nacht.«
Susanna schlüpfte in ihr Kleid und schloss das Mieder. Noch immer vermisste sie das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das ihr der strenge weiße Habit mit Schleier, Skapulier und Zingulum stets geschenkt hatte. In dem ausgeleierten blauen Stoff dagegen fühlte sie sich ungeschützt, männlichen Blicken wehrlos ausgeliefert. Dabei hätte ihr Gewand eine Wäsche längst dringend nötig gehabt. Doch das Ersatzkleid, das sie dann hätte tragen müssen, war noch fadenscheiniger.
Sie wollte Hansi den Rosenkranz aus der Hand nehmen, den er heimlich aus ihrem Bündel gezogen hatte, aber der Kleine machte keinerlei Anstalten, ihn wieder loszulassen. Der Rosenkranz bestand aus einfachen Holzperlen, die Schwester Laureata eigens für Susanna geschnitzt hatte; die Schnur, auf der sie aufgezogen waren, war im Lauf der vielen Jahren brüchig geworden – und riss plötzlich.
Die Perlen kullerten auf den Boden, was Susanna Tränen in die Augen trieb, während Hansi abermals laut aufjauchzte.
»Das ist heilig – heilig! Verstehst du?«, rief sie. »Auch wenn deine Eltern das Ave Maria inzwischen verwerfen. Bini und ich beten noch immer zur Mutter Gottes, so wie wir es gelernt haben.«
Er sah sie so aufmerksam an, als verstünde er jedes Wort.
»Heilig«, wiederholte er schließlich mit großem Ernst. »Heilig …« Dann lief er hinaus. Die gestreifte Katze folgte ihm mit hoch erhobenem Schwanz.
Susanna bückte sich nach dem Kreuz des Rosenkranzes, hob es auf und drückte es an ihre Brust.
»Nach der Arbeit sammeln wir sie alle ein und ziehen sie neu auf«, sagte Bini tröstend, die inzwischen ebenfalls aufgestanden war und ihr Kleid überstreifte. »Einstweilen müssen wir eben ohne Perlen beten. Ist doch ohnehin alles in unseren Köpfen. Und in unseren Herzen erst recht.«
Sie begann am Stoff zu schnüffeln.
»Ich stinke wie ein Iltis«, sagte sie schließlich. »Und dir dürfte es nicht viel anders gehen. Daran sind all diese Tiere schuld, die es hier gibt: Hühner, Gänse, Tauben, Kaninchen, Zicklein, vor allem aber diese Sauen, die ständig im Dreck wühlen. Hast du schon gehört, dass sie demnächst auch noch eine Kuh anschaffen will? Dann werden wir eine richtige Arche Noah haben. Höchste Zeit, dass wir große Wäsche machen, Susanna! Katharina hat mir eine Stelle am Fluss gezeigt, wo die Frauen zum Schrubben hingehen. Am nächsten sonnigen Tag werde ich mich mit unseren Sachen dorthin auf den Weg machen.«
»Schaffst du das denn mit deinem Fuß?« Susanna klang skeptisch.
Bini begann zu strahlen.
»Katharinas Salbe aus Kamille und Arnika hat wahre Wunder gewirkt.« Sie hielt Susanna ihren Fuß hin. »Sieh nur, die Wunde hat sich schon fast geschlossen! Aber warum ziehst du denn auf einmal ein so finsteres Gesicht?«
»Ich schaue drein wie immer«, verteidigte sich Susanna. »Und von geschlossen kann bei Gott noch keine Rede sein!«
Der Fuß war im Nu wieder verschwunden.
»Ach, jetzt weiß ich es: Weil doch heute eigentlich dieser Jan zu uns ins Schwarze Kloster kommen wollte. Aber er ist leider verhindert. Sein Meister soll daran schuld sein. Das hab ich die Lutherin gestern zur Muhme sagen hören.«
»Und wenn schon! Nichts auf der Welt könnte mir gleichgültiger sein«, fuhr Susanna auf.
Bini stupste zart gegen die Wange der Freundin.
»Du warst schon immer eine grottenschlechte Lügnerin«, sagte sie grinsend. »Aber genau das mag ich so an dir.«
ZWEI
ZWEI
Jede Frau besaß ihren ganz eigenen Duft, das hatte Jan im Lauf der Jahre nach und nach herausgefunden. Manche rochen wie eine sommerliche Blumenwiese, andere nach Heu oder exotischen Hölzern, wieder andere säuerlich wie eingelegtes Kraut. Der Duft war schwach, solange man noch ein ganzes Stück von ihnen entfernt war, intensivierte sich jedoch beim Näherkommen. Den höchsten Grad gewann er, sobald er sich mit den Säften der Liebe vermischte, aufstieg und sich wie ein Gewächs verbreitete, das die Zweige kühn nach allen Richtungen reckte.
Beim Anblick von Margaretha Relin musste Jan stets an eine Truhe denken, die bis obenhin mit frisch gewaschener Wäsche gefüllt war, so klar und sauber roch sie, anständig, fast unschuldig. Dabei saß ihr der Schalk in den großen grauen Augen, und die Hände, die ständig etwas an der bieder aufgesteckten Zopffrisur zu zupfen hatten, vollführten beim Reden einen koketten Tanz. Ihre Gelenke waren schmal, die Finger aber lang und kräftig, Hände einer Seifensiedertochter, die durchaus zupacken konnten.
Sie mochte ihn, das wusste er schon seit seinen ersten Besuchen in der Apotheke. Sie wärmte sich an seinem frechen Lachen und den kleinen Scherzen, die er machte, während sie die bestellten Pigmente, Kräuter und Gewürze zusammensuchte und so sorgfältig verpackte, als würde er mit ihnen auf große Reise gehen wollen und sie nicht nur die paar Schritte nach nebenan in Cranachs Werkstatt tragen. Meist war sie freundlich und schien heiter, bisweilen aber konnte er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie an Melancholie litt. Mehr als einmal war Jan schon drauf und dran gewesen, sie nach den Gründen zu fragen, doch dazu war es bislang nicht gekommen, denn er ahnte auch so, was sie bedrückte.
Einmal in all der Zeit hatte Margaretha sich verraten und ihm verschämt die teure Wiege aus Buchenholz gezeigt, die sie vom Zimmermann hatte schnitzen lassen. Dass diese Wiege noch immer leer war, darüber wurde in Wittenberg eifrig getuschelt. Da hatte er sich wohl verrechnet, der gestandene, bereits in die Jahre gekommene Apotheker Alwin Relin mit seinem gebeugten Rücken und dem silbernen Schopf, der geglaubt hatte, mit einem blutjungen Weib im Nu einen ganzen Stall gesunder Kinder zeugen zu können.
Nicht schnell genug hatte es ihm mit der Brautwerbung gehen können, kaum dass seine brave Gerusch unter der Erde war, die in all den Ehejahren niemals von ihm schwanger geworden war. Ein frisch renoviertes Haus hatte Relin flugs von Meister Cranach angemietet, um dort ungestört dem Honigmond mit Margaretha zu frönen. Das lag inzwischen beinahe drei Jahre zurück – und noch immer wartete er vergeblich auf den ersten Nachkommen.
Die Sorge wegen einer kinderlosen Zukunft hatte erste feine Linien in Margarethas glattes Mädchengesicht gestichelt, und die dunklen Augenschatten zeugten von schlaflosen Nächten. Beim Verpacken von Lapislazuli, Malachit, Zinnober und all den anderen Kostbarkeiten hielt sie den Kopf heute gesenkt und mied Jans Blick.
Er wusste plötzlich nicht mehr weiter.
Margaretha wirkte so abwesend, so sehr in sich gekehrt – wie in aller Welt sollte er da das unmögliche Anliegen zur Sprache bringen, das der Meister ihm aufgetragen hatte?
Jan räusperte sich, rang nach Worten und fand doch nicht die richtigen. Aber es musste gelingen! So vieles hing davon ab, dass er sich hier und heute als Herr der Situation erwies.
Er griff unter ihr Kinn und hob es sanft an.
»So traurig?«, fragte er leise. »Das kann ich bei einer so schönen Frau wie Euch kaum ertragen.«
»Ich und schön – dass ich nicht lache!«, gab sie gereizt zurück. »Mein Hals ist zu kurz, die Nase zu knollig, das Becken nicht breit genug. Und was das andere betrifft …« Sie stieß seine Hand weg. »Spart Eure Komplimente lieber für jene auf, die es verdienen!«
»Nur ein Blinder könnte bei Eurer Schönheit unberührt bleiben«, fuhr Jan unbeirrt fort. »Sagt, habt Ihr denn bei Euch zu Hause alle Spiegel zerschlagen?«
Jetzt musste sie wider Willen doch ein wenig lächeln.
»Wir hatten nur zwei, und der eine ist längst ruiniert. Den anderen hab ich in der Truhe versteckt. Ganz zuunterst, wenn Ihr es genau wissen wollt.«
»Und die Augen Eures Mannes? Was sagen die Euch?«
»Dass ich wertlos bin. Eine billige Dienstmagd, nichts weiter. Alwin hat einen Fehler begangen. Niemals hätte er mich heiraten sollen – die Tochter eines Seifensieders. Das sagen mir seine ›Augen‹.« Sie hievte die Töpfe schwer atmend auf die Theke. »Habt Ihr wieder den Leiterwagen dabei? Damit würdet Ihr Euch sicherlich leichter tun.«
Er ließ seinen Blick auf ihr ruhen.
»Es macht mir nichts aus, zweimal zu gehen, ganz im Gegenteil. Ich bin gern in Eurer Nähe. Und noch viel lieber sehe ich Euch an.« Jan begann zu schmunzeln. »Vor allem aber wünsche ich mir, dass für Euch das Gleiche gilt. Ihr müsst Euch lieben lernen, sonst kann es auch kein anderer tun.«
»Was für seltsame Reden Ihr doch immer führt!« Sie fuhr sich über das Gesicht, als wollte sie etwas wegwischen. Der Geruch nach frischer Wäsche wurde intensiver. »Kein Wunder, dass die Leute über Euch reden.«
»Lasst sie reden! Mich stört das nicht. Ich will Euch malen, Margaretha.«
»Mich?« Sie wich zurück. »Was sagt Ihr da? Ihr müsst den Verstand verloren haben!«
»Und wenn schon? Bitte, sagt ja!«
»Aber das ist ganz und gar unmöglich! Selbst wenn ich wollte: Niemals würde Alwin seine Zustimmung geben.« Ihre Hände nestelten fahrig an den rotblonden Flechten. Die Haube, die sie in letzter Zeit getragen hatte, hatte sie offenbar abgelegt. Weil sie sich nicht länger als verheiratete Frau fühlte? »Er wird ja schon eifersüchtig, wenn ich mit einem Kunden nur ein paar freundliche Worte wechsle. Dabei gehört das doch zum Geschäft, das hat mir mein Vater schon beigebracht, als ich noch ein Kind war. Und Alwin lässt mich auch so oft allein!«
»Und wenn er gar nichts davon erführe?«, setzte Jan nach. »Ich kann schweigen. Ihr auch?«
»Soll ich mich vielleicht heimlich aus der Offizin schleichen?« Sie klang ehrlich empört. »Oder aus unserem Haus, nachts, sobald Alwin friedlich neben mir schnarcht? Wie stellt Ihr Euch das denn vor? Ich bin eine ehrbare Frau. So etwas könnte ich nie tun.«
»Nächste Woche begleitet Euer Mann Meister Cranach für vier Tage nach Meißen«, sagte Jan, nahm die ersten beiden Töpfe und machte ein paar Schritte zur Tür, bevor er sich wieder ihr zuwandte. »Vielleicht bleiben sie sogar noch länger, falls der Kurfürst neue Aufträge hat, womit durchaus zu rechnen ist. Eine so günstige Gelegenheit wird wohl so bald nicht wiederkommen. Wir sollten sie nutzen. Meint Ihr nicht auch?«
»Wie könnt Ihr es wagen …«
Er blieb stehen, schaute halb über die Schulter zu ihr zurück.
»Tut es nicht meinetwegen, sondern Euretwegen, Margaretha!«, sagte er bittend. »Um Euch an Eure Schönheit zu erinnern. Dann wird sie auch für andere Menschen wieder sichtbar, das verspreche ich Euch.«
Ihr Mund klappte auf, als wollte sie noch etwas hinzufügen, dann aber zuckte sie wortlos die Schultern und verschwand im Nebenraum.
*
Susanna wurde jedes Mal klamm zumute, sobald sie Luther begegnete, obwohl der Reformator sie kaum zu bemerken schien. Stets in Eile, als riefe ihn bereits die nächste dringliche Angelegenheit, lief er durch die Räume, ohne nach links und rechts zu schauen, bevor er für viele Stunden täglich in seiner Schreibstube im obersten Stockwerk verschwand. War die Tür geschlossen – und das war sie meistens –, bedeutete das, dass er nicht gestört werden wollte. Jeder im Haus hatte sich daran zu halten.
Zwei allerdings missachteten das Zeichen, Katharina, die immer wieder mal beherzt hineinging, das Fenster weit öffnete, um den Studienmuff zu vertreiben, eine Erfrischung zu bringen und ihn vor allem daran zu erinnern, dass er inzwischen auch Frau und Kinder hatte. Und natürlich Hansi, der mit seinen dicken Beinchen neben ihr die Treppe nach oben kletterte und sich freudestrahlend auf den Vater stürzte.
Hatte Luther ihn auf dem Arm, wurden seine Gesichtszüge weich, und man konnte sehen, wie sehr er an dem Kleinen hing. Doch schon bald wurde seine Miene wieder ernst, und dann kehrte in die schmalen Augen unter den starken Jochbögen jener skeptische Blick zurück, der Susanna durch und durch ging.
Immer wieder kam die Angst mit dunklen Schwingen, hielt sie gepackt in eisernem Griff. Manchmal war diese Angst so mächtig, dass Susanna die Worte regelrecht in der Kehle stecken blieben.
Würde sie nach dem Verlust ihrer Singstimme vielleicht ganz und gar stumm werden?
Sie tat alles, was in ihrer Macht stand, um gegen diese Panik anzukämpfen. In Leipzig war sie dem Teufel in Menschengestalt begegnet. Was anderes hätte sie tun können, als um ihr Leben zu ringen?
Und doch lag die unausgesprochene Schuld wie ein nasser Sack auf ihren Schultern und drückte sie nieder, von Tag zu Tag ein wenig mehr. Luther konnte nichts wissen von der unsichtbaren Last, die sie mit sich herumschleppte. Oder war er als Einziger in der Lage, bis in die Tiefe ihrer Seele zu schauen?
Was hätte sie jetzt darum gegeben, sich in einen Beichtstuhl flüchten zu können und dort alles loszuwerden, was sie so sehr quälte. Aber in der Stadt des Reformators gab es schon seit Jahren kein katholisches Gotteshaus mehr, geschweige einen Priester, der ihr das Sakrament der Buße hätte gewähren können. Wittenberg zu verlassen, wagte sie nicht. Allerdings trug die Stadtkirche zu ihrer Überraschung den Namen der Gottesmutter, und Maria dort um Hilfe anzurufen, konnte schließlich niemand verbieten.
Natürlich war Bini eingeweiht in das, was ihr zugestoßen war – doch das Schlimmste, das, was sie Nacht für Nacht schweißgebadet aufschrecken und nach Luft ringen ließ, hielt sie sogar vor ihr verborgen. Es machte sie froh mitanzusehen, wie rasch Binea sich im ehemaligen Schwarzen Kloster eingelebt hatte. Kaum war ihr Fuß verheilt, sauste sie durch die Räume, lachte und plapperte den ganzen Tag, selbst bei den schwersten Arbeiten. Wie hätte sie da diese Unbeschwertheit mit schrecklichen Bekenntnissen belasten können?
Susanna schrak aus ihren Überlegungen hoch, als Luther plötzlich vor ihr stand.
»Es wird ein Essen geben«, sagte er unvermittelt. »Mit Kollegen von der Leucorea. Schwarzerd zum Beispiel und noch einige dazu, ich schätze, nicht mehr als acht, aber so genau kann man das niemals vorher sagen, weil jeder von ihnen so seine Eigenheit hat. Morgen, zur Mittagszeit. Geh der Frau schon heute tüchtig zur Hand, damit sie sich dann mit uns an die Tafel setzen kann! Das schätzt sie so sehr.«
Susanna nickte rasch. Wieder wurde ihr die Kehle eng.
»Kümmere dich vor allem um die Kinder!«, fuhr er fort. »Meine Käthe wird schnell unruhig, wenn sie zu plärren beginnen.«
»Das kann ich gerne übernehmen«, brachte Susanna schließlich krächzend hervor und schämte sich im gleichen Augenblick dafür.
Er musste sie für eine Idiotin halten.
Oder für eine, die dem Reformator aus guten Gründen nicht in die Augen schauen konnte.
Da war er schon weitergelaufen, ohne sich länger um sie zu kümmern.
Susanna starrte ihm hinterher, bis ein aufmunternder Stoß Binis sie jäh in die Gegenwart zurückbrachte.
»Hast du schon gehört? Wir zwei gehen jetzt auf den Markt«, sagte sie fröhlich, öffnete ihre Hand und ließ die Münzen klirren, die Katharina ihr gegeben hatte. »Da bekommen wir endlich Gelegenheit, uns dieses Wittenberg bei Tag anzuschauen!«
Susanna starrte sie an wie eine Erscheinung.
»Was ist mit dir?«, fragte Bini besorgt. »Du bist ja ganz blass! Aber sieh nur: Muhme Lene hat mir zwei Kupferstücke zugesteckt – nur für uns!«
»Nichts«, sagte Susanna rasch. »Nur die alte Geschichte … Du weißt ja.«
»Und genau das hört jetzt endlich auf, verstanden?« Bini drückte ihr energisch einen Korb in die Hand und nahm sich den zweiten. »Wir sind hier. In Sicherheit. Niemand kann uns etwas antun.«
Wie gern hätte sie daran geglaubt!
Doch kaum hatten sie das Lutherhaus verlassen und waren auf der öffentlichen Straße angelangt, beschleunigte sich ihr Herzschlag unwillkürlich.
»Heute ist Viehmarkt«, plapperte Bini fröhlich neben ihr. »Vielleicht bekommen wir ein paar schöne Rösser zu Gesicht …«
»Und was sollen wir damit?«, fiel Susanna ihr ins Wort, weil sie die innere Spannung kaum noch ertrug. »Du kannst ebenso wenig reiten wie ich.«
»Doch nur zum Anschauen und Sich-daran-Freuen …« Bini sandte ihr einen scheuen Blick zu. »Dass du immer gleich so griesgrämig werden musst! So warst du früher im Kloster nie. Manchmal erkenne ich dich kaum wieder.«
Ich mich ja auch nicht, dachte Susanna und senkte beschämt den Kopf. Jetzt giftete sie schon die Gefährtin an, die immer zu ihr gestanden hatte!
»Es tut mir leid«, setzte sie an, doch Bini schien es schon wieder vergessen zu haben.
»Lass uns den schönen Tag doch nicht mit trüben Gedanken verderben!«, sagte sie und deutete auf ein stattliches Gebäude links vor ihnen. »Siehst du das? Das ist die hiesige Universität Leucorea. Was für ein prächtiges Bauwerk! Und einige der gelehrten Herren werden wir morgen höchstpersönlich zu Gesicht bekommen.«
Susanna nickte schweigend.
»Muss mir noch einmal ins Gedächtnis rufen, was wir eigentlich kaufen sollen«, sprudelte Bini weiter. »Seife. Würste … Dabei hätten wir die doch leicht selber brühen können, wenn wir nur das richtige Fleisch gehabt hätten. Honig. Mehl. Fische. Und bunte Bänder.« Sie begann zu schmunzeln. »Vielleicht ja sogar auch eines für dich oder mich …«
Und was sollen wir damit?, wollte Susanna schon raunzen, unterließ es aber, weil Bini so glücklich aussah.
Eigentlich hatte sie ja recht. Der Tag war warm, ein blauer Himmel spannte sich über ihnen, von leichten weißen Wolken durchzogen, die kein bisschen nach Regen aussahen. Der Frühling, inzwischen in voller Blüte, schien alle übermütig zu machen. Rechts von ihnen trieben ein paar Buben unter lautem Gelächter ein klapperndes Holzrad mit einem Stecken voran; vor ihnen kämpfte ein Bäuerlein mit seinem Schwein, das offenbar ganz und gar nicht zum Markt wollte und trotz des Strickes, den der Mann ihm um den Hals geschlungen hatte, quiekend zu entkommen suchte.
Nach und nach wurde Susanna ruhiger, spürte die Kraft der Sonne zwischen den Schulterblättern und begann sogar neugierig zu schnuppern, weil eine Vielzahl von Gerüchen auf einmal ihre Nase kitzelte.
Ob sie Jan zu Gesicht bekommen würde?
Auf einmal war der Gedanke da und ließ sich nicht mehr aus ihrem Kopf vertreiben.
Und wenn schon! Bestimmt hatte er sie längst vergessen, eine ehemalige Nonne mit langen Fingern, die inzwischen als Magd arbeitete und froh sein konnte, dass sie überhaupt ein halbwegs dichtes Dach über dem Kopf hatte …
Sie hielt inne. War er das nicht da vorn?
Ihr Herz schien für einen Moment still zu stehen, um danach härter gegen die Rippen zu schlagen.
Dieser braunhaarige Kerl, der einen Leiterwagen hinter sich zerrte, das musste er doch sein!
Unwillkürlich hob sie eine Hand, um ihm zuzuwinken, ließ sie doch wieder sinken, als sie sah, wie er stehen blieb, um freudig eine junge Frau zu begrüßen.
Bislang sind sie alle noch immer freiwillig zu mir gekommen.
Dieser Satz beherrschte plötzlich ihr ganzes Denken – und sie hasste sich und vor allem ihn dafür.
Darauf kannst du bei mir bis in alle Ewigkeit warten, Jan Seman, dachte Susanna und musste ausspucken, weil sich in ihrem Mund auf einmal so viel Bitteres angesammelt hatte.
Sie drehte sich zu Bini um und schrak zusammen, als sie plötzlich ein durchdringendes Quieken hörte, das vom Nordende des Marktes zu kommen schien.
*
Da war sie – er konnte es kaum glauben, aber es gab keinerlei Zweifel. Wie nur war sie hierhergekommen, ausgerechnet in diese Stadt, in der sich seine kühnsten Träume erfüllen sollten?
Er wandte sich ab, berührte sein Gesicht und spürte eine glatt rasierte Wange. Dann fuhr seine Hand unter den Kragen und ertastete den verhassten Wulst.
Sein Mund verzog sich.
Sie konnte ihn nicht erkennen, dafür hatte er gesorgt. Und dennoch war ihm plötzlich zum Speien übel.
Er ging ein paar Schritte weiter, bis er halb von einem Stand verdeckt war, an dem süße Küchlein feilgeboten wurden, deren Geruch er kaum ertragen konnte, und starrte erneut finster zu ihr hinüber.
Sie war nicht allein, und auch die andere, die sie begleitete, war ihm alles andere als unbekannt.
Was taten sie hier?
Hatten sich diese beiden Drecksluder etwa auf seine Fährte gesetzt? Musste er nun all seine Ideen über den Haufen werfen und das köstliche Spiel abbrechen, bevor es richtig begonnen hatte?
Für ein paar Augenblicke war ihm, als würde ihm eine eisige Faust ins Gedärm fahren, dann aber zwang er sich zur Ruhe.
Sie waren Niemande – und wussten nichts über ihn.
Er jedoch hielt die Fäden in der Hand, hatte sich doppelt und dreifach abgesichert. Keine lebende Seele konnte ihm auf die Schliche kommen, bis er besaß, wonach es ihn mit jeder Faser verlangte.
Er würde seine Rache zelebrieren, gelassen und mit kalter Hand, genauso wie er es geplant hatte.
Noch einmal flog sein Blick zu ihr.
Sie war magerer als in seiner Erinnerung und auffallend bleich, als ob etwas an ihr zehre, was ihr etwas Schutzloses und zugleich Geheimnisvolles gab, das ihn sofort wieder erregte.
Er zwang sich, diese Anwandlung zu unterdrücken.
Sie hatte ihn einmal überlistet, das war mehr als genug. An den Folgen trug er noch heute.