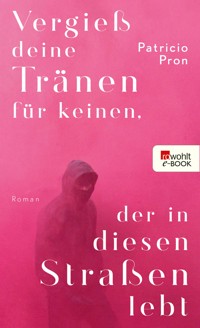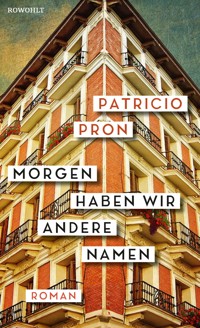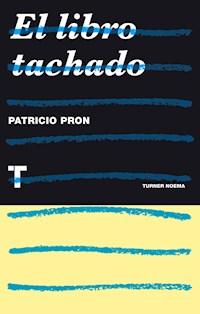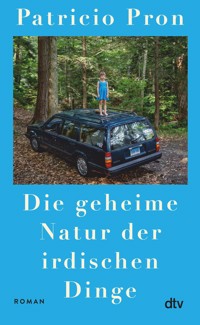
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Im Geist von Roberto Bolaño.« Ralph Hammerthaler, Süddeutsche Zeitung Olivia fährt in einem Auto eine Landstraße entlang und lässt ihre Kindheit, ihre Karriere als Schauspielerin und die Beziehung zu ihren Eltern Revue passieren. Die Mutter brachte für ihre feministisch motivierten Installationen stets mehr Empathie auf als für die Tochter. Der Vater, ein nicht sehr erfolgreicher Maler, verschwand ohne Erklärung, als Olivia ein Teenager war. Was ist passiert? Wie kommen Entscheidungen zustande? Wie entstehen Erinnerungen? Mit einer einzigartigen Stimme schreibt Pron über unausgesprochene Erwartungen und heimliche Wünsche und erweist sich dabei als scharfsichtiger Diagnostiker unserer Zeit. »Pron öffnet uns die Augen und lässt uns Dinge entdecken, die wir nie vermutet hätten.« Juan Gabriel Vásquez »Seine Prosa ist innovativ und poetisch wie keine andere.« Francisco Goldman »Das Wesentliche sehen wir nie auf den ersten Blick. Ein großartiger Roman.« El País
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Olivia fährt in einem Auto eine Landstraße entlang und lässt ihre Kindheit, ihre Karriere als Schauspielerin und die Beziehung zu ihren Eltern Revue passieren. Die Mutter brachte für ihre feministisch motivierten Installationen stets mehr Empathie auf als für die Tochter. Der Vater, ein nicht sehr erfolgreicher Maler, verschwand ohne Erklärung, als Olivia ein Teenager war. Was ist passiert? Wie kommen Entscheidungen zustande? Wie entstehen Erinnerungen?
Mit einer einzigartigen Stimme schreibt Pron über unausgesprochene Erwartungen und heimliche Wünsche und erweist sich dabei als scharfsichtiger Diagnostiker unserer Zeit.
Patricio Pron
Die geheime Natur der irdischen Dinge
Aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz
Wir leben in komplett niedergebrannten Häusern und Städten, als ob sie noch stehen würden: Man behauptet, hier zu wohnen, geht maskiert auf die Straße und tut so, als seien die Ruinenlandschaften die vertrauten Viertel von einst.
Wenn das Haus brennt Giorgio Agamben
Wenn jemals die Suche nach einem ruhigen Glauben aufhörte, bräuchte die Zukunft nicht mehr aus der Vergangenheit zu erwachsen, die viel von uns in sich trägt. Doch die Suche und die Zukunft, die aus uns erwächst, sind wohl ein und dasselbe.
Ideas of order Wallace Stevens
Ich habe das Gefühl, daß mir der Mund für alle Zeiten verschlossen bleiben würde, wenn ich nicht dies zuvor erledigte.
Der Untergang Hans Erich Nossack
OLIVIA BYRNE
Sie wird ins Schleudern geraten, wird die Kontrolle über den Wagen verlieren, wird gegen die Leitplanke prallen, die diese Schnellstraße vom Wald und seinen Geheimnissen trennt, aber das weiß Olivia noch nicht; sie ahnt nichts von dem, was ihr gleich widerfahren wird, wenn eine unerhört intensive Erinnerung sie überfällt, wie eine Welle über ihr bricht und sie mit sich reißt. Einen Augenblick zuvor fragte sie sich, ob der Schattenfleck zu ihrer Rechten Lowes Park oder, mehr im Süden, der Park bei dem See war, den sie leicht mit Ersterem verwechselt, wenn sie von dem Städtchen Ramsbottom, wo sie seit über einem Jahr lebt, hinunter in die Stadt fährt; tut sie das, so wie jetzt, am Morgen, wenn der Nebel sich noch nicht gelichtet hat und die Autos wie die Vororte mit ihren Häusern, umgeben von einer klebrigen Finsternis, nur Lichter in der Tiefsee sind, kommt es ihr so vor, als seien das alles kleine Bühnen, auf denen nicht ganz unwichtige Streitigkeiten, geführt in der niemals banalen Musik einer gemeinsamen Sprache, beigelegt werden, und Olivia sagt sich, sie könnte, von Neugier getrieben, sich jenen Darstellern nähern, sie beinahe berühren, ohne dass diese ihrer gewahr würden, da das Licht, das sie aus der Schwärze ausschneidet und sie deutlicher, als sie es sich vorstellen können, ausstellt, dazu erdacht wurde, dass sie gesehen werden und selbst nicht sehen, damit die Rolle, die sie spielen, und deren Anforderungen sie ablenken von der Existenz anderer Darsteller und anderer Rollen und von jenen, die wie Olivia in der sie umgebenden Dunkelheit hausen und in diesem Moment an sich ähnelnde Dunkelheiten denken und sich fragen, ob es die des einen oder des anderen Parks ist.
Ramsbottom hat gerade einmal zwanzigtausend Einwohner und war einst Verwaltungssitz des Distrikts, bevor dieser in die Großstadt, in die Olivia fährt, eingemeindet wurde; die Bewohner pflegen den Brauch, hartgekochte Eier von Hügeln zu schleudern, sie jagen Neukiefervögel und nehmen an Wettkämpfen teil, bei denen mit Fleischwaren geworfen wird. Olivia ihrerseits ist dreiunddreißig Jahre alt und hat schon an einem guten Dutzend von Orten gewohnt: in Swinton, mit zwei Freundinnen; in Reddish, über einem Laden der Heilsarmee, zusammen mit einem Freund; in Withington, nicht weit von dem Krankenhaus, in dem sie geboren wurde; in illegal besetzten Häusern in Eccles, in der Princess Street, in Levenshulme, in Longsight, in Moss Side; ein paar Monate lang im Atelier ihrer Mutter, gelegen in einer Gasse namens Back Piccadilly; in Broughton, im Souterrain eines Teppichgeschäfts, zusammen mit zwei Jamaikanern; in dem winzigen Apartment in der Nähe des Chorlton-cum-Hardy- Theatersaals, in dem sie auftrat, bis eine Pandemie zu seiner Schließung führte; schließlich in Bury. Ein paar Monate nach Beginn ihrer Liebesbeziehung hatte ihre Freundin gebeten, Olivia möge doch zu ihr nach Bury ziehen, weil sie es satt habe, durch die ganze Stadt zu müssen, um sie zu sehen; doch dann lief es zwischen ihnen nicht so gut, womöglich weil ihre Freundin ebenfalls Schauspielerin war, womöglich weil sie aus dem Süden stammte – und sich persönlich von den Besonderheiten der lokalen Aussprache angegriffen fühlte, all diese Töne, welche die Einheimischen in der Mitte eines Wortes zu verschlucken pflegen, um sie dann am Ende des Worts auszuspucken, eine Eigenheit, die Olivia, um sie zu provozieren, manchmal übertrieb –, wahrscheinlicher aber, denkt sie, weil die tiefsten Bedürfnisse dieser Frau, die Olivia allenfalls vorübergehend befriedigen konnte, sehr ihren eigenen ähnelten, ein Produkt der eigenen Verluste, welche die Freundin, ohne sie ganz verstanden zu haben, zu kompensieren gesucht hatte, nachdem Olivia es schließlich geschafft hatte, davon zu erzählen; als wäre auch hier die Unkenntnis über die Beweggründe der Figur die eigentliche Garantie für eine exzellente Darstellung, die am Ende nichts als Oberfläche ist. »Was hast du heute vor?«, hatte Olivia sie gefragt, als sie sich kennenlernten, und die andere hatte geantwortet: »Etwas, das ich vielleicht am Ende bereue«; seitdem kam dieser Satz gewohnheitsmäßig in ihren Gesprächen vor und markierte vielleicht den ehrlichsten Moment des Tages. Eines Abends, als die Freundin darauf beharrte, dass Olivia sie zu einer dieser illegalen Partys begleite, die einige Monate lang in jedem leeren Hinterhof wie Pestblumen aufblühten, Olivia sich aber weigerte, entstand ein Streit, etwas härter als gewöhnlich, es gab Schreie, ein Geständnis, Herumgeschubse, Türenknallen. Die Freundin kam zwei Tage später zurück, als die Polizei es geschafft hatte, die Party aufzulösen, aber inzwischen hatte die Furcht vor einem erneuten Entbehren und das Geständnis der Freundin in Olivia den alten Fluchtmechanismus ausgelöst – der nicht den Verlust des anderen verhindert, aber eine Umkehrung bewirkt zwischen dem, der verlässt, und dem, der verlassen wird, zwischen dem, der geht, und dem, der bleibt – und sie hatte bereits die Entscheidung getroffen zu gehen, und zwar, wenn möglich, an einen Ort, wo sie bisher noch nicht gewohnt hatte. Ramsbottom liegt nur ein paar Minuten von Bury entfernt und ist von Öd- und Marschland umgeben. Wie jeder Mensch hatte Olivia das Gefühl, etwas verloren zu haben, wusste aber nicht mehr, was: Wie so viele verspürte sie eine tiefe Sehnsucht nach einem wolkenlosen Himmel. Es war nicht Natur, was sie ersehnte, da sie – spätestens seit ihre Mutter sich für diese Dinge zu interessieren begann – wusste, dass es nichts gab, was wir noch so nennen könnten, außer einer rückerstattenden Fiktion, einer Ideologie; sie sehnte sich nach einer Landschaft, die noch nicht radikal verändert worden war. Sie hatte einmal gehört, dass die Österreicher den Horizont den »Fernseher für Deppen« nennen; aber die Unmöglichkeit, ihn in der Stadt zu betrachten, den Blick auf etwas wie einen nicht von Gebäuden unterbrochenen – oder, schlimmer noch, von den Mauern der Nachbarhäuser, den Trassen der Autobahnen und Straßen gekappten – Raum fallen zu lassen, hatte in ihr eine enorme Sehnsucht nach Landschaft geschürt. Und Ramsbottom, so dachte sie, war nur Landschaft, ein Möglichkeitsort, die Befreiung der Kräfte und Impulse nach einer langen Zeit der Lähmung.
Zum Teil wegen der Restriktionen der vergangenen Jahre, aber auch aufgrund der gegenseitigen Entfremdung – die keine von beiden aufzuheben wusste und die folglich in dieser Periode nur weiter gewachsen war – hat ihre Mutter sie nie in Ramsbottom besucht, nicht einmal, nachdem Olivia versucht hatte, sie mit der Schönheit des Marschlandes in der Umgebung zu locken; laut ihrer Mutter waren die sumpfigen Marschen ein riesiges Totenfeld, wo man die Menschen seit grauer Vorzeit ermordet und ins Wasser wirft. Olivia weiß, ihre Mutter hat recht, sagt sich beim Lenken des Autos aber, dass sie doch nicht ganz recht hat, dass die Marschen auch etwas anderes sind, wie sie nach und nach auf ihren Spaziergängen in den vergangenen anderthalb Jahren entdeckt hat; insbesondere, dass sie eine Art Spiegel sind, in dem derjenige, der sich darin sieht, sein wahres Wesen betrachtet und einige seiner Ängste dazu; ihre Mutter erinnern die Marschen natürlich nur an das Jahre zurückliegende Verschwinden des Vaters, aber wie viele Jahre ist das her. Einen Moment, bevor sie in Tränen ausbricht, erinnert sich Olivia, es ist neunzehn, fast zwanzig Jahre her, dass ihr Vater verschwunden ist; sie war vierzehn, stand kurz vor dem fünfzehnten Geburtstag, so wie sie jetzt kurz vor ihrem vierunddreißigsten Geburtstag steht oder stünde, ein paar Tage, nachdem sie die Kontrolle über ihren Wagen verlieren und gegen die Leitplanke der Autobahn prallen wird, wegen einer Unachtsamkeit, über die dann die Behörden viel zu sagen haben werden, auch wenn sie nichts davon begreifen – zwei Jahre zuvor waren damals in New York Wolkenkratzer gestürzt und hatten neuen Kriegen sowie einer Epoche der Ungewissheit Raum geschaffen, in der lang gehegte Freiheiten eingeschränkt und durch andere ersetzt worden waren, die oft ebenfalls nötig waren, aber die Geschlechter- und Klassenunterschiede außer Acht ließen, ohne deren Berücksichtigung die neuen Freiheiten sich als nutzlos oder rein kosmetisch erwiesen. Einige Monate lang hatte die Möglichkeit, dass ihr Vater sich im Marschland befände, lebendig oder tot – und in letzterem Fall, weil er getötet worden war, einen Unfall hatte oder sich das Leben nahm – dazu geführt, dass die Polizei ihre Bemühungen hauptsächlich darauf richtete, die Gegend zu »durchkämmen«, eine Bezeichnung, die Olivia immer absonderlich erschienen war, so missverständlich wie bedeutungsschwanger.
Ihr Vater wurde aber nicht unter den Leichen gefunden, die das Marschland zu jener Zeit ausspuckte und der Presse erlaubte, an die goldene Epoche der Mafia in der Stadt zu erinnern, an die Menschenopfer, die offenbar die ersten Bewohner des Landstrichs praktiziert hatten, ob mit oder ohne Einwilligung ihrer Opfer, ist nicht gewiss, oder an die weniger gefeierte Zeit der Bandenkämpfe, die zu ihrer Teenagerzeit ständig in der Stadt stattfanden, und von deren Opfern – ein junger Mann, der in einer Wäscherei arbeitete und den Olivia kannte; der Freund einer Freundin; jemand, mit dem sie vor einigen Jahren in einem besetzten Haus gewohnt hatte; der Freund eines Bekannten, der zwei junge schwarze Frauen in einem Nachtbus verteidigt hatte, bevor er von den Angreifern aus dem Fahrzeug gezerrt wurde und verschwand. Geschichten, die Olivia zuweilen hörte, ohne sich je wirklich davon betroffen zu fühlen, da der Schmerz und diese tiefgehende Empfindung von Nicht-Wirklichkeit, die das Verschwinden ihres Vaters hinterlassen hatten und die sehr langsam und erst mit den Jahren schwinden sollten, noch zu groß waren, um auch nur wahrzunehmen, dass tragische Ereignisse, die mit ihren Erfahrungen konkurrierten und unter anderen Umständen wohl an deren Stelle gerückt wären, tatsächlich einen solchen Platz im Leben von Menschen einnahmen, die ihr und ihrer Mutter nicht unähnlich waren – wobei die Mutter ihrerseits sich vom ersten Augenblick an verboten zu haben schien, irgendein Zeichen von Schmerz, auch nur von Trauer, nach außen zu kehren – dass es andere Menschen gab, die jemanden verloren hatten, um danach weiterleben zu müssen, mit einer Abwesenheit und einem Rätsel, und über allem, riesenhaft und bestimmend ein »Was wäre geschehen, wenn …«. Das Marschland spuckte in den folgenden Jahren naturgemäß weiter Leichen aus – auch kleine Äxte und Anhänger und Gummistiefel, Reifen und manchmal Tierreste, dies alles in einer stillschweigenden Ablehnung der vorgeblichen Linearität der Zeit –, aber ihr Vater war nie darunter, also blieb seine Geschichte offen, nicht nur für Olivia, sondern auch für die Behörden, und nährte sich von allen möglichen Erklärungen seines Verschwindens, den Selbstmordgedanken, die ihm zugeschrieben wurden, den diesbezüglichen Interpretationen seines Werks und der Dinge, die er gesagt hatte oder hätte sagen können und die vielleicht keinerlei Deutung außer der simpelsten zuließen. Dennoch scheint sich ihre Mutter, vielleicht nicht ganz unbegründet, an die Vorstellung zu klammern, dass die Polizei nicht richtig gearbeitet hat und die Leiche des Vaters noch immer im Marschland liegt; ihre Weigerung, die Tochter in Ramsbottom zu besuchen, hatte natürlich damit zu tun, aber auch mit der nicht weniger bedeutsamen Möglichkeit, dass der Vater nicht dort lag, was der Mutter bei einem Besuch der Marschen auf irgendeine mysteriöse Weise hätte klar werden können, wobei die Feststellung dieses Irrtums wiederum den Beweis dafür liefern würde, dass die letzten neunzehn Jahre ihres Lebens, alles, was sie in dieser Zeit getan und entschieden hatte, jeglichen Fundaments und jeder Gültigkeit entbehrten, da sie nun mal auf einer falschen Beurteilung beruhten. »Es gibt keinerlei Grund, auf das Thema zurückzukommen«, hatte die Mutter zu einer Zeit gesagt, als Olivia noch glaubte, mit ihr einen Schmerz teilen zu können, auf den ihre Mutter – die damals wohl gerade ihre erste Ausstellung nach dem Verschwinden des Mannes plante, bei der diesem eine kurze, aber notwendige Präsenz gewährt werden sollte – sie, die Tochter, nicht vorbereitet hatte und den sie selbst vielleicht gar nicht empfand, da sie abgeneigt war, irgendetwas zu fühlen, das sie nicht verstehen und folglich nicht kontrollieren konnte.
Olivia wäre in dieser Hinsicht gern mit ihrer Mutter einer Meinung gewesen, sagt sie sich. Dennoch gab es damals verschiedene Gründe, auf das Thema zurückzukommen, angefangen bei dem wichtigsten, dass es weiterhin notwendig war herauszubekommen, was geschehen war, was mit dem Vater an jenem Morgen passierte, als er, der Polizei nach, anscheinend – nur »anscheinend«, darauf beharrten sie – aus freiem Willen verschwand; also ist das sumpfige Marschland für ihre Mutter, denkt Olivia, so etwas wie eine Metapher, vielleicht auch ein Ort, von dem man behaupten kann, dass dort eine Geschichte zu Ende geht oder zumindest die Gründe enden, um weiterhin über sie nachzudenken, selbst wenn diese Geschichte an anderen Orten weitergeht, nicht in unerheblichem Maße im Leben der Tochter, die im Marschland etwas ganz anderes sieht als ihre Mutter: Sie sieht einen Ort, an dem Dinge versinken und gelegentlich wieder hochkommen und wo der eigene wilde Kern direkter, ohne die in der Stadt und in der Geschichte übliche Bemäntelung zum Ausdruck kommt, ohne die Fiktion eines geringeren Übels – denn kein Übel ist »geringer« als ein anderes –, auch nicht mit den von uns gepflegten Umgangsformen, die, indem sie sich zwischen uns und die anderen stellen, uns vor deren Geheimnissen bewahren und – ganz klar – zugleich die anderen vor den unseren schützen.
Vor einiger Zeit hat Olivia in einem Stück über ebendieses Urwilde gespielt, das sich besonders im Leben der Wolfskinder wie auch in dem all jener Kinder zeigt, die aus dem einen oder anderen Grund von Tieren aufgezogen und später »errettet« wurden. Olivia erinnert sich an einige der Fälle, von denen ihr der Dramaturg und Autor des Stücks erzählt hatte, ein junger Mann aus Burnley, der Jahre später relativ erfolgreich den »Sprung« an die Londoner Bühnen schaffte (allerdings nicht mit diesem Text, vielmehr dank der Tatsache, dass er andere Stücke schrieb, die ein versöhnlicheres, weniger beklemmendes Bild der menschlichen Natur zeigten; sie boten, wie alles, was die Gesellschaft als »disruptiv«, »brisant«, vielleicht »hart« feiert, zwar ein leicht beunruhigendes und reichlich schmerzhaftes Bild der menschlichen Natur, das jedoch der Fiktion einer möglichen Heilung Raum ließ und, häufiger noch, einer Art Hoffnung oder einer anderen Form der Wiedergutmachung: Theaterstücke, die es einem erlaubten, die Unabwendbarkeit von Grausamkeit und Tod zu akzeptieren, sich zugleich aber mit diesen zu versöhnen und nach Ende der Vorstellung bei den Ursachen, die sie hervorriefen, zu verweilen; Stücke, die es einem sogar erlaubten, danach irgendwo zu speisen, mit der Sicherheit dessen, der in das hineingesehen hat, was er für die Abgründe der menschlichen Existenz hält, aus dieser Erfahrung aber unbeschadet und ohne etwas zu lernen hervorgegangen ist, was wiederum, so denkt Olivia, nur möglich ist, wenn diese Abgründe gar keine sind, vielmehr nur deren Nachahmung oder Abklatsch, ein Ersatz). Doch in seinem ersten Theatertext, dem Stück, in dem Olivia damals spielte, hatte es noch keine Surrogate, keine warmen Tücher gegeben, weshalb sie sich daran lieber erinnert, auch wegen der kurzen Zeit, die sie zusammen gewesen waren: eine Romanze, wenig animalisch und nicht besonders intensiv, die, wie Olivia zugibt, eine Folge ihrer damaligen Unfähigkeit war, Grenzen zu setzen zwischen dem Auftritt und den anderen Rollen, die sie spielte, zwischen der Schauspielerin, die sich auf einer Bühne auszog, und der Frau, die dies ein paar Stunden später in einem Schlafzimmer tat, diesmal vor einem zumeist kleineren Publikum. »Wir, die wir in den letzten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts geboren wurden, sind alle Kinder der Wildnis. Es gibt in der Welt keinen Platz für uns. Und keinen zweiten Akt im Drama unseres Lebens«, pflegte zu jener Zeit dieser Dramatiker zu sagen, dessen spätere Abdrift jedoch an den Tag brachte, dass er absolut nicht vorhatte, wie seine Wolfskinder zu enden, sondern seinen Platz in der Welt finden konnte und dann auch fand, dank seiner Fähigkeit, die Transgression anzudeuten, dieweil er sie vermied.
Das Stück war von dem Leben der Marie-Angélique Memmie Le Blanc inspiriert, dem berühmten »enfant sauvage« von Songy, das Dorfbewohner in der Champagne im September 1731 gefunden hatten; das Mädchen war in Lumpen und Tierfelle gekleidet und barfüßig auf der Suche nach Wasser unterwegs, es war etwa neunzehn Jahre alt, von denen sie wohl zehn versteckt in den Wäldern verbracht und sich von Wurzeln und rohem Fleisch ernährt hatte: Als die Ärzte ihr eine solche Nahrung untersagten, trug das maßgeblich zu ihren lebenslangen Magenbeschwerden sowie zu ihrer allgemeinen Schwächung bei, wobei die Ärzte gerade diese förderten, da sie der Überzeugung waren, Frau zu sein bedeute im Wesentlichen, schwach zu sein – wie das auch noch heutzutage viele Männer und Frauen meinen, nachdem das Ende der Periode ausgerufen wurde, in der ihre Mutter aufgewachsen war und an die sich diese immer noch klammert, einer Periode, in der Frauen nach ihren Überzeugungen und ihren vielfältigen Stärken beurteilt werden wollten und nicht nach dem Leid, das ihnen zugefügt worden war, und einer verordneten Unfähigkeit, dieses zu überwinden.
In Hospitäler und Klöster eingeschlossen und immer mal wieder für sterbenskrank erklärt, war sie gezwungen, von fremder Barmherzigkeit zu leben, fern der Wälder, die sie zu ihrer ersten Heimstatt gemacht hatte, und verwandelt zu einer Jahrmarktskuriosität, die sich vom Erlös des Buches über Wasser hielt, das ihre Geschichte erzählt. Laut der Autorin dieses Buches »klang ihre Stimme, obgleich schwach doch hoch und durchdringend, ihre Sätze waren kurz und schüchtern, wie bei einem Kind, das noch nicht recht die Begriffe kennt, mit denen es ausdrücken kann, was es sagen will.« »Sie hatte keine Erinnerung an ihren Vater oder an ihre Mutter, noch an irgendjemanden in ihrem Herkunftsland, kaum auch an dieses Land, außer, dass sie sich nicht erinnern konnte, dort ein Haus gesehen zu haben. (…) Eines Tages, als sie im Schloss bei einem großen Festmahl war, bemerkte sie, dass es dort nichts gab, was ihr wirklich schmeckte, da alles gekocht und gewürzt war, also entwischte sie wie der Blitz, rannte am Rand von Gräben und Wasserbecken entlang und brachte eine Schürze voll lebender Frösche mit, die sie mit beiden Händen auf die Teller der Gäste verteilte, voller Freude darüber, so leckere Sachen gefunden zu haben: ›Nimm, iss. Iss doch. Nimm‹, das waren fast die einzigen Worte, derer sie mächtig war.« Niemand jedoch wusste ihre seltenen Gaben zu schätzen, und so galt ihre einzige angenehme Erinnerung dem Besuch einer polnischen Prinzessin in Songy, die von ihr zur Jagd begleitet werden wollte. »Als sie sich erneut in Freiheit sah, gab sie sich ihrer wahren Natur hin«, schrieb die Autorin des kleinen Werks über Le Blancs Leben, »im Lauf verfolgte sie die aufgescheuchten Hasen oder Kaninchen, fing sie und brachte sie in der gleichen Geschwindigkeit zurück zur Prinzessin«, wie noch gutgläubige Kinder, die glauben, wenn sie ihren Eltern etwas geben, werden diese es ihnen mit etwas noch Wertvollerem vergelten, etwa mit Anerkennung. Die Prinzessin aber gab ihr nichts außer den wenigen lustvollen Stunden, in denen sie wieder wild sein durfte; ein lichter Augenblick inmitten der Dunkelheit des Jahrhunderts der Aufklärung, an den sich die Frau bis ans Ende ihres Lebens erinnern sollte.
Aus irgendeinem Grund hat Olivia sich auf Monologe wie den des Mädchens aus Songy spezialisiert und hat den Eindruck, diese kämen sozusagen auf sie zu: Manchmal werden sie ihr von den Autoren auf den Leib geschrieben, andere Male robben sie sich aus der Vergangenheit heran auf der Suche nach einer Stimme wie der ihren, die ihnen eine Form und eine Ordnung gibt; wenngleich sie in anderen Arten von Stücken aufgetreten ist, auch in kleinen Filmen von jungen Regisseuren aus dem Norden des Landes sowie in mindestens zwei Performances, findet sie die dramatischen Monologe interessanter, auch weil sie ihr erlauben, auf der Bühne besser zu sein, was sie auf die Erfahrung des Alleinseins im Lauf ihres Lebens zurückführt, die sich mit dem Verschwinden des Vaters vervielfacht hat und zu ihrem Schicksal geworden ist. Und auf den Einfluss ihrer Mutter. Von all den Geschichten, die sie damals las, als sie in dem Stück über das Mädchen von Songy spielte, ist ihr am deutlichsten diejenige eines Mädchens in Erinnerung, das 1717 in einem Wald bei Kranenburg eingefangen wurde. Wie all die übrigen, angeblich von Wölfen, Bären, Leoparden, Pavianen, sogar von Schweinen und Schafen aufgezogenen Kinder, von denen die Fabeln und überkommenen Berichte erzählen – später auch die Historiker und Journalisten, die sie aus dem Bereich des alten Mythos herauszogen, um sie in den zeitgenössischen Mythen der journalistischen Objektivität und der historiographischen Strenge unterzubringen –, bewegte sich das Mädchen auf allen vieren, war schlau, wagemutig und schnell, ernährte sich von Wurzeln und Früchten, schlief auf Bäumen, in Höhlen, hatte keine Geschichte. Es hieß, man habe sie siebzehn Jahre zuvor aus Antwerpen verschleppt. Und tatsächlich, als die Nachricht sich in dieser Stadt verbreitete, wurde eine Frau neugierig, die behauptete, vor siebzehn Jahren ein kleines Mädchen verloren zu haben, sie hatte vielleicht auch eine Eingebung und machte sich zu Fuß auf den Weg nach dem etwa zweihundert Kilometer entfernten Kranenburg, die genaue Entfernung weiß Olivia nicht mehr, behauptete, in dem Mädchen das geraubte Kind zu erkennen, und nahm es zurück mit nach Hause. Der Bericht erwähnt den Namen jener Frau nicht. Er lässt offen, ob tatsächlich eine Verwandtschaft bestand. Von der Reaktion der angeblichen Tochter auf jene Person, die vielleicht ihre Mutter war, wird nichts gesagt. Man erfährt auch nicht, ob die Frau einen Mann oder andere Verwandte hatte, und wenn ja, wie diese auf das vermisste Kind reagierten. Es ist auch nicht von dem häuslichen Alltag die Rede, auf den niemand die zwei Frauen vorbereitet hatte und in den sie, kaum heimgekehrt, sofort eintauchten. Hingegen wird erzählt, dass etwa fünf Jahre, nachdem das Mädchen eingefangen worden war, Tochter und Mutter zu dem Wald zurückkehrten, in dem das alles stattgefunden hatte, die Tochter sollte der Mutter zeigen, wie und wo sie so viele Jahre gelebt hatte, diese aber bekam eine solche Angst angesichts der Dichte des Waldes und der sie umfangenden Dunkelheit, dass beide sofort nach Antwerpen zurückkehrten. Olivia erfuhr nie, was sie gesehen und warum sie geflohen waren, konnte es sich aber vorstellen, weil sie es selbst möglicherweise auch gesehen hatte, bei unterschiedlichen Gelegenheiten, ohne auch nur mit der Nähe der Mutter rechnen zu können, die vielleicht unfähig zu jeglicher Nähe war, außer zu einer, von der sie weiß, dass sie Olivia wehtut, und die sie ihr deshalb – wohl in einem begründeten Verzicht – zu ersparen sucht. Seit dem Verschwinden des Vaters gibt es keine Geburtstagsfeiern mehr – und die Erinnerungen an die vergangenen sind verschwommen, als ob es Olivia, nach Ablauf einer gewissen Zeit, unmöglich wäre, sich an die Jahre vor dem Ereignis zu erinnern oder sich selbst einzugestehen, dass ihr Vater einmal etwas anderes als eine Abwesenheit zwischen ihnen beiden hatte sein können und dass die Mutter auch dabei gewesen war und noch nicht all die Mauern um sich herum aufgebaut hatte, die sie isolieren und schützen, nebenbei auch Olivia schützen – und so wird das Datum für gewöhnlich mit einem kurzen Telefonat beglichen, bei dem die beiden Frauen abwechselnd die Möglichkeit erkunden, von einem bedeutsamen Datum zu sprechen, ohne dass ein einziges Wort bedeutsam wäre oder eine zweite Absicht erahnen ließe, irgendeine Art von Tiefe, eine Falle. Es gibt keine Gespräche mehr über Ausflüge oder Reisen, die erfordern würden, zumindest kurz über den zweiten Mann ihrer Mutter zu sprechen. Und diese fragt nie nach den Partnern der Tochter, die sie vielleicht für austauschbar hält; sie kommt weiterhin zu Olivias Premieren, bleibt aber nach Ende der Aufführung nicht lang und pflegt keinerlei Kommentar abzugeben, erwartet offensichtlich auch keinen von Olivia, wenn diese erzählt, eine ihrer Installationen gesehen oder einen Artikel darüber gelesen zu haben. Nie reden sie vom Vater, und in den letzten sechs Jahren hat Olivia nur zweimal gewagt, die Mutter über ihn zu befragen. Auch Besuche sind ungewöhnlich; sie bedürfen langer Verhandlungen, die meistens per Mail geführt werden, da die Mutter kein Mobiltelefon mehr benutzt. Ein einziges Mal hat Olivia, als sie noch in Withington wohnte, überraschend Besuch von ihrer Mutter bekommen. »Was hast du denn mit deinem Haar angestellt?«, hatte Olivia, ohne sich bremsen zu können, bei ihrem Anblick gefragt. »Schrecklich, nicht wahr?«, erwiderte die Mutter und fügte mit einem herausfordernden, auch rätselhaften Blick, der einen versteckten, nicht deutbaren Humor verriet, von dem Olivia wusste, dass er die Einleitung einer Attacke war: »Da siehst du’s, meine Liebe, du bist immer eine Inspiration für mich gewesen«, wobei die Mutter – Olivia lächelt, den Blick fest auf die Landstraße gerichtet und auf die von ihr zerschnittene Landschaft – nicht log, da Olivia damals selbst einen scheußlichen Haarschnitt hatte, der ihr Jahre später peinlich war, als sie ihr persönliches Aussehen nicht mehr aggressiv gegen sich selbst und die anderen einsetzte. Die Mutter hatte einen Karton voller Orangen dabei, aber die hatte Olivia noch nie gemocht, und so brachte sie den Karton am folgenden Tag zu einer Suppenküche der Kirche und fühlte sich dabei zutiefst schuldig.
Im Laufe der letzten Jahre hatten sich die Arbeiten ihrer Mutter von den Themen Raum und Erfahrung entfernt, die sie in ihren Anfängen, in den 1980er-Jahren, beschäftigt hatten, dennoch werden sie weiterhin, das glaubt zumindest Olivia, von einem essenziellen Abstandnehmen bestimmt, aus dem sie einen Gutteil ihrer Kraft ziehen; ihre erste Aktion 1981 im Alter von vierundzwanzig hatte ihre Prägung durch die Arbeiten von Patricia Johnson und Athena Tacha – in geringerem Maße auch durch die von Dennis Oppenheim – gezeigt: Zu sehen war die Projektion eines Videos auf VHS, in dem ihre linke Hand einen Bleistift hielt und bestimmte Bewegungen in der Luft machte; diese Bewegungen ergaben keinen Sinn, außer in einem gewissen Saal des Universitätsmuseums, für den die Arbeit entwickelt worden war: Auf eine der Wände des Saals projiziert, schien die Hand der Mutter die Umrisse der botanischen Spezies nachzuzeichnen, die dort ausgestellt waren, wobei absichtlich im Unklaren blieb, ob das Kunstwerk in der Aufzeichnung des Gestus seiner Realisation bestand oder vielmehr in der Projektion und ob auf diese Weise die botanischen Musterexemplare – deren Sammeln, Bewahren und Studieren in den vergangenen Jahrhunderten eine beliebte Praxis war, die schon für sich etwas Künstlerisches hatte – auf diese Weise zum Blendwerk wurden und einer »Natur« abschworen, aus der sie einmal herausgelöst worden waren, um als Musterbeispiele studiert zu werden, oder ob die Bewegungen, die ihre Mutter machte und die so »natürlich« wirkten, durch ihre Projektion nun teilhatten an einer spezifischen Weise der Naturdarstellung; bewusst blieb unklar, ob das Stück ihrer Mutter irgendeinen Wert in sich selbst hatte, wenn man es nicht auf die botanischen Bilder projizierte. Olivia hatte einmal eine audiovisuelle Aufzeichnung der Aktion gefunden: Sie zeigte die Assistenten bei der Betrachtung der VHS-Projektion auf die botanischen Bilder, Olivia gefiel aber daran am besten, dass die Zeichenbewegungen der linken Hand ihrer Mutter – die aleatorisch, komplett zufällig wirkten – eine junge, kräftige Hand zeigten, die, trotz allem, der ihren etwas ähnelte.
Ein paar Wochen vor ihrem ersten und letzten unangekündigten Besuch hatte ihre Mutter eine Krebstherapie begonnen, aber das erfuhr Olivia erst später, als ihre Mutter wie nebenbei darauf Bezug nahm, dass man sie entlassen habe und ihr Haar wieder wachse, nun allerdings in einer Farbe, für die sie keinen Namen hatte, die man am ehesten aber als »elfenbeinernes Weiß« bezeichnen könne.
Ein König befahl um das Jahr 1235 herum einer Hirtenfamilie, seine Kinder aufzuziehen und zu versorgen, aber nicht mit ihnen zu reden, sie auch keinesfalls das Sprechen zu lehren; er wollte herausfinden, ob die Kinder, wenn sie zu sprechen begännen, dies auf Hebräisch, Griechisch oder Latein tun würden, Sprachen, die der König für die ältesten der Welt hielt. Alle Kinder starben jedoch, bevor sie ihre ersten Worte sagten. Achtzehn Jahrhunderte zuvor hatte laut Herodot ein Pharao sich Ähnliches vorgenommen, die Kinder hatten jedoch überlebt und ihr erstes Wort war becos gewesen, in dem die Gelehrten das phrygische Wort für »Brot« zu erkennen glaubten, was, so schlossen sie, bewies, dass das Phrygische die Ursprache der Menschheit war. Zwei Zwillingsknaben, 1903 aus dem Elend gerettet, in dem sie außerhalb von Kopenhagen mit einer taubstummen Greisin lebten, hatten eine private Sprache entwickelt, die der dänische Linguist Otto Jesperson »Liplop« nannte: Schwarz, auf Dänisch sort, war für sie lhop; Milch, maelk, nannten sie bap; das Licht, lys, war für sie lhylh, und die Kälte, auf Dänisch kulde, lhulh. Ein Satz wie »Wir werden den Kaninchen kein Futter bringen« hörte sich laut Jespersen folgendermaßen an: »Nina enaj una enaj hoena mad enaj«, wobei Nina Kaninchen hieß und enaj eine Negation, auf Dänisch nej. Im Allgemeinen aber sprechen Wolfskinder nicht, und ihr Schweigen steht vielleicht dafür, dass das, was sie erlebt haben, nicht gesagt werden kann und zu einem Reich ohne Bewusstsein, ohne Erinnerung und ohne Sprache gehört – da ist etwas, das man vielleicht vermisst, ohne es benennen zu können. Das Mädchen von Kranenburg hieß Anna Maria Gennärt, fällt Olivia ein, als sie zwei Vögel sieht, vielleicht ein Krähenpaar, das die Schnellstraße vor dem Auto überfliegt; aber es konnte diesen Namen nicht aussprechen, wie auch das 1735 in Issaux gefundene Mädchen, das kurz danach in ein Heim weggesperrt wurde, nicht ihren Namen sagen konnte. »Wovor war sie geflohen, als sie in den Wald rannte? Warum hatte man sie aufgegriffen? Was an ihrem Leben war wild außer den Ängsten und Vorstellungen jener, die sie bis zu ihrem Tod gefangen hielten?«, hatte der Dramatiker aus Burnley einmal Olivia gefragt, aber keine Antwort erwartet. Vielleicht waren ja auch sie Wolfskinder, hatten jedoch die Sprache, hätte Olivia antworten können; mit ihm gab es aber nur Fragen ohne Antwort. Vielleicht waren alle diese Mädchen, über die sie damals gelesen hatte, von ihren Eltern ausgesetzt worden, und nur Glück und eine Summe angeborener Talente hatten sie überleben lassen; an manchen Orten und zu manchen Zeiten war es dagegen tatsächlich möglich gewesen, dass sie von Wölfen geraubt wurden, die es damals in den Wäldern und um die Dörfer herum reichlich gab: Wenn eine Wölfin ihr Junges verliert und besondere Schmerzen durch das Gewicht ihrer übervollen Zitzen hat, kann sie sich ein anderes Junges suchen, um es zu säugen und sich Linderung zu verschaffen, oder sie kann sich ein Kind holen und es wie einen Welpen ernähren. Das Leben, das dieses Kind danach führt, kann uns monströs vorkommen, ist es vielleicht auch, aber der Großteil jener, die davon befreit werden, verkümmert unter Menschen, sie versuchen in die Wildnis zurückzukehren, bis die Kräfte, mit denen sie einer Domestizierung widerstehen, die sie nicht erbeten haben, erstickt sind und auch der Wille weiterzuleben erlischt. Im Übrigen werfen die Wölfinnen ihre Welpen nie aus dem Rudel, nicht einmal, wenn es sich um Menschen handelt; sie ernähren sie, schützen sie und retten sie damit vielleicht vor Müttern, die sich nicht um sie gekümmert haben, und vor einer Gesellschaft, die sich ebenfalls nicht um sie kümmert. Es gibt keine Geschichte, in denen ihre eigene Beziehung zur Mutter deutlicher anklingt, denkt Olivia.
Das Stück, an dem ihre Freundin und sie, kurz bevor sie sich trennten, in jener Wohnung in Bury gearbeitet hatten – all diese Blätter, die ihre Freundin während des Streits vernichtete – war nie mehr als das gewesen, Papier von geringer Bedeutung, außer jener, die Olivia ihm eine kurze Zeit lang gegeben hatte, und das war eine absolute Bedeutung: Es handelte sich oder sollte sich handeln um den Monolog von Ellen Ionesco, der ersten Frau, die einer Transorbitalen Lobotomie, auch »Eispickel-Lobotomie« genannt, unterzogen wurde; es war der Versuch, Ionesco das Wort zu geben, das ihr die Psychiatrie und deren Geschichte weiterhin verweigerten, und dies mit den Stimmen anderer Frauen zu bewerkstelligen, auf eine Weise, die aufzeigen sollte, wie dröhnend ihr Schweigen in Wirklichkeit gewesen war und dass es andauerte. Sie hatte das nicht zum ersten Mal gedacht, und vielleicht lag der Ursprung dieses Stücks – das sie irgendwann gern fertigschreiben würde, vielleicht mit Hilfe einer anderen Person – in der Intervention, die ihre Mutter ein paar Jahre zuvor in dem den Frauen vorbehaltenen Gebäudeflügel der ehemaligen städtischen Anstalt für Geistesgestörte durchgeführt hatte, ein Gebäude, das seit Jahrzehnten verfallen war, ohne dass irgendjemand wusste – auch nicht ihre Mutter, die einige Wochen in den Siebzigerjahren dort verbracht hatte, wie sie ihr später gestand –, ob diese Ruine noch von jemandem bewohnt wurde, und wenn ja, von wem: Ihre Mutter hatte das ganze Erdgeschoss mit roten Fäden überschwemmt, die sie von Wand zu Wand spannte, manchmal auf verworrene Weise, absichtlich verknäult, andere Male gleichsam einer Ordnung folgend, die man nicht erkennen, nur erahnen konnte; die Betrachter liefen ständig Gefahr, sich in den Fäden zu verheddern; manche Räume der Installation konnte man nicht einmal betreten, die Verknäuelung war so dicht, dass sie den Zugang versperrte; zuweilen, besonders am Eingang zu den kleineren Zimmern, seinerzeit als Isolier- und Strafzellen benutzt, schien das Dickicht der Fäden sich wie aufgesprengt über den Flur und auf die Besucher ergießen zu wollen. Es war nicht schwierig, das zu deuten, womöglich weil ihre Mutter nichts getan hatte, um ein Begreifen zu verhindern: Die Fäden waren die Gedanken der verrückten Frauen, die diese in ihren Köpfen verwebten, bis sie selbst keinen Zugang mehr dazu hatten, sich aus sich selbst vertrieben fühlten oder zumindest aus jenen Personen, die sie vor ihrer Geisteskrankheit gewesen waren; zugleich aber waren die Fäden auch die Stricke, mit denen man die Frauen fixierte, wenn sie ausrasteten oder einfach nur die Ärzte störten; sie waren von Frauen in einer Weberei in Manchester hergestellt worden, die ihre Mutter wieder in Gang gebracht hatte, sie war geschlossen gewesen, seitdem die Produktion vor etwa siebzig Jahren in Länder der Peripherie verlagert worden war. Viele der ersten Insassen des Heims hatten in den Webereien der Stadt gearbeitet, bevor sie arbeitslos wurden und ihr Niedergang hin zu Alter und Wahnsinn begonnen hatte. Besonders gut fand Olivia, dass ihre Mutter mit der Rückgewinnung dieser Fabrik die Verbindung zwischen Armut und Wahnsinn, aber auch zwischen Handarbeit und künstlerischer Produktion aufgezeigt hatte sowie zwischen dem Sachverhalt, eine arme Frau zu sein, und der Tatsache, nichts zu haben, auf das man sich stützen konnte, keinen Ort, wo man hätte hingehen können. Nur eins fehlte ihr bei dieser Installation, und sie erwähnte es Jahre später bei der ersten Gelegenheit, die sich dafür bot: Ihr hätte es gefallen, wenn ihre Mutter am Ende alle diese roten Fäden zusammengeführt und zusammengenäht hätte, damit deutlich geworden wäre, dass die Gedanken verrückter Frauen ihnen niemals ganz gehören, sondern auch Teil sind eines Ganzen, in dem das private Leid mit dem öffentlichen Leid zusammenfließt, das eine beschädigte Gesellschaft produziert mit dem einzigen Zweck, den Schaden zu vervielfältigen und zu steigern, und der Auswirkung, die dies alles auf den Menschen hat – damit ihre verrückten Frauen nicht allein wären, um es mal so zu sagen. Aber ihre Mutter hatte, als sie das hörte, nur die Schultern gezuckt und dann weggeschaut, als hätte Olivia sie geschlagen, oder, wahrscheinlicher, als könne sie so Olivia schlagen, die den Fehler begangen hat, sich in ihre Arbeit einzumischen und in diesen unzugänglichen Ort einzudringen, wo sie immer allein ist, an diese Arbeit oder an anderes denkend, Olivia weiß es nicht.
Vielleicht war dieser in seiner Intimität unerreichbare Bereich, der einige Jahre lang tatsächlich physisch zu verorten war – ihr Atelier in der Back Piccadilly, ein Ort, den Olivia immer noch als unerträglich in Erinnerung hat und wo sie dennoch eine Zeit lang gewohnt hat –, nicht nur ihr, sondern sogar ihrem Vater stets verboten gewesen, da dieser und ihre Mutter nie zusammen gearbeitet hatten außer auf die indirekte und nie sehr eindeutige Weise, in der das Künstler tun, die ein Paar sind, und in diesem Rahmen eine Mitwirkung ausüben, die sich darauf beschränkt, dem anderen mit einer gewissen Skepsis zuzuhören und Fragen zu stellen (oder auch für sich zu behalten), damit die Berührung zwischen dem einen künstlerischen Projekt und dem anderen nicht zur Einmischung gerät. Olivia weiß von solchen Berührungen, die sie ihrerseits gern fördert, und das Stück, das sie mit der Partnerin aus Bury zu schreiben versucht hatte – und das sie gerne einmal vollenden würde, sagt sie sich erneut, noch nicht wissend, was in einigen Minuten passieren wird, und sich einen Unfall auch gar nicht vorstellen könnend –, oder auch die Beziehung, die sie zu dem jungen Dramatiker aus Burnley hatte, sind nicht ihre einzigen Erfahrungen in dieser Hinsicht; die radikalste davon wurde ihr vor ein paar Monaten zuteil, als die Partnerin aus Bury und sie Der Schatten des Körpers des Kutschers von Peter Weiss in so etwas wie einen Theatermonolog verwandelt hatten, der jedoch von beiden zusammen vorgetragen wurde: Wenn das Werk undeutbar war – als »genial unverständlich« war es einmal beschrieben worden –, so lag das daran, dass es nicht einen, sondern zwei Kutscher gab, wie sie entdeckt zu haben glaubten; erst wenn das Stück aus dem Spielplan genommen wurde, wollten sie damit an die Presse gehen, ein Manifest zum Thema Schein und kontrollierter Trug sollte dann folgen: Bis dahin sollten die Zuschauer den Eindruck haben, einer einzigen Schauspielerin zuzusehen. Und Olivia hat sich ge-rade gefragt – die Hände bereits leicht verkrampft am Steuerrad, in einer Starre, die sie zu korrigieren pflegt, wenn sie ihr bewusst wird, die sie aber jetzt noch nicht bemerkt hat –, an was sie eigentlich gedacht hatte, als sie auf den Vorschlag ihrer Gefährtin einging, die sich das Haar bleichen wollte – die Gefährtin aus Bury hat das schwarze Haar der französischen Invasoren, die möglicherweise ihre Ahnen gewesen sind, aber Olivia ist blond wie ihr Vater, diese Art von Blond, die sich unter einem bestimmten Licht als verwaschenes Rot offenbart –, und als sie ihr dann den Akzent des Nordens antrainierte, dem die andere bisher widerstanden hatte, und sie an eine Gestik gewöhnte, der sie sich