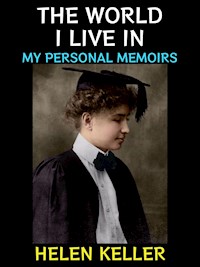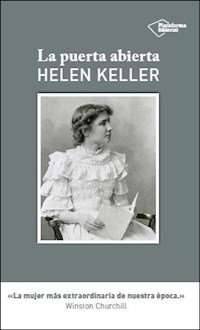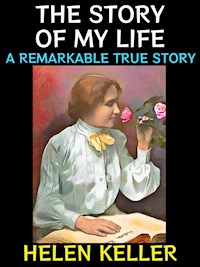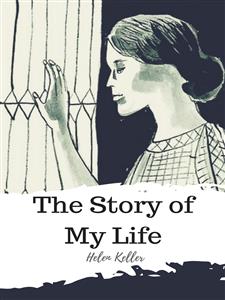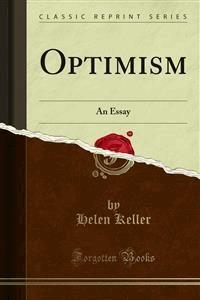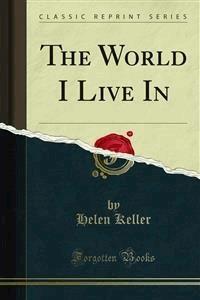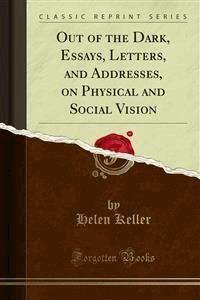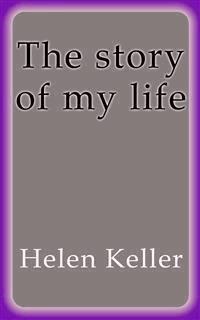17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Helen Kellers Welt versinkt in Dunkelheit und Stille, als sie im Kindesalter ihr Hör- und Sehvermögen verliert. Frustriert von der Unfähigkeit, sich mitzuteilen, wird sie zur Gefangenen im eigenen Körper. Erst ihre Lehrerin Anne Sullivan vermag es, ihre Welt wieder zu öffnen: Einfühlsam vermittelt sie ihr Wege, ihre Umgebung wahrzunehmen und ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken. In ihrer gefeierten Autobiografie erzählt Helen Keller von gezeichneten Buchstaben in ihrer Handfläche, dem Vibrieren eines nahenden Gewitters und dem Gefühl des Mondlichts auf der Haut. Ihr Weg ins Leben, vom Verstehen des ersten Wortes bis hin zum Abschluss an der Universität, ist ein eindrucksvolles Zeugnis eines unbezwingbaren Willens und bis heute Inspiration für viele.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
In ihrer gefeierten Autobiografie erzählt die taubblinde Schriftstellerin Helen Keller von ihrem Weg ins Leben: Von gezeichneten Buchstaben in der Handfläche und dem Verstehen des ersten Wortes bis hin zum Abschluss an der Universität. Das einzigartige, eindrucksvolle Zeugnis eines unbezwingbaren Willens ist bis heute Inspiration für viele.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Helen Keller (1880–1968) war eine taubblinde Schriftstellerin und Aktivistin. Sie setzte sich für Frauenrechte und Minderheiten ein und gründete eine Stiftung für Blinde und Gehörlose. Ihre Autobiografie Die Geschichte meines Lebens erzählt von ihrem Aufwachsen. Keller starb in Connecticut.
Zur Webseite von Helen Keller.
Susanne Höbel (*1953) lebt in Südengland und arbeitet als Übersetzerin englischer und amerikanischer Literatur. Sie wurde vielfach ausgezeichnet. Zu den von ihr übersetzten Autoren gehören Graham Swift, Nadine Gordimer, John Updike, Nicholson Baker, Margaret Forster und William Faulkner.
Zur Webseite von Susanne Höbel.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Helen Keller
Die Geschichte meines Lebens
Die außergewöhnliche Welt der taubblinden Schriftstellerin
Aus dem Englischen von Susanne Höbel
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1903 bei Doubleday, Page & Company, New York.
Die Chronik zu Leben und Werk wurde zusammengestellt von Lucien Leitess.
Lektorat: Patricia Reimann
Originaltitel: The Story of My Life
© by Unionsverlag, Zürich 2025
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Porträt – RGB Ventures/SuperStock (Alamy Stock Photo); Illustration – BlockBrushstrokes (Adobe Stock)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31186-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.02.2025, 16:30h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE GESCHICHTE MEINES LEBENS
1 – Ein kleines Angstgefühl beschleicht mich in diesem Moment …2 – Wie es in den ersten Monaten nach meiner …3 – Mein Wunsch, mich mitzuteilen, wuchs zusehends. Die wenigen …4 – Der wichtigste Tag in meinem Leben war der …5 – Ich erinnere mich an viele Ereignisse im Sommer …6 – Jetzt hatte ich den Schlüssel zur Sprache und …7 – Der nächste wichtige Schritt in meiner Erziehung war …8 – Das erste Weihnachtsfest nach Miss Sullivans Ankunft in …9 – Das nächste wichtige Ereignis in meinem Leben war …10 – Kurz bevor die Perkins Institution für den Sommer …11 – Im Herbst kehrte ich mit einem Herzen voller …12 – Nach meinem ersten Besuch in Boston verbrachte ich …13 – Im Frühling 1890 lernte ich sprechen. Der Impuls …14 – Der Winter 1892 lag unter einer dunklen Wolke …15 – Den Sommer und den Winter nach der Episode …16 – Bis zum Oktober 1893 hatte ich mich im …17 – Im Sommer 1894 nahm ich in Chautauqua an …18 – Im Oktober 1896 wurde ich an der Cambridge …19 – Als das zweite Jahr in der Gilman-Schule begann …20 – Mein Ringen darum, ins College aufgenommen zu werden …21 – Bisher habe ich die Ereignisse meines Lebens dargestellt …22 – Ich hoffe, meine Leser haben aus dem vorangehenden …23 – Wie gern würde ich diese Aufzeichnungen um die …Helen Keller: Leben und WerkAnmerkungenMehr über dieses Buch
Über Helen Keller
Über Susanne Höbel
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema USA
Zum Thema Biografie
Zum Thema Frau
1
Ein kleines Angstgefühl beschleicht mich in diesem Moment, da ich anfange, meine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Beim Heben des Schleiers, der meine Kindheit wie ein goldener Dunst umgibt, spüre ich ein gewisses abergläubisches Zögern. Eine Autobiografie zu verfassen, ist eine schwierige Aufgabe. Wenn ich versuche, meine frühesten Eindrücke zu ordnen, stelle ich fest, dass Tatsachen und Erdachtes, wenn man sie über die Jahre zwischen damals und heute betrachtet, gleich aussehen. Die Frau malt die Erfahrungen des Kindes in ihrer Fantasie aus. Ein paar Eindrücke aus den ersten Lebensjahren stehen lebhaft in meiner Erinnerung, aber »die Schatten des Eingesperrtseins liegen über dem Rest«. Zudem haben viele Freuden und Kümmernisse aus Kindestagen ihre Intensität eingebüßt, und Ereignisse, die in meiner frühen Bildung von lebenswichtiger Bedeutung waren, sind neben der Aufregung über große Entdeckungen in den Hintergrund getreten. Ich möchte nicht langatmig sein und werde deshalb in einer Reihe von Skizzen nur die Episoden darstellen, die mir als die interessantesten und wichtigsten erscheinen.
Ich wurde am 27. Juni 1880 in Tuscumbia, einer kleinen Stadt im nördlichen Alabama, geboren.
Väterlicherseits stammt die Familie von Caspar Keller ab, einem gebürtigen Schweizer, der nach Maryland auswanderte. Einer meiner Schweizer Vorfahren war in Zürich der erste Lehrer für Taubstumme und schrieb ein Buch über deren Erziehung, was ein erstaunlicher Zufall ist, aber natürlich trifft es zu, dass es keinen König gibt, der nicht auch Sklaven unter seinen Vorfahren hat, und keine Sklaven, die nicht einen König unter ihren Vorfahren haben.
Mein Großvater, Caspar Kellers Sohn, erwarb große Landstriche in Alabama, wo er sich schließlich auch niederließ. Mir wurde erzählt, dass er einmal im Jahr die Reise von Tuscumbia nach Philadelphia zu Pferd machte, um dort Vorräte für die Plantage einzukaufen. Meine Tante besitzt seine Briefe an die Familie, in denen er charmant und anschaulich von diesen Reisen berichtet.
Meine Großmutter väterlicherseits war die Tochter von Alexander Moore, einem Aide Lafayettes, und die Enkelin von Alexander Spotswood, einem der ersten Generalgouverneure von Virginia. Außerdem war sie eine Cousine zweiten Grades von Robert E. Lee1.
Mein Vater, Arthur H. Keller, diente als Hauptmann in der Armee der Konföderierten, und Kate Adams, meine Mutter, war seine zweite Frau und um viele Jahre jünger als er. Ihr Großvater Benjamin Adams heiratete Susanna E. Godhue und lebte viele Jahre in Newbury, Massachusetts. Charles Adams, der Sohn aus dieser Ehe, kam in Newburyport, Massachusetts, zur Welt und siedelte nach Helena, Arkansas, um. Im Bürgerkrieg kämpfte er aufseiten der südlichen Streitkräfte und wurde zum Brigadegeneral ernannt. Er heiratete Lucy Helen Everett, die aus derselben Everett-Familie stammte wie Edward Everett2 und Dr. Edward Everett Hale. Nach Ende des Krieges zog die Familie nach Memphis, Tennessee.
Bis zu meiner Krankheit, die mich meines Augenlichts und meines Gehörs beraubte, lebte ich in einem winzigen Haus, das aus einem großen quadratischen Zimmer bestand, mit einem kleineren Zimmer, in dem das Dienstmädchen schlief. Im Süden war es üblich, neben dem eigentlichen Wohnhaus ein kleineres Haus zu bauen, das zu besonderen Gelegenheiten benutzt wurde. Ein solches Haus baute mein Vater nach dem Bürgerkrieg, und als er meine Mutter heiratete, zog er mit ihr dort ein. Das Haus war überwachsen mit Wein, Kletterrosen und Geißblatt. Vom Garten aus gesehen ähnelte es einer Laube. Der kleine überdachte Eingang, umrankt von gelben Rosen und Stechwinden, wo Kolibris und Bienen lebten, war vor Blicken verborgen.
Das Wohnhaus, in dem die Familie Keller lebte, stand nur wenige Schritte von unserer kleinen Rosenlaube entfernt. Es hieß »Ivy Green«, weil das Haus, die Bäume im Garten und der Zaun mit schönem englischem Efeu bewachsen waren. Der altmodische Garten war das Paradies meiner Kindheit.
Noch bevor meine Lehrerin zu mir kam, hatte ich gelernt, mich an den kantigen, harten Buchsbaumhecken entlangzutasten, bis ich, vom Duft geleitet, auf die früh blühenden Veilchen und Lilien stieß. Hier suchte und fand ich nach Zornesausbrüchen Trost und verbarg mein heißes Gesicht zwischen den kühlen Blättern und im Gras. In diesem Blumengarten zu stöbern, war eine große Freude, ich wanderte dort glücklich umher, und wenn ich plötzlich auf Weinranken stieß, deren Blätter und Blüten ich erkannte, wusste ich, das war der Bewuchs des kleinen Sommerhauses am Ende des Gartens! Hier gab es auch rankende Clematis und hängenden Carolina-Jasmin und seltene Ingwerlilien, die einen zarten Duft hatten und deren Blütenblätter ähnlich wie Schmetterlinge geformt waren. Aber die Rosen – nichts war so lieblich wie die Rosen. Nie habe ich später, in den Gewächshäusern des Nordens, solche das Herz beglückenden Rosen gefunden, wie es die Kletterrosen im Garten meiner Kindheit im Süden waren. Sie hingen in langen Girlanden vom Vordach herab und verströmten einen Duft, an dem nichts Erdiges haftete, und morgens in der Früh, von Tau benetzt, waren sie so zart und so rein, dass ich nicht umhinkam zu denken, sie könnten den Affodillen im Garten Gottes ähneln.
Mein Leben begann einfach und verlief zunächst so wie jedes andere kleine Leben auch. Jedem Erstgeborenen in einer Familie geht es so, und mir auch: Ich kam, sah und siegte. Es gab die üblichen Diskussionen um meinen Namen. Dem ersten Kind der Familie konnte man nicht einfach irgendeinen Namen geben, darin waren sich alle einig. Mein Vater schlug Mildred Campbell vor, den Namen einer Vorfahrin, die er verehrte, und lehnte danach jede weitere Diskussion ab. Meine Mutter fand ihre Lösung, indem sie den Wunsch äußerte, ich möge nach ihrer Mutter benannt werden, deren Mädchenname Helen Everett war. Aber als mein Vater mich zur Kirche trug, verlor er in der Aufregung den Zettel mit dem Namen, was nur verständlich war, denn er hatte ja von diesem Vorschlag nichts wissen wollen, und als der Geistliche ihn danach fragte, wusste er nur noch, dass ich nach meiner Großmutter benannt werden sollte, und gab den Namen als Helen Adams an.
Den Erzählungen nach zeigte ich schon in frühester Kindheit eine wache und selbstbehauptende Veranlagung. Was immer ich an anderen Menschen beobachtete, wollte ich unbedingt nachahmen. Mit sechs Monaten konnte ich so etwas wie »Howdi« sagen, und einmal machte ich alle auf mich aufmerksam, weil ich laut und deutlich »tea, tea, tea« sagte. Selbst nach meiner Krankheit erinnerte ich mich an eins der Wörter, die ich zuvor gelernt hatte, nämlich »water«, und selbst nachdem mir alle Sprache abhandengekommen war, versuchte ich es zu artikulieren. Erst als ich lernte, das Wort zu buchstabieren, hörte ich auf, »wa-ha« zu sagen.
Angeblich lernte ich mit genau einem Jahr laufen. Meine Mutter hatte mich aus der Badewanne gehoben und hielt mich auf ihrem Schoß, als ich fasziniert den Schatten der Blätter beobachtete, die im Sonnenlicht auf dem glatten Fußboden tanzten. Ich rutschte meiner Mutter vom Schoß und rannte auf sie zu. Dann war der Moment vorüber, ich fiel hin und weinte und wollte, dass sie mich wieder auf den Arm nahm.
Diese glücklichen Tage waren nicht von Dauer. Ein kurzer Frühling, in dem das Lied des Rotkehlchens und der Spottdrossel erschallte, ein Sommer voller Früchte und Rosen, ein golden und rot gefärbter Herbst – sie legten einem hellwachen, neugierigen Kind ihre Gaben zu Füßen. Dann, im trüben Monat Februar, kam die Krankheit, die mir Augen und Ohren verschloss und mich wieder in den unbewussten Zustand eines neugeborenen Kindes versetzte. Sie nannten es akuten Blutandrang auf Magen und Gehirn. Der Arzt glaubte nicht, dass ich überleben würde. Doch eines Morgens schwand das Fieber so schnell und geheimnisvoll, wie es gekommen war, und in der Familie herrschte große Freude. Aber niemand, selbst der Arzt nicht, wusste in dem Moment, dass ich nie wieder sehen oder hören würde.
Ich bilde mir ein, wirre Erinnerungen an die Krankheit zu haben. Ich meine mich an die Zärtlichkeit zu erinnern, mit der meine Mutter in meinen wachen Stunden Unruhe und Schmerz zu lindern versuchte, an die Qualen und an das verstörende Gefühl, mit dem ich, mich aus dem Halbschlaf wälzend, erwachte, und wie ich meine trockenen, heißen Augen zur Wand drehte, fort von dem einst geliebten Licht, das von Tag zu Tag schwächer wurde. Doch von diesen Erinnerungen abgesehen, falls es überhaupt Erinnerungen sind, erscheint mir alles unwirklich, wie ein Albtraum. Allmählich gewöhnte ich mich an das Dunkel und die Stille, die mich umgaben, und ich vergaß, wie es früher gewesen war – bis zu dem Zeitpunkt, als sie, meine Lehrerin, ins Haus kam und meinen Geist befreite. Dennoch, in den ersten anderthalb Jahren meines Lebens hatte ich weite grüne Wiesen erblickt und einen leuchtenden Himmel, ich hatte Bäume und Blumen gesehen, und die Dunkelheit, die darauf folgte, konnte das nicht vollends auslöschen. Haben wir einmal gesehen, dann »gehört der Tag uns, und das, was er uns gezeigt hat«.
2
Wie es in den ersten Monaten nach meiner Krankheit weiterging, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich oft bei meiner Mutter auf dem Schoß saß oder mich an ihr Kleid klammerte, während sie ihren Haushaltspflichten nachging. Mit den Händen befühlte ich alle Dinge und verfolgte jede Bewegung, und auf diese Weise lernte ich vieles kennen. Bald spürte ich das Bedürfnis, mich mitzuteilen, und machte unbeholfene Zeichen. Ein Kopfschütteln bedeutete »nein«, ein Nicken »ja«, wenn ich an ihrem Kleid zog, hieß das »komm«, schubste ich sie weg, hieß es »geh«. Wenn ich eine Scheibe Brot wollte? Dann tat ich so, als würde ich von einem Laib eine Scheibe abschneiden und mit Butter bestreichen. Wenn ich wollte, dass meine Mutter Eis machte, tat ich so, als würde ich die Kurbel an der Eismaschine drehen, und zitterte, als wäre mir kalt. Aber auch meiner Mutter gelang es, mir vieles beizubringen. Wenn sie wollte, dass ich ihr etwas holte, verstand ich das, und ich rannte nach oben oder dahin, wo das Gewünschte war. Ihrer Liebe und Weisheit verdanke ich all das, was in meiner langen Nacht hell und gut war.
Ich verstand eine Menge von dem, was um mich herum vorging. Mit fünf Jahren lernte ich, die saubere Wäsche aus der Waschküche zu falten und in den Schrank zu legen, und ich konnte meine eigenen Kleider von denen der anderen unterscheiden. An den Kleidern, die meine Mutter und meine Tante anzogen, erkannte ich, ob sie ausgehen wollten, und jedes Mal bat ich, mitkommen zu dürfen. Immer wenn wir Besuch hatten, durfte ich am Schluss, wenn die Gäste gingen, dabei sein, und ich winkte ihnen zu, weil ich mich vage an die Bedeutung dieser Geste zu erinnern glaubte. Einmal kam eine Gruppe von Besuchern, was ich am Öffnen und Zuschlagen der Haustür und an anderen Geräuschen spürte, mit denen sich ihre Ankunft mitteilte. Einem plötzlichen Impuls folgend, bevor jemand mich hindern konnte, rannte ich nach oben, um mich nach meinen Vorstellungen schön anzuziehen. Ich stellte mich vor den Spiegel, wie ich es früher bei den anderen gesehen hatte, rieb mir Öl ins Haar und strich mir Puder aufs Gesicht. Auf meinem Kopf befestigte ich einen Schleier, der mein Gesicht bedeckte und mir über die Schultern fiel, und um meine schmale Taille band ich eine riesige Tournüre, die hinter mir wie eine Schleppe bis zum Saum meines Kleides herabhing. In diesem Aufzug ging ich wieder nach unten, um die Gäste zu unterhalten.
Ich weiß nicht mehr, wann ich begriff, dass ich anders war als andere Menschen, aber ich verstand es, bevor meine Lehrerin zu uns kam. Ich wusste, dass meine Mutter und meine Freunde nicht, wie ich, Zeichen benutzten, wenn sie etwas mitteilen wollten, sondern mit ihren Mündern sprachen. Manchmal stellte ich mich zwischen zwei Menschen, die im Gespräch waren, und berührte ihre Lippen. Ich verstand nicht, was sie taten, und wurde wütend. Ich bewegte meine Lippen und gestikulierte wild, ohne Ergebnis. Das machte mich so zornig, dass ich um mich schlug und schrie, bis ich ganz erschöpft war.
Ich glaube, ich wusste genau, wenn ich ungezogen war, denn natürlich merkte ich, dass ich Ella, meinem Kindermädchen, wehtat, wenn ich es trat, und sobald mein Zornesausbruch vorbei war, empfand ich so etwas wie Bedauern. Aber ich erinnere mich an keine einzige Situation, in der dieses Gefühl verhinderte, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich nicht das bekam, was ich wollte, genauso ungezogen war.
Damals waren Martha Washington, ein kleines farbiges Mädchen, die Tochter unserer Köchin, sowie Belle, eine alte Setter-Hündin, die in ihrer Jugend ein guter Jagdhund gewesen war, meine ständigen Begleiter. Martha Washington verstand meine Zeichensprache, und meistens setzte ich meinen Willen bei ihr durch. Ich mochte es, wenn ich sie mir gefügig machen konnte, und im Allgemeinen unterwarf sie sich eher meiner Herrschsucht, als dass sie es auf einen handfesten Kampf ankommen ließ. Ich war kräftig und willensstark und hatte keine Angst vor Folgen. Ich kannte meinen eigenen Kopf und setzte mich durch, auch wenn ich handgreiflich werden musste. Wir verbrachten viel Zeit in der Küche, wo wir Teig kneteten, beim Eismachen halfen, Kaffeebohnen mahlten und uns stritten, wer die Teigschüssel auslecken durfte; und wir fütterten die Hühner und Truthähne, die vor der Küche herumstolzierten. Viele waren so zahm, dass sie mir erlaubten, sie anzufassen, und mir aus der Hand pickten. Eines Tages schnappte einer der gierigen Truthähne eine Tomate aus meiner Hand und rannte damit fort, und wir, vielleicht von dem Vogel erkühnt, entwendeten einen Kuchen, den die Köchin gerade mit Puderzucker bestreut hatte, und aßen ihn beim Holzstapel vollständig auf. Danach war mir übel, und ich fragte mich, ob auch der Truthahn die Vergeltung zu spüren bekam.
Perlhühner verstecken ihre Nester gern, und mir war es ein großes Vergnügen, im langen Gras nach ihren Eiern zu suchen. Ich konnte Martha Washington nicht sagen, dass ich nach Eiern suchen wollte, aber wenn ich beide Hände ineinanderlegte und über den Boden hielt, was so viel bedeuten sollte wie etwas Rundes im Gras, verstand Martha mich. Hatten wir das Glück, ein Nest zu finden, erlaubte ich ihr nicht, die Eier ins Haus zu tragen, sondern gab ihr mit deutlichen Zeichen zu verstehen, sie könnte hinfallen und die Eier zerbrechen.
Die Scheunen mit den Getreidevorräten, die Ställe, in denen die Pferde untergebracht waren, und der Hof, wo die Kühe morgens und abends gemolken wurden, hatten für Martha und mich eine immerwährende Faszination. Die Melker erlaubten mir, beim Melken meine Hände auf die Kühe zu legen, und oft bekam ich für meine Neugier mit dem Schwanz eine gewischt.
Die Vorbereitungen für Weihnachten waren eine große Freude für mich. Natürlich wusste ich nicht, worum es ging, aber ich mochte die würzigen Düfte, die das Haus erfüllten, und die Leckerbissen, die Martha Washington und ich bekamen, damit wir uns ruhig verhielten. Oft waren wir im Weg, aber das minderte unser Vergnügen keineswegs. Wir durften die Gewürze zerreiben, die Rosinen verlesen und Teiglöffel abschlecken. Weil die anderen es taten, hängte auch ich einen Strumpf am Bettpfosten auf, obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, dass die Zeremonie mich besonders interessierte, auch wachte ich nicht voller Aufregung beim Morgengrauen auf, um meine Geschenke in Empfang zu nehmen.
Martha Washington war genauso übermütig wie ich. An einem heißen Nachmittag im Juli saßen zwei kleine Mädchen auf den Stufen der Veranda. Das eine war schwarz wie Ebenholz und hatte krauses Haar, das mit Schnürsenkeln zu kleinen, vom Kopf abstehenden Büscheln gebunden war. Das andere war weiß und hatte lange blonde Locken. Das eine Kind war sechs Jahre alt, das andere zwei oder drei Jahre älter. Das jüngere Kind war blind – das war ich –, und das andere Kind war Martha Washington. Wir waren damit beschäftigt, Anziehpuppen auszuschneiden, aber das machte schon bald keinen Spaß mehr, und nachdem ich alle Schnürsenkel zerschnitten und alle erreichbaren Blätter am Geißblattbusch abgeschnitten hatte, wandte ich meine Aufmerksamkeit Marthas Korkenzieherhaaren zu. Erst weigerte sie sich, doch dann ließ sie mich gewähren. Nach dem Prinzip »Wie du mir, so ich dir« nahm sie mir nach einer Weile die Schere ab und fing an, meine Locken abzuschneiden, und sie hätte jede einzelne abgeschnitten, wäre meine Mutter nicht rechtzeitig eingeschritten.
Unsere Hündin Belle, meine zweite Gefährtin, war alt und träge, und am liebsten schlief sie beim Feuer, statt mit mir herumzutollen. Ich versuchte ihr meine Zeichensprache beizubringen, aber sie war zu dumm und unaufmerksam. Manchmal schreckte sie hoch und zitterte vor Erregung, dann erstarrte sie, wie Hunde es tun, wenn sie einen Vogel erspähen. Ich wusste nicht, warum Belle sich so verhielt, aber ich verstand, dass sie nicht das tat, was ich wollte. Das ärgerte mich, und solche Situationen endeten jedes Mal mit einem ungleichen Boxkampf. Dann erhob Belle sich, streckte sich und schnüffelte verächtlich, bevor sie sich auf der anderen Seite des Kamins wieder hinlegte, worauf ich mich enttäuscht auf die Suche nach Martha machte.
Viele Ereignisse dieser frühen Jahre sind in meinem Gedächtnis verankert, wo sie einzeln, aber klar und deutlich stehen und ein starkes Gefühl von diesem stillen, ziellosen, unstrukturierten Leben heraufbeschwören.
Eines Tages verschüttete ich Wasser über meine Schürze, und ich breitete sie vor dem Feuer aus, das im Kamin des Wohnzimmers brannte. Die Schürze trocknete nicht so schnell, wie ich es mir wünschte, deshalb ging ich näher ans Feuer und warf sie in die heiße Asche. Die Flammen schossen empor und umfingen mich, und im nächsten Moment brannten meine Kleider lichterloh. Ich machte ein großes Geschrei, worauf Viny, meine alte Kinderfrau, herbeieilte. Sie warf eine Decke über mich, unter der ich beinah erstickt wäre, aber sie löschte die Flammen, und abgesehen von ein paar Brandspuren an meinen Händen und meinem Haar trug ich keine Verletzungen davon.
Es war ungefähr um diese Zeit, dass ich die Verwendung von Schlüsseln begriff. Eines Morgens schloss ich meine Mutter in der Speisekammer ein, wo sie drei Stunden lang bleiben musste, weil die Hausangestellten in einem anderen Teil des Hauses arbeiteten. Sie trommelte an die Tür, und ich saß auf den Verandastufen und freute mich, die Vibrationen ihres Klopfens zu spüren. Dieser schlimme Scherz überzeugte meine Eltern, dass ich möglichst schnell Unterricht bekommen müsse. Gleich nachdem Miss Sullivan, meine Lehrerin, zu uns gekommen war, suchte ich nach einer Gelegenheit, sie in ihrem Zimmer einzuschließen. Ich ging mit einer Sache nach oben, die ich, wie meine Mutter mir zu verstehen gegeben hatte, Miss Sullivan geben sollte, aber sobald ich dies getan hatte, schlug ich die Tür zu, schloss sie ab und versteckte den Schlüssel unter einem Schrank im Flur. Nichts konnte mich überreden, das Versteck des Schlüssels preiszugeben, und so war mein Vater genötigt, Miss Sullivan mit einer Leiter aus ihrem Zimmer zu holen, worüber ich mich diebisch freute. Monate später gab ich den Schlüssel heraus.
Als ich ungefähr fünf Jahre alt war, zogen wir von dem mit Weinranken überwachsenen Häuschen in ein großes neues Haus. Die Familie bestand aus meinen Eltern und zwei älteren Halbbrüdern, und später kam eine Schwester hinzu, Mildred. In meiner frühesten Erinnerung an meinen Vater arbeitete ich mich durch Massen von Zeitungspapier zu ihm vor und fand ihn allein mit einem Blatt Papier vor dem Gesicht. Ich verstand überhaupt nicht, was er da tat. Ich ahmte ihn nach und setzte mir sogar seine Brille auf, weil ich hoffte, so das Geheimnis zu lösen. Aber es dauerte mehrere Jahre, bis ich imstande war, es zu enträtseln. Dann lernte ich auch, was das für Papiere waren und dass mein Vater der Herausgeber einer Zeitung war.
Mein Vater war sehr liebevoll und nachsichtig, er kümmerte sich hingebungsvoll um seine Familie und verließ uns nie, außer in der Jagdsaison. Er war, so sagte man mir, ein guter Jäger und treffsicherer Schütze. An erster Stelle galt seine Zuneigung seiner Familie, dann kamen die Hunde und das Gewehr. Er war sehr gastfreundlich und kam selten nach Hause, ohne einen Gast mitzubringen. Sein besonderer Stolz war der große Garten, wo er, so hieß es, die besten Wassermelonen und Erdbeeren in der Region anpflanzte. Mir brachte er die ersten reifen Trauben und die köstlichsten Beeren. Ich erinnere mich an seine zärtliche Hand, wenn er mich von Baum zu Baum führte und zu den Weinranken, und wie überschwänglich er meine Freude teilte.
Man schätzte ihn als Geschichtenerzähler, und nachdem ich mir Sprache erworben hatte, machte nichts ihm mehr Freude, als mir seine besten Anekdoten ungeschickt in die Hand zu buchstabieren, die ich dann bei einer passenden Gelegenheit wiederholte.
Ich war im Norden, wo ich die letzten herrlichen Sommertage des Jahres 1896 genoss, als mich die Nachricht vom Tod meines Vaters erreichte. Er war erkrankt und starb nach kurzem schwerem Leiden – und es war vorbei. Dies war mein erster großer Verlust, meine erste persönliche Begegnung mit dem Tod.
Wie soll ich von meiner Mutter sprechen? Sie ist mir so nah, dass es fast unschicklich scheint, von ihr zu erzählen.
Lange hatte ich meine kleine Schwester als Eindringling betrachtet. Ich wusste, dass ich nicht länger der einzige Liebling meiner Mutter war, und der Gedanke machte mich eifersüchtig. Ständig saß meine Schwester auf dem Schoß meiner Mutter, dort, wo ich gesessen hatte, und schien alle ihre Fürsorge und Zeit für sich in Anspruch zu nehmen. Dann geschah etwas, das mir alles noch ärger machte.
Damals hatte ich eine viel gehätschelte und misshandelte Puppe, die ich später Nancy nannte. Sie war gleichermaßen das wehrlose Opfer meiner Zornesausbrüche und Zärtlichkeiten und war davon sehr gezeichnet. Ich hatte andere Puppen, die sprechen und weinen und ihre Augen auf- und zumachen konnten, aber keine liebte ich so wie Nancy. Sie hatte ein Wiegenbett, in dem ich sie oft eine Stunde lang wiegte. Mit eifersüchtiger Aufmerksamkeit wachte ich über Nancy und die Wiege, aber eines Tages fand ich meine kleine Schwester, die friedlich schlafend in der Wiege lag. Diese Übertretung seitens meiner Schwester, mit der mich zu dem Zeitpunkt noch keine Liebe verband, versetzte mich in so großen Zorn, dass ich die Wiege umstieß. Das hätte den Tod des Babys bedeuten können, wäre meine Mutter nicht zur Stelle gewesen und hätte sie aufgefangen. So ist es, wenn man im Tal doppelter Vereinsamung geht – man weiß nichts von den zärtlichen Banden, die aus Miteinander, aus liebevollen Worten und Taten erwachsen. Später jedoch, nachdem ich wieder teilhatte am Vermächtnis menschlichen Seins, wuchsen zwischen Mildred und mir Herzensbande, und wir wanderten Hand in Hand umher, wohin unsere Launen uns leiteten, und das, obwohl sie meine Fingersprache nicht verstehen konnte und ich nicht ihr kindliches Plappern.
3
M