
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Auf den Spuren des Feuervogels Die Weihnachtsferien sind da! Edith ist voller Vorfreude, ihren Onkel wiederzusehen, den Tierarzt für magische und mythische Wesen. Diesmal wartet ein noch viel gewaltigeres Abenteuer auf sie, denn der seltene Phönix des Nordens, einer von weltweit sechs Phönixen, scheint in größter Gefahr. Hält man ihn gefangen? Wird er gequält? Warum finden die anderen Tiere eine goldene Schwanzfeder, aber keine Spur von ihm? Edith, der Doktor, Francis und Hund Arnold machen sich auf den Weg in den Bayerischen Wald, um Licht in das Dunkel zu bringen. Dabei gewinnt Edith die Freundschaft eines mutigen Jungen. Gemeinsam mit ihm trifft sie auf einen eigentümlichen Mann in Mönchskutte und deckt ein Geheimnis auf, das jede Vorstellungskraft sprengt. - Tier-Fantasy voller origineller und witziger Einfälle mit unvergesslichen Charakteren - Für Fans von ›Animox‹ und ›Woodwalkers‹ Alle Bände der Reihe: Band 1: Die Gesellschaft der geheimen Tiere Band 2: Die Gesellschaft der geheimen Tiere – Der geraubte Phönix
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Der einzigartige und kostbare Phönix des Nordens ist gekidnappt worden und schwebt in größter Gefahr! Sogleich machen sich Edith und ihr Onkel, der Tierarzt für magische und mythische Wesen, auf den Weg in dessen Heimat, den Bayerischen Wald. Dort treffen sie auf brutale Mischwesen aus Wolf, Bär und Schlange und finden erste Spuren des Vogels. Aber wie hängt alles zusammen? Kann Ji-Ji, der freundliche Junge aus dem Ort, ihnen weiterhelfen?
Für Edith beginnt ein Abenteuer, in das sie sich voller Leidenschaft stürzt. Unterstützung bekommt sie von den Tieren des Waldes.
Luke Gamble
Die Gesellschaft der geheimen Tiere
Der geraubte Phönix
Für meine Mutter und all die anderen Tierfreunde der Welt
Prolog
Die hohen Bäume des Waldes ragten wie eine Reihe von Reißzähnen in den Nachthimmel hinauf. Durchs dichte Geäst bohrte sich plötzlich ein goldener Lichtschein ins Dunkel. Das Licht schlängelte sich vorwärts und wand sich langsam durchs Gewirr der Äste. Dabei ließ es eine Leuchtspur hinter sich zurück, brach dann auf eine Lichtung hinaus und blieb dort am Boden liegen.
Der kleine Vogel war erschöpft. Im dichten Baumbestand war kaum an Fliegen zu denken gewesen, und nun musste er verschnaufen und seine verbliebenen Kräfte sammeln. Selbst die Schatten hier, tief im dunkelsten Wald, konnten seinen goldenen Schein nicht vollständig verhüllen, und er wusste um die Jäger, die ihm dicht auf den Fersen waren. Er reckte den Kopf in die Höhe und erhaschte einen Blick hinauf zum Nachthimmel. Mit einer flinken Schnabelbewegung zupfte sich das Tier eine goldene Feder von der Brust und ließ sie auf den Waldboden fallen. Vielleicht konnte der Vogel hier aufsteigen und entkommen, aber falls nicht, dann würde vielleicht jemand von seiner Not erfahren.
Der Vogel breitete die leuchtenden Flügel aus. In den Jahren der Gefangenschaft hatten sie viel von ihrer Strahlkraft eingebüßt, denn das einstmals dichte Kleid aus goldenen Federn war schütter geworden. Er war abgemagert, und die eigentlich rasiermesserscharfen Klauen waren spröde und eingerissen. Trotzdem würde er niemals aufgeben.
Irgendwo tief im Wald raschelte es, der Vogel erschrak, und aus seinen Flügeln strahlte trotzig und blendend hell ein goldener Lichtschein auf. Es gab keine Zeit zu verlieren.
In Vorbereitung auf eine letzte Anstrengung äugte das Tier noch einmal zu den Sternen hinauf. Wind war kaum zu spüren, erst recht nicht hier unten im dichten Bestand regloser Stämme, doch als der Vogel die Muskeln zum Start spannte, fegte plötzlich eisige Kälte über die Lichtung.
Mit einem entschlossenen Sprung schnellte er himmelwärts. Aber etwas war nicht richtig. Der linke Flügel gab ihm nicht den nötigen Halt, das Tier geriet ins Trudeln, flatterte hilflos seitwärts und fiel zu seiner Verzweiflung wie ein Federknäuel zurück auf den Waldboden. Das war bis jetzt seine beste Gelegenheit gewesen. Und an diesem Punkt seiner Lebensgeschichte lernte er eine neue Empfindung kennen: Hoffnungslosigkeit. Nun gab es keinen Ausweg mehr.
Das Wesen, das nur Augenblicke später in einem weiten Satz auf den Pfad im Wald sprang, schien aus einem schrecklichen Albtraum zu stammen.
Aus seinem Kopf ragten an tödliche Spieße erinnernde Stümpfe, und aus den Vorderpfoten ragten spitze Klauen, und während die pelzigen Ohren eine Weichheit andeuteten, die dem restlichen Körper gänzlich abging, leuchteten die Augen bernsteinfarben wie bei einem jagenden Wolf. Das Wesen war eine abscheuliche Vermischung von Bestien des Waldes, verschmolzen zu einer einzigen fürchterlichen Kreatur.
Es bleckte die Reißzähne und schob sich näher an den Vogel heran, während aus seiner Kehle ein triumphierendes Geräusch drang, halb Krächzen, halb Geheul. Ein entsetzlicher Ruf, der in die Nacht hinausschallte und auf einem langen, beklemmenden Ton endete, der schwer in der kalten Luft stehen blieb.
Lange Augenblicke verstrichen, während sich wieder eine fast unheimliche Stille über den Wald legte. Keines der Wesen rührte sich, und nur das flache, dampfende Keuchen des Untiers drang in die Nachtkühle hinaus.
»Gib ihm den Rest«, zischte es von oben aus dem Geäst. »Ich frage mich, ob du dich daran erinnerst, wie oft wir das schon getan haben. Erinnert sich ein Phönix an jeden seiner erlittenen Tode? Kennst du ihre Zahl, kleiner Vogel? Mit jeder Wiedergeburt wird es leichter, dir auf der Spur zu bleiben. Dein Körper ist so ausgemergelt, dass du schon nicht mehr fliegen kannst, aber ich will noch mehr von dir. Es gibt noch so viel zu tun …«
In der Stimme schwang eine Sehnsucht mit. Ein Hunger.
»Was hilfst du mir wohl diesmal zu erschaffen«, schnarrte die Gestalt, trat hinter dem mutierten Geschöpf auf die Lichtung und ließ den in die Enge getriebenen Phönix nicht aus den Augen.
»Los!«, hallte der Befehl durch die Nacht.
Das Untier rollte die Augen nach hinten und sprang unvermittelt los. Mit wilder Wut und einer Vehemenz, die seine geringe Größe Lügen strafte, stürzte es sich auf den Phönix.
Mit zwei schnellen Sätzen war es bei dem Vogel, die Fangzähne zum Zuschlagen bereit, die Klauen gespannt – und erstarrte. Die Zähne stoppten nur Zentimeter von den goldenen Federn entfernt, die Kreatur taumelte seitwärts und schüttelte den Kopf.
Das Ungeheuer schien einen inneren Widerstreit auszufechten. Einerseits wollte es offensichtlich den Phönix wie befohlen angreifen und bleckte laut knurrend die Zähne; andererseits schien es dem Drang zum Zubeißen zu widerstreben und zurückzuweichen.
Der Phönix verharrte regungslos und beobachtete den wankenden Angreifer. Für einen Moment schien sein durchdringender Blick eine Regung zu verraten: Bedauern. Aber nicht um seinetwegen. Der Phönix reckte sogar einladend den Hals, als würde er sich dem Ungeheuer anbieten, weil er verstand, wer von ihnen beiden sich in diesem Augenblick in größerer Gefahr befand. Ohne Zweifel hatte das abstoßende Wesen unter seinem bösartigen Meister schon allzu viel erduldet.
Der Armbrustbolzen traf den Phönix mit solcher Wucht, dass der kleine Vogel vom Boden hochgerissen und über die gesamte Lichtung geschleudert wurde und zuletzt an einem Baumstamm aufgespießt hängen blieb. Sein Körper erschlaffte im Sterben.
Das Untier sah es mit an, krümmte sich zusammen und jaulte auf – ein Geräusch irgendwo zwischen einem Kreischen und einem Heulen.
»Du warst so nah dran …«, knurrte sein Meister wehmütig.
Als der Phönix zu leuchten begann, wich das Monster winselnd zurück, vom zweiten Schuss aus der Armbrust völlig unerwartet ins Herz getroffen. Es sackte augenblicklich auf den Waldboden, wobei sein Körper noch ein wenig zuckte.
»Du warst nicht perfekt, aber bald wirst du es sein, mein Kleiner«, sagte die Gestalt mit einem Blick auf die Kreatur, die ihren letzten Atemzug tat. Das Wesen zuckte immer noch, als die Gestalt herankam, den Stiefel auf den Leichnam setzte und den gefiederten Bolzen aus der durchbohrten Brust zog. Die Spitze kam mit einem schmatzenden Geräusch frei, bei dem die Gestalt leise kicherte. Sie wischte das Geschoss rasch ab und schob es wieder in den Köcher.
Nun traf flackerndes Licht die umstehenden Bäume, denn aus den Federn des erlegten Phönix schlugen Flammen. Für eine kleine Weile brannte der Körper des Vogels gleißend hell in der Dunkelheit.
Die Gestalt beschirmte ihre Augen; dann trat sie rasch vor und legte die Armbrust am Boden ab. Ein auf dem Schaft der Waffe eingeprägter flammender Totenkopf leuchtete zum Himmel empor, während die Gestalt die Finger in eine am Gürtel befestigte Tasche schob und eine kleine Plastiktüte herauszog.
»Nur eine Prise«, sagte sie voller unterdrückter Erwartung und ging vor dem brennenden Leichnam in die Knie. Eine Hand schoss hervor, nahm ein winziges bisschen der Asche, die von dem verkohlten Vogel geblieben war, gab sie sorgsam in die Tüte und versiegelte diese flink. Dann ging der Blick der Gestalt zurück auf das kleine Häufchen Asche, das geblieben war.
Aus dem Baumstamm ragte noch immer der Bolzen, der den Phönix getötet hatte; sein Schaft war nun von den Flammen geschwärzt und kahl gebrannt. Die Gestalt zog ihn aus der Rinde und schob ihn mit zufriedenem Brummen zurück in den Köcher.
»Und nun die Wiedergeburt!«
Sie hob die Armbrust auf, hängte sie sich über die knochige Schulter und betrachtete den Leichnam des Untiers, das, im Mondlicht ausgestreckt, im gefallenen Laub lag.
»Ein paar Veränderungen sind noch nötig, um dich zu einem wirklichen Mörder zu machen. Aber die Nacht ist ja noch jung. Ich brauche nur etwas mit ein wenig mehr Killerinstinkt dazuzugeben.«
Das letzte Wort hing noch in der Nachtluft, als der schlaffe Körper des Ungeheuers vom Boden aufgehoben wurde. Die Augen der Gestalt leuchteten im Widerschein der vorherrschenden Flammen des Phönix, das Gesicht nun ein bösartiges Grinsen.
»Nicht mehr lange.«
Nun hallte ein hohes durchdringendes Zwitschern über die Lichtung. Der als winziges Küken wiedergeborene Phönix tippelte ein paar Schritte nach hinten, in dem erbärmlichen Versuch, der Gestalt zu entkommen, die ihn gejagt hatte.
Zu spät. Schon packte eine Hand das hilflose Vögelchen und schob es tief in eine geräumige Tasche.
»Und wie immer gibt es noch mehr zu tun«, murmelte die Gestalt, zufrieden mit dem in dieser Nacht Erreichten, vor sich hin. Sie wandte sich um, marschierte los und verschwand alsbald lautlos im Dunkeln zwischen den Bäumen.
KAPITEL EINS
In dem es Weihnachten wird und Edith weiß, dass sie zum Waldhaus zurückkehren wird … aber zuerst muss sie ein paar Klassenarbeiten überstehen …
An der St.-Montefiore-Mädchenschule ging es strenger zu als an anderen Londoner Internaten. Hier hatte man schließlich einen Ruf zu verteidigen. Während andernorts das Schuljahr mit Krippenspielen, Konzerten mit Weihnachtsliedern und allerlei festlicher Vorfreude schloss, hatten die Mädchen von St. Montefiore Prüfungen zu bestehen.
Wie zu erwarten war der Saal, in dem die Klausuren abgehalten wurden, kahl, kalt und abweisend. Vorn, vor der ersten Reihe der Einzeltische, gähnte ein riesiger offener Kamin. Und wie üblich war dieser leer, es brannte kein Feuer darin. Madam Montefiore hatte erklärt, so etwas wäre Verschwendung.
»Kinder müssen aktiv sein. Sie sollten sich durch emsige Bemühungen warm halten«, hatte man sie bei vielen Gelegenheiten sagen hören.
Die Wände des Saals waren weiß getüncht, klinisch sauber und standen damit in einem gewissen Widerspruch zu den alten dunklen Balken, die nach oben strebten und die hohe Decke trugen. Das Holz ließ Wärme und Gemütlichkeit zumindest erahnen, und tatsächlich war der Raum vor dem Einzug der Schule ein Festsaal gewesen. Nun war es denkbar schwer, sich vorzustellen, dass Menschen an diesem Ort einmal fröhlich getanzt und gelacht hatten. Auch Edith Wight, die alleine dasaß und nervös an ihrem Bleistift kaute, hätte das kaum für möglich gehalten.
Nicht dass sie sich um so etwas gekümmert hätte. Die Mathematikarbeit ohne Taschenrechner war schon ihre zweite Prüfung an diesem Tag. Da man die Antworten nur ankreuzen musste, bestand durchaus die Möglichkeit, dass sie die richtige traf. Viel nutzte das allerdings auch nicht. Die Aufgaben waren furchtbar schwierig und die Antworten so formuliert, dass sie auch die klügsten Kinder in die Irre führen mussten. Selbst Edith, für die Mathematik sogar Schwerpunktfach war, steckte fest.
Je länger Edith auf das Blatt starrte, desto mehr verschwammen die Winkel, Brüche und Prozentzahlen vor ihren Augen. Verzweifelt versuchte sie, sich an Formeln zu erinnern, die ihr vielleicht einmal zufällig irgendwo untergekommen waren, die man in ihrer Klasse aber ganz bestimmt nicht gelehrt hatte. Außerdem fand sie es lächerlich und furchtbar ungerecht, dass die Lehrerinnen ihr – und nur ihr – so eine unmögliche Klausur abverlangten. Und doch war es so. Dahinter steckte, wie Ediths beste Freundin Anita erklärt hatte, eine »ganz bestimmte Absicht«.
Und tatsächlich verfolgte die Schule mit Edith eine bestimmte Absicht, denn sie war für St. Montefiore zu einem Problem geworden. Edith war völlig verändert aus den Sommerferien zurückgekehrt. Das schüchterne Mädchen mit den ständigen Kopfschmerzattacken war verschwunden. Und obwohl ihre Situation mit den im Urwald am Amazonas verschollenen Eltern ungewiss blieb, obwohl man das Mädchen über die Sommerpause einem Onkel aufgehalst hatte, den es bis dahin gar nicht gekannt hatte, und obwohl Edith als kränkliches Mädchen aufgebrochen war, das man nicht einmal ohne Begleitung nach draußen hatte gehen lassen können, war sie zum Erstaunen der Lehrerinnen, aber auch ihrer Mitschülerinnen voller neu gewonnenem Selbstvertrauen zur Schule zurückgekehrt.
Sie ging nun viel aufrechter, konnte an Ausflügen in Museen oder zu Vorträgen teilnehmen und sogar in den Schulpausen nach draußen gehen; allerdings blieb sie nach wie vor am liebsten mit Anita in der Bibliothek und las Bücher über die Tierwelt und deren Biologie. Am eindrücklichsten allerdings war, dass sie den Lehrerinnen nun in die Augen sah, und das mit dem Blick eines Kindes, das den »Glauben an sich selbst« gefunden hatte.
Nichts ängstigte die Lehrerinnen der St.-Montefiore-Mädchenschule so sehr wie ein Kind, das Selbstvertrauen hatte. Solche Mädchen waren gefährlich, schwierig und eigensinnig. Sie leisteten mehr Widerstand, brachen kaum in Tränen aus, und ihr Wille war schwer zu brechen. Daher gab man sich alle Mühe, solche Schülerinnen so schnell wie möglich aus der Schule hinauszuekeln – doch Edith wurden sie zum höchstpersönlichen Entsetzen von Madam Montefiore nicht los.
Ediths Eltern, beide berühmte Forscher und Wissenschaftler, waren seit vergangenem Schuljahr im Amazonasgebiet verschollen. Die Schreckensmeldungen waren durch alle Zeitungen gegangen. Im südamerikanischen Urwald verschwundene Cambridge-Absolventen, so etwas erregte Aufsehen. Auch Madam Montefiore war dazu befragt worden und hatte erzählen müssen, wie mutig Edith war – und bekräftigen, dass das Kind in dieser schwierigen Zeit natürlich auf die volle Unterstützung seiner Schule zählen konnte. Dank einer strategisch eingesetzten fein gewiegten Zwiebel war ihr sogar ein gepeinigter Gesichtsausdruck gelungen angesichts der Notlage des armen Mädchens in ihrer Obhut.
Edith der Schule zu verweisen, während alle Augen auf sie gerichtet waren, konnte allerdings unangenehme Folgen haben. Die Schulräte würden Fragen stellen, gerade jetzt, wo sich die Schule öffentlich gerühmt hatte, dass man sich mit größter Hingabe um das arme Mädchen kümmern würde. Und den guten Ruf ihrer geschätzten Institution durfte Madam Margot Montefiore selbstverständlich nicht aufs Spiel setzen.
Nein, ohne guten Grund konnte man Edith nicht der Schule verweisen. Leider war sie auch nicht die Sorte Kind, die versuchte, die Schule in Brand zu stecken oder dergleichen. Sie war höflich und hielt sich an die Regeln. Als einzige Möglichkeit blieb, Edith das Leben so schwer zu machen, dass sie die Schule von sich aus verlassen würde. Und dieser Plan war nun in vollem Gang.
Die Extraklausuren kurz vor Weihnachten waren das perfekte Mittel, jemanden zu entmutigen. Die Schulleitung war sich sicher, dass Edith einknicken würde. Und das Beste: Niemand würde dieses Vorgehen infrage stellen; die gute Edith konnte einfach fachlich nicht mithalten – und überdies würde die Schule das im Voraus entrichtete Schulgeld behalten können. Und um ganz sicherzugehen, hatte man Edith auch noch gesagt, wenn sie nicht die Note sehr gut erreiche, müsse sie das Schuljahr komplett wiederholen.
»Du hast noch fünfzehn Minuten. Wenn es läutet, legst du den Stift weg und verlässt in aller Stille den Raum.« Die scharfe Stimme von Miss Bittiful, der freudlosen Mathematiklehrerin, die links neben dem Kamin an ihrem Pult thronte, hallte durch den Saal.
An Miss Bittiful war einfach alles unangenehm: ihre Stimme, die Art, wie sie von oben herab knapp über die Schulter der Person hinwegstarrte, mit der sie gerade sprach, und auch die Tatsache, dass sie keine Klasse jemals pünktlich zum Läuten entließ, sondern immer ein paar Minuten überzog – nur um sicher zu sein, dass die Schülerinnen sich in der Mensa ganz hinten in die Warteschlange einreihen mussten und um einen Teil ihrer Pause gebracht wurden.
Edith warf einen Blick auf ihre Schultasche neben der Tür. Von dem zusammengefalteten Brief, den sie oben hineingesteckt hatte, konnte sie eine kleine Ecke herausragen sehen. Dieser Umschlag – schmutzig und voller Eselsohren – war um die halbe Welt gereist. Edith hatte den Brief, obwohl sie ihn erst in der Mittagspause von Madam Montefiore erhalten hatte, schon mehrere Male gelesen.
»Schon wieder verlassen worden, Edith Wight. Das wird bei deinen Eltern ja langsam zur Gewohnheit. Könnte es sein, dass sie bei ihrer Amazonas-Kreuzfahrt ein bisschen zu viel Spaß haben – so ohne dich?«, hatte Madam Montefiore gefragt und gemein gelächelt, als sie ihr den Brief hinhielt.
Edith war zu entsetzt gewesen, um zu antworten. Sie hatte sich zusammenreißen müssen, um nicht aufzustöhnen und Madam Montefiore den Brief aus der Hand mit den dicken Fingern zu reißen. Sie hatte den Brief ganz ruhig an sich genommen und mit großer Willenskraft abgewartet, bis der Schulleiterin schließlich die Zeit zu lang wurde und sie davonging.
Das Kuvert war schon geöffnet gewesen, aber es ent-hielt die Nachricht, die Edith sehnlich erwartet hatte. Ihre Eltern waren in Sicherheit. Voller Erleichterung las sie die von ihrem Vater rasch hingekritzelten Zeilen. Das Hochwasser war offenbar zurückgegangen, und ihre Mutter und er waren von einem dort ansässigen Stamm gerettet worden.
Sie hatten es bis in ein Dorf geschafft und diesen Brief an die Stammesangehörigen übergeben, die einen Boten in die Stadt schickten, von wo er per Luftpost bis an Ediths Schule gekommen war.
Ihre Eltern wollten jetzt, wo das Wasser gefallen war, allerdings noch einmal losziehen, um ihr Boot zu finden – und damit wichtige Papiere und die wissenschaftlichen Aufzeichnungen von vielen Monaten. Danach wollten sie nach England zurückkehren. Sie hatten erstaunliche Entdeckungen gemacht, von denen die Welt nun endlich erfahren sollte.
Das bedeutete allerdings, dass sie Weihnachten nicht heimkommen würden, begriff Edith. Ihr brannten Tränen in den Augen. Was konnte an Schmeißfliegen schon so aufregend und geheimnisvoll sein? Waren diese Erkenntnisse so wichtig, dass ihre Eltern nicht einmal zu Weihnachten nach Hause kommen könnten? Waren Fliegen so viel wichtiger als sie?
Sie kniff sich dafür, dass sie so etwas gedacht hatte. Ihre Eltern liebten sie, und sie liebte ihre Eltern. Bestimmt hatten sie ihre Gründe. Und deshalb machten sie sich jetzt wieder auf zu ihrem Boot, und deshalb würden sie für weitere Monate fort sein. Im letzten Abschnitt versprachen sie, an Ostern zurückzukommen.
»Ist er von deinen Eltern?«, hatte Anita gefragt, die neben ihr auf der Bank saß, sich herüberlehnte und neugierig auf das Papier linste.
»Ja.« Edith atmete tief durch.
»Und? Kommen sie nach Hause?«
»Nicht zu Weihnachten, aber sie sind in Sicherheit, und das Hochwasser geht zurück. Sie haben es in ein Dorf geschafft«, sprudelte es aus Edith heraus, während sie ihre Freundin ansah.
Anita lächelte.
»Das ist ja wunderbar! Bestimmt freust du dich riesig!«
»Ja, sicher! Natürlich freue ich mich. Ich hatte bloß gehofft … ich hatte gehofft, sie kämen früher zurück, um mich von diesem schrecklichen Ort hier wegzuholen.«
Anita legte ihrer Freundin den Arm um die Schulter und drückte sie ein bisschen.
»Aber dafür darfst du über Weihnachten doch bestimmt wieder zu deinem Onkel, oder?«
Edith nickte, und ihre Stimmung heiterte sich auf. Die Aussicht, Weihnachten mit dem Doktor, Betty, Arnold, Francis, Gerry und all den wunderbaren Tieren beim Waldhaus zu verbringen, genügte, um das Lächeln ihrer Freundin zu erwidern.
»Hoffentlich kannst du auch einmal mit mir zusammen das Waldhaus besuchen.«
»Das würde ich gern. Und du MUSST mal nach Indien kommen. Meine Eltern möchten dich unbedingt kennenlernen, und ich bin mir sicher, dass es dir gefallen würde. Die Tiere dort sind einfach unglaublich.«
Edith war sich ziemlich sicher, dass sie in Sachen unglaublicher Tiere beim Waldhaus die Nase vorn hatte, hielt aber den Mund. Anita wusste zwar, dass ihr Onkel Tierarzt war, aber welche Sorte Tiere er behandelte, davon hatte Edith niemandem erzählt. Das war alles streng geheim.
»Ich kann es kaum erwarten. Aber zuerst muss ich all diese Prüfungen schaffen. Gleich nach der Mittagspause habe ich noch eine Extraklausur.«
Anitas Lächeln erstarb.
»Das macht mich fix und fertig«, bemerkte Edith niedergeschlagen. »Sie sagen, wenn ich jetzt keine Eins schreibe, muss ich das ganze Jahr wiederholen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier durchhalte, Anita.«
Ihre Freundin riss entsetzt die Augen auf.
»Du darfst nicht weg von hier! Auf keinen Fall! Ich weiß, dass sie dich ungerecht behandeln, aber du kannst es trotzdem schaffen. Du bist der klügste Mensch, den ich kenne. Und ich gönne ihnen den Triumph nicht. Diese fiesen Typen dürfen nicht damit durchkommen – und außerdem würdest du mir wahnsinnig fehlen.«
Anita drückte Edith noch einmal an sich.
»Ich werde mein Bestes geben«, antwortete Edith entschlossen.
Im Prüfungsraum wurde Edith aus ihren Gedanken gerissen, als Miss Bittiful sich lautstark räusperte. Edith bei ihrem verzweifelten Kampf durch ihren schrecklichen letzten Schultag zu beobachten schien ihr ein geradezu sadistisches Vergnügen zu bereiten. Ihr Mausgesicht war zu einem schadenfrohen Grinsen verzogen; selbst ihre lächerlich auftoupierte Turmfrisur schien Edith schadenfroh zu verhöhnen … und Edith fragte sich, ob Miss Bittiful ihr Haar überhaupt jemals wusch.
Der dichte Filz schien nämlich fast ein Eigenleben zu führen, wie er schon bei den geringsten Bewegungen von Miss Bittifuls winzigem Kopf wie verrückt herumwirbelte und über diesem wie eine Pagode aus grauen Spinnweben aufragte.
Plötzlich flitzte eine winzige Spinne über den Klausurbogen, und Edith erschrak ein wenig. Dann schien das Tier unschlüssig, wo es hinwollte.
»Ach, Netzfäule und Blattlausdreck! Ich werde wohl nie wieder zurückfinden.«
Die feine Stimme klang in Ediths Kopf nach. Hastig nahm sie den Stift aus dem Mund und setzte sich gerade.
Unwillkürlich prüfte sie mit einem kurzen Blick, ob die Lehrerin etwas bemerkt hatte, und wandte sich dann wieder der Babyspinne zu.
Seit frühester Kindheit hatte Edith immer wieder schreckliche Kopfschmerzen bekommen, wann immer sie nach draußen gegangen war oder einen neuen Ort besucht hatte. Auch die besten Ärzte in England hatten keine Erklärung dafür gefunden. Wegen dieser Kopfschmerzen hatte Edith als »Problemkind« gegolten, das immer drinnen bleiben musste, nie mit auf Klassenfahrt gehen konnte und gelegentlich diese rätselhaften Anfälle hatte. Deshalb war sie überhaupt nach St. Montefiore gekommen – keine andere Schule hatte sie aufnehmen wollen.
Aber dann war sie über die Ferien bei ihrem Onkel gewesen und hatte die Ursache entdeckt. Sie war überhaupt nicht krank. Ganz im Gegenteil: Sie besaß eine besondere Gabe. Eine besonders seltene Gabe, denn sie war eine telepathische Polyglotte. Das bedeutete, sie konnte einfach nur durch die Kraft ihrer Gedanken mit Kreaturen aller Art sprechen. Kopfschmerzen hatte sie nur gehabt, solange diese Fähigkeit in ihr eingeschlossen gewesen war. Kaum hatte sie diese entdeckt und angewandt, waren die Schmerzen wie durch Zauberei verschwunden.
Nun machte sich Edith ihre Gabe zunutze und konzentrierte sich.
»Kann ich dir helfen?«, formulierte sie in ihren Gedanken.
Die Spinne erstarrte, huschte ein kleines Stück zurück und hob dann ihr Vorderende an, als würde sie die riesige Gestalt am Schreibtisch eben erst bemerken. Offenbar sah sie, dass Edith auf sie herabblickte, denn überrascht stotterte sie:
»S… S… Sprichst du etwa mit mir?«
Edith lächelte und blickte wieder verstohlen zu Miss Bittiful hinüber.
»Ja. Ich spreche mit dir. Aber ich stecke gerade mitten in einer Prüfung und muss deshalb so tun, als würde ich mich auf das hier konzentrieren.«
Sie tippte mit dem Ende des Bleistifts auf das Klausurblatt.
»Oh. Ja … also … na, so was.«
Die meisten Tiere erschraken zunächst, wenn Edith sie ansprach, und auch die Spinne musste sich offensichtlich erst daran gewöhnen. Edith kreuzte auf dem Frageblatt bei einer besonders schwierigen Aufgabe aufs Geratewohl Antwort B an. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, wie sie die Lösung herausfinden sollte.
»Was ist denn los?«, fragte Edith nach einer kurzen Pause. »Kann ich dir helfen?«
»Ich habe mich verirrt. Ich bin aus dem Nest gefallen, und dann war ich auch schon auf dem Fußboden. Ich bin diesen Holzpfosten hinaufgekrabbelt, und jetzt bin ich hier. Ich muss doch zurück zu meiner Familie, aber ich … ich habe keine Ahnung, wie ich sie finden kann.«
Edith war sich nicht sicher, ob Spinnen weinen konnten, aber es kam ihr vor, als sei die Kleine hier den Tränen nahe.
»Vielleicht kann ich dir helfen. Wo wohnst du denn? Es muss ja ganz in der Nähe sein, wenn du aus dem Nest gefallen bist.«
»Na ja, da ist es dunkel und warm … und es ist weit oben. Ich gehe ja kaum einmal nach draußen; Mutter warnt uns immer, dass es da draußen sehr gefährlich ist. Aber ich wollte doch wissen, wie es dort ist!«
Edith überlegte. Sie wandte den Blick hinauf zur Decke und suchte diese sorgfältig ab. Der Raum wirkte klinisch sauber – kein Spinnengewebe, keine Spur von Staub zu sehen.
Wo sollte eine Spinne hier ihr Nest bauen? Im offenen Kamin vielleicht?
Als ihr Blick wieder kurz über Miss Bittiful schweifte, riss Edith überrascht die Augen auf. Kroch da nicht etwas Kleines, Schwarzes aus der Turmfrisur der Lehrerin heraus und ließ sich dann langsam in Richtung Pult herunter? Edith starrte angestrengt hin. Da tauchte noch ein kleiner schwarzer Punkt auf und arbeitete sich außen um den Haarturm herum. Mit einem Mal war es Edith klar: Die Spinnen wohnten in Miss Bittifuls Haar!
Sie sammelte ihre Gedanken, konzentrierte ihre Energie und beschwor in ihrem Kopf Bilder der winzigen Spinnen herauf.
»Hallo, ihr kleinen Spinnen. Könnt ihr mich hören?«
Nichts. Vergeblich kniff Edith die Augen zusammen, um die Spinnen besser zu sehen. Vielleicht waren diese ja zu weit entfernt, um sie zu hören. Sie versuchte es noch einmal und trieb ihre Gedanken stärker an.
»Hallo! Könnt ihr mich hören?«
Miss Bittiful starrte verärgert auf das Blatt Papier auf ihrem Schreibtisch, tippte ungeduldig mit dem Fuß und ahnte offenbar nichts von den winzigen Wesen, die auf ihrem Kopf herumkrochen. Herumgekrochen waren, genau genommen. Als Edith wieder hinspähte, waren die beiden Spinnen erstarrt. Eine hing am Ende eines feinen Seidenfadens, der von Miss Bittifuls Frisur baumelte, und drehte sich im Kreis. Edith fand, der Faden hatte die gleiche Farbe wie der Rest der Frisur. Vielleicht war es ja kein Zufall, dass das ganze Gebilde aussah, als bestünde es aus Spinnweben.
»Ihr könnt mich hören, nicht wahr? Ich bin das blonde Mädchen mit Pferdeschwanz, das am Schreibtisch sitzt.«
Nun erklang eine feine Stimme. »Bernard – hörst du das auch?«
»Lässt sich kaum vermeiden. Aber ich bin hier den Elementen ausgesetzt und riskiere Kopf und Kragen. Ist es denn sicher, dass Bert hinausgefallen ist – und sich nicht einfach nur vor uns versteckt?«
»Darum geht es nicht, Lieber. Diese Stimme – dort ist ein Menschenmädchen, das mit uns spricht!«
»Oh«, sagte Bernard.
Edith musste schmunzeln. Sich mit Spinnen, Würmern und Insekten zu unterhalten war immer besonders lustig.
Die Spinnen waren offensichtlich sehr aufgeregt und besprachen die Situation untereinander. Edith gab ihnen einen Moment Zeit, um sich zu beruhigen.
»Bernard – willst du mit ihr reden oder soll ich?«
»Vielleicht besser du, Liebling. Die Lage scheint sich zu beruhigen, und ich sollte den Abstieg fortsetzen.«
Während sich Bernard langsam in Richtung Schreibtisch abseilte, wandte sich die andere Spinne an Edith.
»Wer bist du? Und was willst du? Wir finden es ziemlich unhöflich, wenn man uns völlig unerwartet anschreit. So hat noch nie ein Mensch mit uns geredet.«
»Hast du überhaupt schon einmal mit einem Menschen geredet, meine Liebe?«, war Bernard vom Schreibtisch zu vernehmen.
»Konzentriere dich, Bernard. Finde Bert. Natürlich habe ich das nicht, aber sie muss doch erfahren, dass sie uns nicht einfach so mit ihren Gedanken bombardieren sollte.«
Edith fragte sich, wie man eine Unterhaltung mit einer Spinne denn sonst beginnen sollte.
»Entschuldigung. Ich habe mich nur gefragt, ob ihr jemanden sucht? Ich glaube nämlich, dass Bert hier auf meinem Schreibtisch sitzt«, antwortete sie höflich.
»Das stimmt!«, war eine leise Stimme zu hören, und einen Augenblick später: »Mama, Papa! Ich bin hier drüben!«
»Bernard – sie hat Bert! Das Menschenmädchen hat Bert in ihrem Netz!!!«
»Ich habe kein Netz«, sagte Edith. Sie blickte starr auf das Blatt Papier vor sich auf dem Tisch, um auch ja keinen Anhaltspunkt dafür zu geben, dass sie während einer Prüfung eine intensive Diskussion führte.
»Ich bin ein Mensch. Bert ist aus dem Nest gefallen – wahrscheinlich, als Miss Bittiful mir das Examensblatt gereicht hat. Er ist hier bei mir, auf dem Schreibtisch.«
»Gib ihn zurück. Du darfst ihn nicht behalten!«
Edith verdrehte die Augen. Sie blickte auf ihr Blatt hinunter.
»Mama ist immer ziemlich angespannt«, raunte Bert. »Aber sie spinnt die klebrigsten Netze«, schob er entschuldigend nach.
»Ich glaube, du kannst nur zurück nach Hause kommen, wenn die Lehrerin herkommt und meine Klausur holt«, bemerkte Edith. »Glaubst du, du könntest bis zu ihr hinaufspringen?«
Bert gab keine Antwort. Edith begriff, dass er wirklich noch ein Baby war. So hoch konnte er unmöglich springen.
»Mädchen, du musst zu ihr hinübergehen.« Bernards Stimme schallte in Ediths Gedanken.
»Was?«, antwortete sie verblüfft.
»Zu deiner Lehrerin. Du musst deine Prüfung früher beenden. Steh auf und gib deine Klausur ab. Die Lehrerin wird sich dann hinsetzen, und du stehst dicht neben ihr. Bert kann sich dann von oben herab ins Nest fallen lassen – das schaffst du doch, mein Sohn, oder?«
»Ich glaube schon, Papa«, antwortete Bert schüchtern.
»Also – dann kletterst du jetzt auf das Menschenmädchen, und sie bringt dich dann zu uns herüber.«
Edith wurde leicht panisch, als Bert heranhuschte, auf ihre Hand krabbelte und dann über den Arm bis zur Schulter hinaufwanderte. Wenn sie jetzt schon ihre Prüfung beendete, würde sie auf jeden Fall durchfallen. Ihr blieben zehn Minuten, und sie musste noch zwanzig Fragen beantworten. Es sah ganz so aus, als müsse sie nun doch das ganze Schuljahr wiederholen.
»Ich kann jetzt noch nicht kommen«, wandte sie ein. »Ich muss erst diese Klausur zu Ende schreiben.«
»Ich wusste es, sie ist doch ein Spinnen-Napper!«, rief die Mutter.
»Beruhige dich, Liebes. Schau doch, hier vor der Lehrerin liegt tatsächlich ein Blatt Papier auf dem Schreibtisch. Da sind eine Menge Zahlen drauf, und neben jeder ein Buchstabe. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist der Lösungsbogen. Wie wär’s, wenn ich dir die Antworten zurufe, Mädchen? Dann wärst du in kürzester Zeit fertig.«
Edith staunte. Hatte Miss Bittiful tatsächlich die Lösungen vor sich auf dem Tisch liegen? Sie überflog ihr Blatt und suchte eine der wenigen Fragen heraus, bei der sie sich mit der Antwort sicher war.
»Schauen wir mal. Siehst du neben der Nummer sechs auf dem Blatt zufällig ein C?«
Es dauerte kurz, bis der winzige schwarze Fleck auf dem Tisch seinen Standort gewechselt hatte.
»Ja, stimmt!«, antwortete Bernard.
»Red keinen Unfug, Bernard, du kannst doch gar nicht lesen – das hast du dir ausgedacht«, warf die Mutter vorwurfsvoll ein.
»Natürlich kann ich lesen!«, protestierte Bernard. »Ich wohne jetzt schon ein ganzes Jahr in diesem Haar. Die Lehrerin macht den lieben langen Tag nichts anderes, als zu lesen, und das häufig sogar laut. Das hast du doch auch gehört, Liebes. Zuerst dachte ich, sie würde mit jemand anderem reden, aber sie liest sich tatsächlich selbst vor. Besonders in der Badewanne … auf diese Weise muss man zwangsläufig ein paar Dinge aufschnappen. Das mit dem Lesen habe ich schon vor langer Zeit durchschaut. Nach einer leckeren Blattlausmahlzeit geht einfach nichts über eine schöne Gutenachtgeschichte. Sie ist jetzt schon mit den ganzen Klassikern durch. Ich glaube, als Nächstes werde ich mit ihr Französisch lernen.«
»Nein, das wirst du nicht! Du sorgst dafür, dass Bert nach Hause kommt!«
»Das werde ich, Liebes, keine Sorge. Also – welche Buchstaben möchtest du noch genannt bekommen, Mädchen?«
Bernard war eine sehr praktisch veranlagte Spinne, dachte Edith bei sich – obwohl er mit seinen Lesefähigkeiten ein bisschen angab.
»Na – wir könnten doch einfach oben an der Seite anfangen und …«
»Sie will, dass du SCHUMMELST!«, schrie die Mutter. »Und wir sollen dabei ihre Komplizen sein! Wofür hältst du uns? Bernard – hörst du mir überhaupt zu? Ist es denn zu glauben? Du darfst ihr nicht helfen.«
»Wir müssen Bert doch wieder nach Hause holen, Liebling.«
»Bernard, du kannst doch ein solches Verhalten nicht auch noch unterstützen. Schließlich gibt es gute Gründe dafür, Prüfungen abzuhalten!«
»Liebling. Einen Gefallen sollte man erwidern. Und jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Wenn die Lehrerin wieder aufsteht, dann wird Bert den Sprung unmöglich schaffen.« Er hatte seiner Stimme nun einen stählernen Klang eingewoben, und seine Frau verstummte.
Bernard war offensichtlich eine außergewöhnliche Spinne, wenn er dazu gezwungen wurde, dachte Edith.
»Da ist noch etwas.«
Seine Stimme klang nun etwas ferner, und Edith konnte eben so ausmachen, dass der winzige schwarze Fleck von der Schreibtischplatte auf den Antwortbogen hinaufkrabbelte. Miss Bittiful schien die kleine Spinne, die da vor ihr herumhuschte, überhaupt nicht zu bemerken. Sie hatte aber ihren Arm zur Seite gelegt, sodass Bernard in höchster Not hatte ausweichen müssen, um nicht zerquetscht oder auf den Boden gewischt zu werden.
»Was denn?«, fragte Edith und unterdrückte ein Lächeln, das sich auf ihrem Gesicht breitmachen wollte. Er war wirklich schlau, dieser Bernard.
»Wir haben hier oben gerade keinen einzigen Krümel. Könntest du uns vielleicht etwas zu essen bringen?«
»Bernard, dafür ist jetzt keine Zeit! Der arme Bert!«, jammerte seine Frau.
»Was sein muss, muss sein, Liebes. Keiner meiner Netzgefährten soll hungern, solange ich das verhindern kann. Ich weiß, was passieren kann, wenn du und die anderen hungrig seid. Ich werde nicht enden wie der arme Onkel Tiberius!«
Edith hatte bestimmt nicht vorgehabt, bei der Prüfung zu mogeln, aber extreme Notlagen erforderten extreme Maßnahmen. Durchzufallen durfte sie nicht riskieren – das verschaffte den Lehrerinnen nur noch mehr Munition, um ihr das Leben an der Schule zu verleiden. Also schlug sie in den Handel ein.
»Ich werde euch etwas zu essen bringen. Das kriegen wir hin. Könntest du jetzt die Zahlen und Buchstaben vorlesen?«
»Du wirst uns also etwas zu essen bringen, wenn du Bert ablieferst?« Bernard ließ sich nicht drängen, bis die Vereinbarung niet- und nagelfest war.
Edith überlegte. Um an die Antworten zu kommen, musste sie wohl irgendein Spinnenmahl in Miss Bittifuls Haarturm befördern.
»O.k. Ich habe da ein halbes Sandwich in meiner Tasche.«
»Mit was darauf?«
»Käse.«
»Gut – ein bisschen Käse wäre gar nicht schlecht. So kann das funktionieren. Bist du bereit? Ich werde jetzt die Antworten vorlesen.«
Für einen Augenblick herrschte Stille, während Bernard wieder seine Position einnahm. Edith konnte sehen, wie sich der schwarze Punkt langsam wieder ein Stück in Richtung Netz hinaufhangelte.
»1 – C, 2 – A, 3 – D, 4 – B…«
Edith konzentrierte sich, ging ihre Antworten durch und füllte die Lücken, während Bernard die Lösungen herunterspulte.
Das Ganze dauerte nur wenige Augenblicke, und als Edith am Ende des Fragebogens angekommen war, seufzte sie von ganzem Herzen. Dann überlegte sie kurz und änderte eine Antwort, sodass sie falsch war. Sie durfte nicht alles richtig haben – das wäre verdächtig, und vielleicht würde man die Klausur dann wiederholen. Achtundneunzig Prozent richtige Antworten, das genügte. Das war immer noch eine glatte Eins. Sie blickte auf die Uhr. Ihnen blieben fünf Minuten.
»Bert – bist du bereit?«, fragte sie. »Komm auf meine rechte Schulter. Dann bist du am dichtesten an ihrem Haar, wenn wir bei ihr am Schreibtisch stehen.«
»Ja, ich bin so weit.«
»Also los, mein Sohn. Deine Mutter und ich erwarten dich schon«, rief Bernard ermunternd.
»Oh, Bert, sei vorsichtig!«, jammerte die Spinnenmutter.
Edith machte sich bereit; kurz bevor Miss Bittiful die letzten fünf Minuten ankündigen konnte, schob sie ihren Stuhl zurück und ging, ohne innezuhalten, nach vorn zum Lehrerpult.
»Ich bin fertig, Miss.«
Miss Bittiful rückte mit ihrem Stuhl verblüfft ein Stückchen zurück. Edith beugte sich näher heran, streckte ihr das Arbeitsblatt hin – und hörte einen leisen Ruf, als Bert zum Sprung ansetzte.
»Und looooooooooooooooooooooos …«
Für einen Augenblick war es still.
»Gut gemacht, mein Sohn. Ein toller Sprung!«
»Danke, Papa.«
»Ach, Bert, was für ein Glück, dass du wieder da bist! Das muss ich deinen Brüdern und Schwestern erzählen. Du kannst froh sein, dass du noch am Leben bist! Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht nach draußen gehen sollst!«
»Und was ist mit dem Essen?«, fragte Bernard bestimmt.
»Das hole ich jetzt«, antwortete Edith.
Miss Bittiful blickte verwundert auf das Blatt.
»Du bist früher fertig?«, fragte sie argwöhnisch.
»Ja, Miss. Ich hole kurz meine Tasche.«
Miss Bittiful stand unvermittelt auf.
»Hast du gemogelt, Edith Wight? Wie konntest du diese Klausur vorzeitig beenden? In den zwanzig Jahren, die ich jetzt an dieser Schule unterrichte, hat niemals jemand eine Mathematikklausur vorzeitig abgegeben!« Miss Bittiful kniff die Augen zusammen. »Irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu.«
Edith ging die paar Schritte zurück zu ihrem Tisch und bückte sich, um ihre Tasche aufzuheben.
»Gib sie mir!«, blaffte Miss Bittiful.
Edith reichte ihr stumm ihre Schultasche. Miss Bittiful riss sie ihr aus der Hand und breitete den Inhalt auf dem Lehrerpult aus. Zum Vorschein kamen das Buch über Elefanten aus der Bücherei, Ediths Schulmäppchen und das in eine Serviette eingeschlagene halbe Sandwich.
»Ugh«, machte Miss Bittiful, als sie die Tasche auf den Kopf stellte. Es kam aber nichts mehr heraus, und Miss Bittiful machte ein enttäuschtes Gesicht.
Vorsichtig machte sich Edith daran, ihre Sachen wieder einzusammeln. Dabei stieß sie das Sandwich absichtlich an, und es fiel auf den Boden.
»Heb das sofort auf!«, keifte Miss Bittiful.
Edith bückte sich und pulte beim Aufheben ein paar Käsekrümel heraus.
»Also, ich bin wirklich überrascht, gelinde gesagt …«, fuhr Miss Bittiful fort. »Wir wollen einmal sehen, wie du abgeschnitten hast, und wenn es den Maßstäben von St. Montefiore nicht genügt, wirst du natürlich die Konsequenzen zu tragen haben. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass du dieses Schuljahr wiederholen musst – nötigenfalls auch ein weiteres Mal. Das wäre doch furchtbar schade, nicht wahr?«
Miss Bittiful hatte nun wieder das übliche spöttische Grinsen im Gesicht, und Edith war versucht, sich zu beschweren, wie ungerecht sie das alles fand, aber sie beherrschte sich.
»Ja, Miss Bittiful«, erwiderte sie stattdessen.
Miss Bittiful kniff die Augen zusammen.
»Das Schuljahr endet morgen früh. Ich sorge dafür, dass Madame Montefiore dein Ergebnis dann vorliegen hat«, bemerkte sie gehässig. »Geh schon. Ich rate dir, nutze den Abend und überlege dir, wie groß dein Appetit aufs Lernen ist. Du wirst wahrscheinlich eine Menge davon brauchen.«
Sie drehte sich von Edith weg, beugte sich über den Schreibtisch und packte ihre Sachen zusammen.
In diesem Augenblick warf Edith das erste Käsestückchen. Es beschrieb einen eleganten Bogen und landete ganz weich oben auf Miss Bittifuls Turmfrisur.
»Wunderbar«, rief Bernard, und Edith musste kichern, als sie den winzigen Bissen im grauen Dickicht verschwinden sah.
»Hast du noch mehr? Wir sind eine ziemlich große Familie, musst du wissen.«
»Wie viele seid ihr denn?«, fragte Edith etwas in Sorge, denn sie wusste, dass die Lehrerin sie in wenigen Augenblicken hinausschicken würde.
»Dieses Jahr war die Brut besonders erfolgreich. Wir hatten neunhundertsiebenundachtzig Spinnenjunge. Bert war der Letzte, der schlüpfte.«
Edith riss die Augen auf. Wohnten da tatsächlich fast tausend Spinnen auf Miss Bittifuls Kopf? Kurz entschlossen warf sie das ganze halbe Sandwich. Es plumpste auf Miss Bittifuls Frisur, die sofort den Rücken durchstreckte.
»Hast du gerade … etwas auf mich geworfen?«, fauchte sie und starrte Edith an, die versuchte, möglichst ahnungslos und verblüfft dreinzublicken.
»Nein, natürlich nicht, Miss! Stimmt etwas nicht?«
Wieder kniff Miss Bittiful die Augen zusammen, hob die Hände und betastete das monströse Bauwerk auf ihrem Kopf. Das Sandwich war allerdings schon zwischen den grauen Strähnen verschwunden.
»Vielen Dank! Das wird eine ganze Weile reichen!«, sagte Bernard.
»Und danke, dass du uns geholfen hast. Wenn du bei dieser Lehrerin mal wieder Schwierigkeiten mit einem Test hast, lass es uns wissen!«, war Berts Stimmchen zu vernehmen.
Miss Bittiful hatte sich unterdessen vergewissert, dass mit ihrer scheußlichen Frisur alles in Ordnung war, und blickte Edith mürrisch an.
»Jetzt raus mit dir und Marsch in deinen Schlafsaal!«
Das ließ sich Edith nicht zweimal sagen. Sie machte einen kleinen Knicks, drehte sich um und stürmte zur Tür.
Sie konnte es kaum erwarten, ihrem Onkel das alles morgen nach ihrer Ankunft zu erzählen.
KAPITEL ZWEI
In dem Edith im Wald alte Freunde treffen will und dabei entdeckt, dass ihre Hilfe dringend gebraucht wird …
»Hallo! So sieht man sich wieder!«, sagte Edith fröhlich, als sie ins Taxi einstieg.
Der Taxifahrer strahlte übers ganze Gesicht, als er sie erkannte. Es war derselbe korpulente Mann mit dem rasierten Kopf, der Edith schon beim ersten Mal zum Waldhaus gefahren hatte.
»Hallo, junge Dame. So eine schöne Überraschung. Geht’s wieder zum gleichen Ziel? In den dunklen Wald, mitten im Nirgendwo?«
»Haargenau«, antwortete Edith und kicherte.
»Dann ist damals also alles gut gegangen? Ich meine – dein Onkel wohnt tatsächlich dort?«
»Leider nein. Als Sie mich das letzte Mal absetzten, wurde ich von Wölfen gejagt und musste mich den Sommer über auf einem Baum verstecken. Es ist ein Wunder, dass ich es überhaupt zum Schuljahr zurückgeschafft habe.«
Der Mann machte kurz große Augen, aber dann sah er Edith im Rückspiegel grinsen und musste lauthals lachen.
»Ich hatte mich das wirklich gefragt – und entschuldige bitte, dass ich dich damals in aller Eile verlassen habe. Das tut mir sehr leid.«
»Ist schon in Ordnung; Sie hatten mich am richtigen Ort abgesetzt, und mehr war nicht nötig«, erwiderte Edith und musste bei der Erinnerung an ihren ersten Besuch im Waldhaus schmunzeln.
»Du musst wissen, als die Anfrage kam, habe ich darum gebeten, die Schicht zu übernehmen. Eigentlich hätte ich heute frei, aber jetzt kenne ich alle Abkürzungen – ich dachte, das bin ich dir nach dem letzten Mal schuldig. Billiger und schneller – pass mal auf!«
Wie versprochen ging die Fahrt diesmal sehr viel schneller – einerseits weil der Taxifahrer den Weg kannte, aber auch, weil die beiden die ganze Zeit fröhlich palaverten. Ehe sich’s Edith versah, rumpelten sie schon den schmalen Waldweg hinunter, der sich bis ins Herz des New Forest hineinschlängelte. Edith wusste nun, dass ihr Fahrer Keith hieß und eine Tochter in ihrem Alter hatte, die sich brennend für Schmetterlinge interessierte.
Es war früh am Nachmittag, als Edith neben der großen Hecke am Ende der holprigen, staubigen Fahrspur aus dem Wagen stieg. Und als sich der Fahrer – diesmal sehr viel langsamer – wieder auf den Rückweg machte, rief sie ihm noch ein Danke hinterher und winkte.
Das Geäst der Bäume kam ihr um diese Jahreszeit viel weniger dicht vor. Sie betrachtete die kahlen Zweige, die für den Winter bereit schienen. Der Wald wirkte überhaupt nicht mehr Furcht einflößend oder unheilvoll. Er war nun eher wie … ein Zuhause – ja, die Bäume schienen sie wie eine alte Freundin willkommen zu heißen.
Und irgendwie machte sich bei Edith so etwas wie Gelassenheit breit. Sie sog die reine Luft ein, atmete mehrere Male tief durch und genoss den Gegensatz zu den Auspuffgasen der Großstadt. Die Klausur hatte sie auch bestanden – die garstigen Lehrerinnen hatten nicht die Oberhand behalten. Anita war außer sich vor Freude gewesen. Ihre Note – eine glatte Eins – hatten ihr Miss Bittiful und Madame Montefiore kurz vor der Abreise persönlich mitgeteilt, und als Edith dann zur Tür hinausging, hatten die beiden ihr fassungslos und voller Argwohn nachgestarrt.
Mit einem Grinsen – und in stillem Dank an die Spinnenfamilie in Miss Bittifuls gehaltvoller Kunstfrisur – suchte Edith die Hecke nach dem verborgenen Durchschlupf ab und lachte, als sie das unter Ranken verborgene Törchen entdeckte. Sogleich schlüpfte sie hindurch, zog dabei den Rucksack hinter sich her und schnaufte mehr rennend als gehend den gewundenen Pfad zu dem Haus hinauf, das für sie zu einem der Lieblingsorte auf der ganzen Welt geworden war.
Als es in Sicht kam, hatte sie kurz einen Kloß im Hals. Schon beim bloßen Anblick fühlte sie sich geborgen und willkommen. Eine feine Rauchsäule stieg aus dem kleinen Schornstein, der aus dem buckeligen Reetdach ragte;



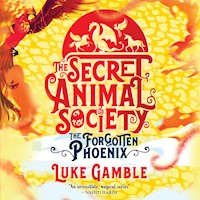
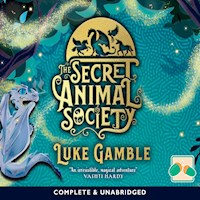











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












