
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Gesellschaft der geheimen Tiere
- Sprache: Deutsch
Der Tierarzt, dem Einhörner und Drachen vertrauen … Als Edies Eltern sie für die Ferien nicht vom Internat abholen, schickt man sie zu ihrem seltsamen Onkel. Der ist Tierarzt und betreibt seine Praxis in einem abgelegenen Teil eines großen Waldes. Schnell wird Edie klar, dass die Tiere, die ihr Onkel behandelt, außergewöhnlich sind: Es sind nämlich mythische Tiere. Zu seinen Patienten gehören unter anderem ein Pegasus und Einhörner. Und das ist nicht die einzige Überraschung: Edie stellt fest, dass sie mit Tieren telepathisch kommunizieren kann. Mit dieser seltenen Gabe ist sie für ihren Onkel von unschätzbarem Wert. Als ein Hilferuf aus dem Himalaya sie erreicht – wo eine Yeti-Familie an einer mysteriösen Krankheit leidet –, machen sich die beiden auf eine abenteuerliche Rettungsaktion …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Luke Gamble
Aus dem Englischen von Friedrich Pflüger
Für Gabriel und alle unsere pelzigen, gefiederten und beschuppten Familienmitglieder aus Vergangenheit und Gegenwart!
KAPITEL EINS
In dem die unerschütterliche Edith eine außergewöhnliche Nachricht erhält und sich darauf einstellen muss, dass sich ihr Leben möglicherweise völlig verändern wird, und auch ihre Sommerferien …
Die Säle der St.-Montefiore-Mädchenschule hätten jedem Mädchen Schrecken eingejagt. Auf dem Schulhof stand eine große Bronzebüste von Margot Montefiore, die diese Schule vor vielen Jahrhunderten gegründet hatte. An den Wänden hingen Hunderte von Gemälden – und von allen blickte Margot Montefiore herab. Manchmal starrte sie geradezu. Manchmal funkelte sie wütend. Aber immer hatte sie den Zeigefinger erhoben, als wolle sie mit ihrem stahlharten Blick jedes einzelne Mädchen zurechtweisen, das vorbeikam.
In dem Ölbild vor dem Büro der Schulleiterin war ihr Gesicht eine geradezu grauenvolle Grimasse – und ein Mädchen, das hier saß, musste Anlass zu einer fürchterlichen Strafpredigt gegeben haben.
Das dachte zumindest Edith Wight.
Edith saß schon seit Stunden hier, während sich ringsumher die Schule leerte, weil die Schülerinnen in die Sommerferien fuhren. Edith saß auf der Kante einer harten Holzbank im düsteren, fensterlosen Korridor, das blonde Haar nach Schulordnung zu einem schmerzhaft straffen Pferdeschwanz zusammengebunden, und sie blickte hinauf zur Uhr neben Madam Montefiores furchterregend starrenden, stechend blauen Augen. Da hing sie, etwas schief und mit einem großen, bleichen Zifferblatt, das zwei spindeldürre schwarze Zeiger umrahmte. Edith blickte beschwörend auf die Zeiger, aber die Zeit verging unerträglich langsam.
Von der Eingangshalle her schallte für einen Moment Gelächter durch das alte Gebäude – ein weiteres Mädchen wurde abgeholt. Es brach abrupt ab, als der Knall der schweren Eingangstür wie zur Bekräftigung der Endgültigkeit nachklang. Das war’s: Die letzten Schülerinnen waren in die Sommerferien gegangen.
Nun, fast die letzten.
Edith seufzte und verdrehte die Augen. Sie hoffte, ein Telefon würde klingeln. Sie hoffte, jemand würde ihr sagen, dass alles in Ordnung war, dass ihre Eltern doch kommen würden.
Sie konnten es nicht vergessen haben – nicht zweimal in einem Jahr.
Plötzlich raschelte es, und Edith riss den Kopf nach rechts. Es dauerte einen Augenblick, bis sie im fahlen Licht etwas erkennen konnte, aber dann entdeckte sie einen kleinen Schatten, der an der Fußleiste entlanghuschte. Es war ein Mäuschen, und es schien in Panik zu sein, denn es lief erst in die eine, dann in die andere Richtung. Edith beobachtete das Tier und fragte sich, warum es so aufgeregt war. Dann bemerkte sie, dass jemand eine große Kiste an der Wand abgestellt hatte. Die versperrte wohl den Weg zu dem Ort, wo die Maus hinwollte. Sie war aus ihrem Haus ausgesperrt.
Edith biss sich auf die Lippe. Wenn die Lehrerinnen sie dabei erwischten, wie sie von der Bank aufstand, dann konnte sie sich auf etwas gefasst machen – das Schulmotto in St. Montefiore war GEHORSAMKEIT ZÄHLT, aber die Maus konnte die Kiste unmöglich zur Seite schieben. Aber wenn jemand sie sah, dann war es um sie geschehen.
Edith entschied sich. Sie stieß sich von der Bank ab und schnellte hoch.
»Edith Wight! Was fällt dir ein?«, hallte es laut zwischen den Korridorwänden.
Edith blickte auf und sah am Ende des Gangs die knochige Gestalt von Madam Entwhistle, ihrer Französischlehrerin, aufragen.
Edith war nicht die Einzige, die es gehört hatte. Auch die Stimmen im Büro der Schulleiterin waren unversehens verstummt.
Irgendwas ließ Edith gegen das Gehorchen aufbegehren, und sie stürmte zu der Kiste und stieß sie mit voller Wucht an, sodass sie sich von der Wand wegdrehte.
»Edith Wight! SETZDICHSOFORT zurück auf die Bank!«
Madam Entwhistles Schritte klangen genauso wütend wie ihre Stimme.
Edith blickte nach unten. Die Kiste war in die Mitte des Gangs gerutscht, und die Maus war schon auf dem Weg zu ihrer Zuflucht. Gerade verschwand sie mit einem leisen Piepsen.
»Edith Wight!«
Madam Entwhistle war schon fast bei ihr. Edith wandte den Kopf. Die Tür zum Büro der Schulleiterin ging auf, und dann …
Dann schien die Welt vor weiß glühendem Licht zu explodieren.
Der Schmerz schoss Edith so jäh in den Kopf, dass sie beide Hände auf die Schläfen presste. Sie kniff die Augen zu, beugte sich tief nach unten und taumelte zurück, als hätte sie einen Schlag ins Gesicht erhalten.
Als der Schmerz allmählich nachließ, sank Edith heftig keuchend zu Boden. Ihr lief Schweiß übers Gesicht.
»Edith Wight!«, donnerte Madam Entwhistle. »Dein Betragen raubt einem den Verstand. Setz dich sofort wieder auf diese Bank!«
»Sie hatte wieder einen Anfall, Madam Entwhistle«, war durch die geöffnete Tür eine Stimme zu hören, die noch mehr Respekt einflößte. »Lassen Sie ihr ein bisschen Freiraum. Ich werde mich darum kümmern.«
»Wie Sie wünschen, Frau Schulleiterin.«
Edith konnte wahrnehmen, dass sich Madam Entwhistles Schritte entfernten und dafür andere Schritte näherten.
»Mein Kind, ist alles in Ordnung?«
Edith schlug die Augen auf und war auf ein neuerliches Einsetzen der Schmerzen gefasst. Aber nichts geschah. Sie nickte der Schulleiterin zu und kam wieder auf die Beine.
»Komm in mein Büro, Edith Wight. Wir müssen etwas besprechen.«
Das Arbeitszimmer der Schulleiterin war klein und quadratisch, und jeder einzelne Zentimeter der Wände war bedeckt mit noch mehr Porträts von Margot Montefiore. Die Frau auf den Gemälden sah der Schulleiterin, die Edith zu einem Stuhl mit Ledersitz und hoher Lehne führte, verblüffend ähnlich, und das war auch nicht weiter überraschend; die St.-Montefiore-Mädchenschule war von einer Generation an die nächste weitergegeben worden, und das schon seit ihrer Gründung.
Die Schulleiterin, ebenso mollig und rund wie ihre Ahnfrau, saß hinter ihrem alten Eichenschreibtisch und betrachtete das Mädchen, das vor ihr Platz genommen hatte. Edith war klein für ihre elf Jahre, und sie saß dort, die Hände ineinandergeklammert, und sah blass, dünn und erschöpft aus.
»Es tut mir leid, Frau Schulleiterin«, sagte sie leise, als sie wieder bei Sinnen war.
»Edith«, sagte die Schulleiterin mit einem Anflug von Spott. »Mein Kind, offenbar hattest du wieder einen deiner … Vorfälle. Ich muss mit dir aber über deine Eltern sprechen.«
Nicht zum ersten Mal fragte sich Edith, ob sich die Schulleiterin wirklich Sorgen wegen Ediths Zustand machte. Edith blickte erwartungsvoll auf.
»Haben sie es wieder vergessen?«, fragte sie. Die Enttäuschung schmeckte säuerlich auf ihrer Zunge.
»Diesmal nicht.« Die Schulleiterin hielt für einen Moment genüsslich inne. »Deine Mutter und dein Vater werden dich heute nicht abholen kommen, und auch nicht an einem anderen Tag. Sie werden vermisst.«
Vermisst. So ein einfaches Wort und doch so beunruhigend. Ediths Blick schoss bald hierhin, bald dorthin, als hätten sich ihre Eltern unterm Schreibtisch der Schulleiterin versteckt. Plötzlich kam es ihr unsagbar lange vor, dass sie die beiden zum letzten Mal gesehen hatte.
»Wo sind sie denn, Frau Schulleiterin?«
»Nun, wenn man das wüsste, dann wären sie nicht vermisst, nicht wahr, junge Dame?« Die Schulleiterin lächelte. »Das ist nicht wie nach dem ersten Halbjahr. Da hatten sie sich einfach im Datum geirrt – aber wenn man so ein hektisches Leben führt wie deine Eltern und auf der ganzen Welt unterwegs ist, dann kann man schon mal ein kleines Mädchen vergessen, das man auf der anderen Seite des Globus zurückgelassen hat. Wonach suchen sie eigentlich diesmal? Baumfrösche? Seltene Schmetterlinge?«
»Fliegen, Frau Schulleiterin.«
»Wie?«
»Sie erforschen Schmeißfliegen. Das ist das Spezialgebiet meiner Mutter.«
»Die Schulleiterin quittierte das mit einem angewiderten Blick. »Ich nehme an, dass manche Leute Fliegen tatsächlich interessant finden, aber was das für Leute sein sollen, das weiß der Himmel – aber wenn ich nur daran denke, dass sie dich hier zurückgelassen haben und auf der Suche nach Schmeißfliegen in der Welt herumziehen …!«
»Meine Mutter sagt, die Insekten werden den Planeten retten«, erwiderte Edith kleinlaut, aber keineswegs eingeschüchtert. »Ohne Insekten gäbe es gar kein anderes Leben auf der Erde.«
»Nun, was immer deine Eltern vorhaben, wir haben nichts von ihnen gehört und auch sonst niemand. Diese Expedition scheint ja in noch entlegenere Gebiete geführt zu haben als sonst. Es heißt, Hochwasser hätte ihren Rückweg versperrt, und jetzt sitzen sie im Urwald am Amazonas fest.«
Am Amazonas. Ihre Eltern waren schon einmal dort gewesen. Nirgends gab es so viel zu erforschen wie im Amazonasgebiet. Dort gab es noch immer Gegenden, wo unbekannte, noch nicht von Forschern entdeckte Tiere hausten.
Ediths Eltern hatten sich an der Universität von Cambridge beim Studium der Naturwissenschaften kennengelernt. Von da an waren sie auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Sie hatten mehrere Sommer in der Sahara verbracht und Wüstenigel und Springmäuse erforscht. Sie hatten auf einer Insel in der Antarktis überwintert und das Leben von Pinguinen und Seeleoparden dokumentiert. Sie waren sogar am Grund des Ozeans gewesen und hatten Aufnahmen der seltsamen unförmigen Quallen gemacht, die dort leben. Solange Edith klein war gewesen war, hatten sie mit ihren Reisen für eine Weile pausiert und gemeinsam in der Wohnung mit Blick auf den Londoner Stadtpark Kensington Gardens gewohnt, aber als Edith alt genug fürs Internat wurde, waren sie wieder aufgebrochen. Edith war normalerweise begeistert, wann immer sie Briefe und Postkarten aus entfernten Orten wie der Mongolei oder den Salomon-Inseln bekam, aus dem Yosemite Valley oder den Fjorden Islands, heute allerdings war ihre Begeisterung deutlich gedämpft. Sofort musste Edith an die Maus denken, die verzweifelt versucht hatte, in ihr Loch zurückzukommen.
»Weiß denn niemand, wo sie sind?« Seit jeher hatte sie versucht, sich vor den Lehrerinnen an der St.-Montefiore-Mädchenschule keine Furcht anmerken zu lassen. Die liebten es nämlich, wenn man sich ängstlich zeigte. »Sind sie denn noch am Leben?«, fragte sie leise.
»Hier«, sagte die Schulleiterin. Sie nahm einen Brief vom mächtigen Schreibtisch und warf ihn Edith in den Schoß. »Jetzt weißt du ebenso viel wie wir. Offenbar haben die offiziellen Stellen in Peru vor einer Woche zum letzten Mal Funkkontakt mit ihnen gehabt, als sie eine Warnung vor starken Regenfällen durchgaben. Aber inzwischen sind die Flüsse über die Ufer getreten, und überall steigen die Pegel. Nun, wenn man ständig weiß Gott wohin reisen muss, landet man früher oder später auf der Nase. Es ist ihre eigene Schuld, wenn du mich fragst.«
Edith musste an sich halten, um nicht laut zu erwidern: »Ich habe Sie aber nicht gefragt!«, und sagte stattdessen: »Sucht denn irgendjemand nach ihnen?«
»Lies selbst«, antwortete die Schulleiterin abweisend. »Es ist noch eine andere Expedition, das Syndikat, in der Region unterwegs. Auch diese ist verschollen. Der einzige Unterschied scheint zu sein, dass dieses Syndikat kein lästiges kleines Mädchen zurückgelassen hat, dessen Schulleiterin jetzt irgendeinen Platz finden muss, wo das Kind über den Sommer bleiben kann.« Die Schulleiterin schüttelte theatralisch den Kopf.
»Aber wo soll ich denn hin?«, fragte Edith, und ihrer Stimme war nun die Verzweiflung anzumerken.
Die Schulleiterin zog eine kleine Karte hervor.
»Deine Kontaktadresse für den Notfall. Alle Eltern müssen eine angeben. Für den Fall, na, du weißt, dass sie von einem Krokodil gefressen werden, im Sturm über Bord gehen oder im Dschungel verloren gehen.«
Edith lief es eiskalt über den Rücken, während sie die Karte ansah, die sie in die Hand gedrückt bekam.
PILGRIMS TIERKLINIK
WALDHAUS
OGDEN’S COPSE
NEW FOREST-NATIONALPARK
Ein Zufluchtsort für die Wunder der Natur!
Edith starrte lange Zeit auf die Schrift.
»Ich … ich … ich bin mir nicht sicher, wer …«
Die Schulleiterin riss entsetzt die Augen auf. Dann stieß sie erleichtert einen leisen Seufzer aus.
»Puh … für einen Moment dachte ich, du würdest wieder einen Anfall bekommen, Edith Wight! Außerdem muss ich rechtzeitig am Flughafen sein. Also, wie es scheint, ist es ein Onkel von dir, der diese Pilgrims Tierklinik leitet. Seine verstorbene Frau scheint die Schwester deiner Mutter gewesen zu sein, oder so etwas in der Art. Aber was immer er für dich ist, er wird diesen Sommer dein Pfleger sein.«
Pfleger? Für einen Tierarzt passte das Wort perfekt – aber nicht, wenn es um ein gesundes Kind ging.
Edith überlegte. Sie war verstummt. Außer mit ihren Eltern und ihrer Großmutter hatte sie nie mit jemand anderem in der Familie Kontakt gehabt. Sie war sich nicht einmal sicher, ob ihr Onkel überhaupt wusste, dass es sie gab. Ihre Mutter hatte nie auch nur mit einem Wort erwähnt, dass sie eine Schwester gehabt hatte!
»Ich kenne ihn nicht. Meine Eltern haben nie von ihm gesprochen. Und von einer Tante auch nicht.«
»Wir konnten jemanden unter dieser Adresse erreichen«, fuhr die Schulleiterin fort, »und die Situation erklären. Mit deinem Onkel haben wir allerdings nicht gesprochen. Wie ich es verstehe, war er selbst auf irgendeiner Expedition. Scheint ein Wesenszug in deiner Familie zu sein, dass keiner Zeit für dich hat. Seine Haushälterin machte allerdings einen einigermaßen vernünftigen Eindruck.« Sie stand auf. »Ich bin sicher, das wird sich alles finden. Also, wenn es dir nichts ausmacht …«
Edith sah zu, wie die Schulleiterin einen Koffer und einen Sonnenschirm hinter dem Schreibtisch hervorholte.
»Tick, tick!«, sagte sie und trieb Edith mit dem Sonnenschirm vor sich her bis zur Tür. »Ach, und mach dir keine Sorgen …« – sie griff rasch in eine Schreibtischschublade und drückte Edith einen dicken Umschlag in die Hand –, »dein Schulkonto ist mit den zusätzlichen Kosten belastet worden. Die müssen vor Beginn des neuen Schuljahres beglichen werden.«
Edith stand allein draußen im Korridor und lauschte dem Klicken der Absätze der Schulleiterin, die ab sofort auf dem Weg in den Urlaub an der Costa del Sol war. Viele Gedanken gingen ihr im Kopf herum. Ihre Eltern – bei steigendem Hochwasser verschollen in einem fernen Dschungel. Und sie selbst hatte den ganzen Sommer vor sich – und sollte ihn bei einem Mann verbringen, den sie nicht kannte. Und …
Ihr Blick ging nach unten. Das kleine Loch in der Wand lag immer noch frei, und die Maus streckte ihre kleine Schnauze mit den Schnurrhaaren heraus. Sie piepste einmal, und eine weitere Schockwelle lief durch Ediths Gedanken – aber diesmal fiel sie nicht in Ohnmacht.
Sie begriff, dass die Maus ihr viel Glück wünschte. Sie sagte »gute Reise«. Sie war sich nicht sicher, warum sie das wusste, aber es war einfach in ihrem Kopf, klar wie der helle Tag.
Und als Edith davontrottete, war sie dankbar dafür.
Ab jetzt würde sie alles erdenkliche Glück brauchen.
KAPITEL ZWEI
In dem Edith mitten im Nirgendwo zurückgelassen wird und einen dornigen Pfad einschlägt, der geradewegs in ihre Zukunft führt …
Edith schreckte aus dem Schlaf hoch. Irgendwie hatte sie wahrgenommen, wie das Taxi von der Hauptstraße auf eine holprige Fahrspur abbog, aber das war ewig her. Jetzt stand der Wagen still, der Motor im Leerlauf.
»Da wären wir«, sagte der Fahrer, ein bulliger Mann mit rasiertem Schädel und abweisendem Auftreten, der trotz seiner rauen Schale irgendwie aufgewühlt klang.
Edith rieb sich die Augen und blickte zur Scheibe hinaus. Es dämmerte bereits, bald würde es dunkel sein, und zu ihrer Beunruhigung war nicht das Geringste von einem Haus oder auch nur einem Licht zu sehen.
»Ist das wirklich die Adresse hier?«, fragte sie. »Wir sind doch mitten im Wald!«
Daran war nicht zu zweifeln. Ringsum standen dicht an dicht Bäume. Ihre schwer mit Blättern behangenen Äste wölbten sich wie ein schattiger Tunnel über das Taxi. Und es wurde ringsumher immer dunkler.
Der Fahrer spähte durch die Windschutzscheibe. Im Scheinwerferlicht war neben der Fahrspur an einem nachlässig in den Boden gerammten Pflock ein schiefes Schild zu erkennen.
»Auf dem Schild steht, dass hier das Waldhaus ist.« Er deutete mit dem Finger nach vorn.
Edith runzelte die Stirn und lehnte sich vor, um das Schild zu sehen. Es war gerade so zu erkennen, dass dort in großen schwarzen Buchstaben WALDHAUS geschrieben stand, mehr aber auch nicht. Von einem Gebäude, einem Weg oder einer Einfahrt war nichts zu sehen.
»Wir sind diesem Fahrweg eine Ewigkeit gefolgt«, sagte der Fahrer. »Ich dachte, wir würden zu einem Dorf oder so etwas kommen, dass der Weg weitergeht, aber die Spur endet hier. Aber schau hier.« Er tippte auf das Navi in der Armaturentafel und zuckte mit den Schultern. »Das Ding kann sich nicht irren. Genau hier wollte deine Schulleiterin, dass ich dich absetze.«
Edith drückte das Gesicht an die Scheibe. Das konnte unmöglich der richtige Ort sein. Aber der Taxifahrer war schon ausgestiegen, hob ihren Rucksack aus dem Kofferraum und öffnete Ediths Tür. Sie blickte nervös um sich, während sie aus dem Wagen stieg. Ringsum ragten Bäume bedrohlich in die Höhe, und während sie mit ihrer schicken zerrissenen Jeans und einem Paar rosafarbenen Glitzerturnschuhen am Rand der Fahrspur stand, wurde ihr klar, dass sie eher für eine Tour ins Einkaufzentrum in der Stadt ausgerüstet war als für einen uralten Wald. Dabei waren das nicht mal ihre eigenen Klamotten; ihre beste Freundin Anita hatte sie ihr über die Ferien geliehen, weil sie nicht alles nach Hause zu ihren Eltern in Indien hatte mitnehmen können. Edith war mit einem Mal völlig unsicher. Eigentlich hatte sie einen guten Eindruck auf ihren Onkel machen wollen, aber nun kam sie sich ziemlich lächerlich vor.
»Irgendwie komisch hier«, sagte der Fahrer, als er ihr den Rucksack vor die Füße stellte und wieder zur Fahrertür ging. »Ich würde mich an deiner Stelle nicht allzu lang hier draußen herumtreiben.« Als Edith keine Antwort gab, räusperte sich der Fahrer und streckte die Hand vor. »Tut mir leid, dass es so viel kostet, Kleine, aber hier sagen sich wirklich Fuchs und Hase Gute Nacht, und ich muss weiter. Bist du dir denn sicher, dass du hierbleiben willst? Tiefer kann man wohl nicht in den New Forest hinein, bevor’s wieder hinausgeht, und ganz geheuer ist es mir hier nicht. Gibt ja ’ne Menge Geschichten über diesen alten Wald …«
Edith war etwas gedankenverloren und gleichzeitig überwältigt von den Fratzen, die sie aus der knorrigen Rinde der Bäume anzustarren schienen, und hatte deshalb völlig vergessen, dass sie den Taxifahrer noch bezahlen musste. Sie bückte sich, öffnete rasch den Reißverschluss vom obersten Fach ihres Rucksacks und zog das Kuvert heraus, dass die Schulleiterin ihr gegeben hatte. Verlegen drehte sie sich wieder zum Taxi um.
»Entschuldigung«, sagte sie und errötete. »Was schulde ich Ihnen?«
Der Taxifahrer warf einen Blick auf den Taxameter auf dem Armaturenbrett, wo eine Reihe großer roter Zahlen leuchtete. »Tut mir leid, Kleine, aber mein Boss reißt mir die Gedärme raus, wenn ich dir am Preis was nachlasse.«
Edith zog das Geld aus dem Umschlag, blätterte die Scheine durch, reichte dem Taxifahrer dann aber den ganzen Inhalt.
»Hier, da hast du meine Karte«, antwortete er und stieg wieder in den Wagen. »Falls du hier festsitzt, ruf mich an.«
Er sah besorgt aus. Das waren leere Worte, und sie wussten das beide. Edith konnte es in seinen Augen lesen, die nervös zu den Schatten hinüberjagten, und daraus, wie er zusammenzuckte, wenn einer der riesigen Äste des grünen Tunnels in der Dämmerung auch nur leise erschauerte; der Taxifahrer konnte es kaum erwarten, aus diesem Wald herauszukommen.
»Es wird bestimmt alles in Ordnung sein«, flüsterte Edith – aber wenn der Taxifahrer auch nur halb hingehört hätte, dann wäre ihm nicht entgangen, wie ihre Stimme dabei gezittert hatte. »Meine Schulleiterin hat mit der Haushälterin meines Onkels gesprochen. Er erwartet mich.«
»Scheint ein seltsamer Kauz zu sein, wenn er hier im Wald haust, wenn du mich fragst.«
Der Motor des Taxis erwachte wieder zum Leben. »Du hast meine Nummer. Ruf mich an, falls …«
Aber das Taxi war weg, bevor sie den Rest des Satzes gehört hatte. Nun war Edith allein im großen, wilden Wald, und hinter den Ästen der gewaltigen Bäume schwand das wenige Licht, das noch da war.
Während die roten Rücklichter des Taxis, auf der holprigen Spur tanzend, in der Ferne verschwanden, warf Edith einen Blick auf die Visitenkarte des Taxifahrers, knüllte sie in der Hand zu einer Kugel zusammen und stopfte sie in die Hosentasche.
Die würde ihr nichts nutzen.
Sie hatte ja nicht einmal ein Handy.
Nach einer Weile zog sie das obere Fach des Rucksacks wieder zu und atmete tief durch. Sich aufzuregen half jetzt auch nicht, sagte sie sich und ließ sich allmählich auf die Stille ein, die sie umgab. Niemand würde kommen, um ihr zu helfen. Geholfen hatte ihr keiner, seit sie vor dem Büro der Schulleiterin Platz genommen hatte. Sie musste jetzt die Zähne zusammenbeißen und die Sache durchstehen.
Edith war zum ersten Mal alleine weg aus London. Die Stille war beinahe ohrenbetäubend. Sie konnte sich gar nicht erinnern, irgendwann einmal kein einziges Motorengeräusch, keine Hupe gehört zu haben. Hier mitten im New Forest, umgeben von nichts als Bäumen und mit keinem Gebäude in Sicht, hätte sie sich kaum mehr fehl am Platz gefühlt, als wenn sie auf dem Mond gestanden wäre.
Und doch … war es gar nicht vollkommen still – wenn man genau hinhörte. Irgendetwas raschelte im trockenen Laub. Oben in den Bäumen huschten Vögel herum auf der Suche nach dem besten Schlafplatz für die Nacht. Für Edith klang es wie ein Chor aus tausend – nein, einer ganzen Million – Stimmen. Man musste nur lauschen.
Gedankenverloren rieb sie sich die Schläfen und hoffte, dass sie nicht wieder von Kopfschmerzen überfallen würde. Sie konnte das Summen spüren, seit sie aus dem Taxi ausgestiegen war, und sie versuchte, es auszublenden. Es war wie ein ständiges Sirren gleich hinter ihren Augen. Und immer war es besonders schlimm, wenn sie an einem neuen Ort war. Auch die Tonhöhe schien sich zu verändern, wenn ihr die Umgebung nicht vertraut war, und dann war es umso schwieriger zu verdrängen.
Das war einer der Gründe, weshalb sie selten irgendwohin ging und die Lehrerinnen sie nicht gern auf Ausflüge mitnahmen – insbesondere, weil die Ärzte keine rechte Erklärung für das Phänomen hatten finden können. Allzu oft betrachteten die Leute sie als eine Art Zeitbombe mit einem Countdown bis zum nächsten »Vorfall«.
Edith ging hinüber zum schiefen Hinweisschild und fuhr mit dem Zeigefinger das Wort WALDHAUS nach. Die Buchstaben wirkten irgendwie frisch auf der verwitterten Holztafel. Und was sie dahinter für einen weiteren Teil des Waldes gehalten hatte, war in Wirklichkeit eine hohe Weißdorn- und Ligusterhecke. Kaum hatte sie das erkannt, fiel ihr zwischen den belaubten Ästen auch schon ein kleines Holztörchen ins Auge.
Nichts an der ganzen Reise zum Haus ihres Onkels war einfach gewesen. Kein Bus fuhr dorthin, wo er wohnte; das Haus war meilenweit von der Hauptstraße entfernt, und selbst vom Zufahrtsweg hier war praktisch nichts zu sehen. Warum war der Eingang nur so versteckt? Besaß ihr Onkel überhaupt ein Auto? Wenn ja, dachte Edith, dann musste es eins von denen sein, die fliegen können, denn durch das winzige Tor würde es niemals passen.
Sie kämpfte sich durchs Geäst vor, zerrte den Rucksack durch die schmale Lücke und liftete ihn schließlich auf ihre Schultern. In diesem Augenblick flog eine kleine Motte vom Tor auf, und ihre Flügel schimmerten im Dämmerlicht. Ganz dicht vor Ediths Gesicht flatterte sie vorüber. Ihr Mund kräuselte sich zu einem Lächeln, und dann spürte sie einen stechenden Schmerz hinter der Stirn. Sie kniff die Augen zu und holte tief Luft, und allmählich ließ der Schmerz nach. Als sie die Augen wieder öffnete, war die Motte fort. Sie musste das Tier erschreckt haben.
Edith sah auf. Der schmale Moosweg, dem sie folgte, wand sich leicht ansteigend durchs Gebüsch. Bis jetzt war vom Haus nichts zu sehen außer diesem zugewachsenen Pfad, der sich immer weiter ins Ungewisse schlängelte.
Und mit jeder Sekunde wurde es dunkler.
Edith versuchte, den dumpfen Kopfschmerz abzuschütteln, und arbeitete sich weiter vorwärts. Seit jeher war sie zäh gewesen und mit vielem fertiggeworden – aber das musste man auch, wenn man die meiste Zeit alleine verbrachte. Sie hatte ein »beherztes Wesen« – das hatte zumindest ihr Vater behauptet vor ein paar Jahren. Und das wurde jetzt auf die Probe gestellt, keine Frage.
Eine Brombeerranke traf sie wie ein Peitschenschlag. Dann huschte etwas Dunkles, Pelziges vor ihr über den Weg, streifte ihren Fuß und ergriff mit schrillem Quieken die Flucht. Mehr als einmal dachte sie daran umzukehren – aber dort erwartete sie nur die verlassene Fahrspur mit den Reifenabdrücken, die der Fahrer mit seinem Taxi hinterlassen hatte, und die hereinbrechende Nacht.
Nein, es blieb ihr nichts anderes übrig, als weiterzugehen.
Eigentlich hatte sie schon die Hoffnung aufgegeben, das Haus zu finden, als seltsame Geräusche zu hören waren.
Zuerst ein Krachen. Dann rief jemand. Und zuletzt lautes Schnauben. Und dann ging es wieder von vorn los, fast wie ein Rhythmus, und Edith zog es vor Angst den Magen zusammen.
Krach!
»Nein!«, dröhnte eine tiefe Stimme.
Schnaub!
»Nein!«, wurde wieder gerufen.
Krach!
»Hör mir zu. Der Doc sagt, dass es dir damit gleich besser geht!«
Schnaub!
Edith erwartete das nächste Krachen – aber diesmal kam nichts.
»So ist es besser«, hörte sie sagen. »Guter Junge. Das wird dem Doc gefallen. Da hast du uns beiden einen Gefallen getan!«
Schnaub!
Edith bekam große Zweifel, aber dann atmete sie tief durch, nahm ihren Mut zusammen und pflügte weiter durchs Gestrüpp voran. Und dann brach sie unversehens aus dem Dickicht und stolperte hinaus auf eine große Lichtung. Überrascht über die unerwartete Weite blieb sie stehen und starrte verwundert auf das Bild, das sich ihr bot.
Zunächst war da ein malerisches altes reetgedecktes Häuschen, umgeben von einem makellos getrimmten Rasen, fast wie aus einem Märchen. Das Stroh auf dem Dach schmiegte sich um einen roten Backsteinkamin, aus dem weiße Rauchwölkchen in den Abendhimmel hinaufstiegen. Auf der anderen Seite der Lichtung stand eine riesige und offensichtlich schon vor langer Zeit gezimmerte Scheune mit Wänden aus verzogenen Holzbalken, die ein buckeliges, schiefergedecktes Dach trugen. Durch das große Doppeltor an der dem Haus zugewandten Giebelseite, das ein Stück weit offen stand, hätte ein Zweispänner bequem einfahren können.
In der Lücke zwischen den beiden Türflügeln sah Edith … Licht!
Offenbar kam das Getöse von dort. Und während Edith noch dastand, setzten sich die Türen in Bewegung. Eine riesige Hand tauchte auf, fasste die Tür an der Kante und schwang sie weiter auf.
Unwillkürlich machte Edith einen Schritt zurück und beobachtete, wie der größte Mann, den sie in ihrem ganzen bisherigen Leben gesehen hatte, aus der Scheune auftauchte. Im Zwielicht schimmerte sein markant geschnittenes Gesicht, ein wilder Schopf von leuchtend blondem Haar, kurz geschoren an den Seiten, von einem starken Lederband zu einem Pferdeschwanz gebändigt, der ihm über den breiten Rücken hinunterhing. Und mit den fein ziselierten Tätowierungen, die sich seine muskulösen Arme hinaufzogen, und dem geflochtenen Bart, der beim Gehen immerzu nach vorn zu stoßen schien, wirkte er wie ein leibhaftiger Wikingerhäuptling.
Und es wirkte ohne jeden Zweifel freundlich, wie das fahle Licht, das vom aufscheinenden Sternenhimmel auf die Lichtung herabfloss, in seinen Augen funkelte. Er trug eine abgetragene grüne Hose und über dem massiven Leib einen einfachen Kittel, der über den kräftigen Oberarmen sichtlich spannte. Edith sah, dass er in seiner freien Hand eine riesige Kanne hielt und diese nun mit einer kleinen Bewegung auf der Wiese ausschüttete, als wäre sie ein Fingerhut.
»Er glaubt, nur weil er groß ist, kann er sich alles erlauben«, murmelte der Mann mit tiefer, rauer Stimme.
Etwas befangen räusperte sich Edith leise, und der Mann sah überrascht auf. Für einen Moment blickten sich beide an, aber dann erschien ein breites Lächeln auf seinem Gesicht, und er stürmte auf sie zu.
»Du bist bestimmt Edie!«, rief er dröhnend. »Wir sind alle schon gespannt, dich kennenzulernen!«
Aber dann wurde Ediths Aufmerksamkeit von dem riesenhaften Mann vor ihr zu der Kreatur hingezogen, die halb in und halb vor der Scheune stand. Zunächst kam es ihr wie ein prachtvolles Pferd mit einem umwerfend schönen weißen Fell vor – aber es war größer als alle Pferde, die sie je gesehen hatte. Und da war noch etwas anderes. Flügel.
Pferde hatten keine Flügel.
Noch während sie diesen Gedanken dachte, entfaltete sich zu Ediths grenzenlosem Erstaunen am Rücken des Pferdes ein Paar majestätischer, von prächtigen weißen Federn bedeckter Flügel.
Das Tier schnaubte auf, und dann war Edith auch schon in seinem Blick gefangen.
Dieser dauerte kaum eine Millisekunde, denn ohne jede Vorwarnung flammte in Ediths Kopf ein stechender Schmerz auf. Ihre Hände schossen an ihre Schläfen. So heftig war es noch nie gewesen.
Tausend feurige Blitze bohrten sich in ihr Gehirn, und sie verdrehte vor Schmerzen die Augen.
»Hilfe!«, konnte sie gerade noch ausstoßen.
Es traf sich gut, dass der riesige Mann schon fast bei ihr war, denn in diesem Moment fiel sie in Ohnmacht, und sie spürte noch, wie er sie auffing, bevor sie zu Boden sank.
KAPITEL DREI
In dem Edith mitten in einer sehr ungewöhnlichen Familie aus zwei- und vierbeinigen Freunden aufwacht …
Der pfeifende Wasserkessel war das Erste, was Edith wahrnahm. Sie klappte energisch die Augen auf und zu und linste dann durch die halb geschlossenen Lider.
Sie zuckte zusammen, als das Bild scharf wurde – offenbar lag sie unter einem Fenster. Draußen war es vollkommen dunkel – aber sie wusste nicht, ob es noch derselbe Abend war. Ihr kamen der riesige Mann und das geflügelte Pferd in den Sinn. Bestimmt hatte sie sich das nur eingebildet, und ihre Gedanken hatten ihr bloß einen Streich gespielt.
Der warme Lichtschein im Raum stammte von einer einzelnen Lampe an der Decke. Die stechenden Kopfschmerzen hatten glücklicherweise nachgelassen, aber es summte laut in ihren Ohren, und sie schüttelte mehrmals vergeblich den Kopf, um das Geräusch loszuwerden. Sie seufzte resigniert.
Edith sah sich um und begriff, dass sie auf einem großen Sofa lag, offenbar im Haus. Ihr Kopf war auf ein tiefrubinrotes Kissen gebettet, und ihr Blick fiel in eine riesige Küche, die ihr sofort behaglich und sicher vorkam.
Überall türmten sich Bücher auf: in den Regalen, auf dem Küchentisch und auf dem Fußboden. Praktisch alle Oberflächen waren bedeckt mit bunten Stapeln von Karten, Zeitschriften und Zeitungen. Auf dem Sims über dem großen offenen Kamin stand ein einzelnes gerahmtes Foto. Dies war der einzige Ort, an dem keine Unordnung herrschte. Das Bild zeigte eine junge Frau mit einem hübschen Gesicht, blauen Augen, goldfarbenem Haar und einer Nase, die genauso geformt war wie Ediths eigene. Sie fragte sich, ob die Frau wohl entfernt mit ihr verwandt oder vielleicht sogar ihre Tante war.
Knarrend öffnete sich eine Tür. Edith drehte sich herum und sah eine ältere Dame hereinkommen. Hinter ihrer Hornbrille mit runden Gläsern funkelte es aus freundlichen Augen.
»Du meine Güte«, sagte sie mit einer Stimme, die leicht wie Federn klang. »Du hattest einen ganz schönen Schock. Der arme Francis wusste gar nicht, was er tun sollte. Das war furchtbar für ihn!«
Edith schluckte und wusste nicht, was sie sagen sollte.
»Na, geht’s dir wieder besser? Was macht der Kopf? Du bist wohl ziemlich unsanft gelandet, was?«
Edith brachte ein schwaches, dankbares Lächeln zustande, als die Dame ihr ein Glas mit kühlem Wasser reichte.
Während sie trank, schossen ihr zahllose Gedanken durch den Kopf – wo ihr Rucksack war, wann die Kopfschmerzen aufhören würden und was sie wirklich dort vor der Scheune gesehen hatte …
Die Worte der Frau holten sie in die Gegenwart zurück. »Ich vermute, du fragst dich, wo dein Onkel ist?«, sagte sie nun, auf dem Weg hinüber zum Waschbecken. »Aber mach dir keine Sorgen, Liebes, er wird zum Abendessen hier sein, er dreht nur noch die übliche Runde.«
»Wie lange habe ich denn geschlafen?«
»Oh, eine Stunde, vielleicht auch zwei. Das war ein ziemlicher Sturz!«
Eswar also noch derselbe Abend. Edith war froh, dass sie nicht allzu lange das Bewusstsein verloren hatte. Sie stützte sich auf dem Sofa hoch und sah zu, wie die Frau anfing, mit flinken Handbewegungen Kartoffeln zu schälen.
»Ich wusste gar nicht, dass mein Onkel hier lebt, oder …«, oderdass es ihn überhaupt gibt, dachte Edith bei sich, besann sich aber eines Besseren, bevor sie es laut aussprach. »Und dass er eine Haushälterin hat, weiß ich erst, seit die Schulleiterin sagte, dass sie bei Ihnen angerufen hat.«
Die Frau musste furchtbar lachen. »Der Gedanke, dein Onkel würde hier alleine leben! Haha! Schön wär’s! Keinen einzigen Tag würde er überleben ohne uns! Alles würde er vergessen – Frühstück, Mittag- und Abendessen –, so sehr beschäftigen ihn all seine ›Fälle‹. Ohne uns würde er auch noch seinen Kopf vergessen!« Sie überlegte. »Das soll natürlich nicht heißen, dein Onkel wäre nicht intelligent. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar die Bemerkung wagen, dass er der klügste Mann ist, dem ich je begegnet bin. Aber ein kluger Kopf und gesunder Menschenverstand, das ist zweierlei. Ich war einmal eine Woche lang krank, da hat er nichts als frische Äpfel aus dem Garten gegessen. Er hatte danach noch einen ganzen Monat Magenkrämpfe!«
Wieder lachte sie – aber da blickte Edith auch schon auf den riesigen braunen Hund, der ins Zimmer gestürmt kam. Beim Blick in seine bernsteinfarbenen Augen lief es Edith eiskalt über den Rücken, aber noch bevor sie überhaupt reagieren konnte, fuhr er ihr mit der Zunge wie mit einem Waschlappen übers Gesicht, und dann tauchte er sie auch gleich noch in ihr Wasserglas.
Edith quietschte vor Überraschung. Bislang hatte sie kaum mit Hunden zu tun gehabt, geschweige denn, dass einer, der fast so groß war wie sie selbst, sie abgeschleckt hätte.
»Oh, das ist Arnold. Der nimmt sich leider so einiges heraus, ganz egal, was man ihm sagt.«
Als Arnold merkte, dass von ihm die Rede war, fing er an, mit dem ganzen Körper zu wedeln. Aber obwohl es sich anfühlte, als würde der Druck in ihrem Kopf wieder stärker, streckte Edith die Hand aus und tätschelte ihn vorsichtig, worauf er sie mit seinen Lefzen weiter vollsabberte.
»Arnold, jetzt lass das arme Mädchen doch in Frieden!«, rief die Haushälterin, die mit den Kartoffeln fertig war und herüberkam, um den Hund wegzuzerren. »Also wirklich, dieser Hund hat überhaupt keine Manieren!«
Wie zur Antwort ließ sich Arnold seufzend vor dem Sofa nieder und legte Edith seinen großen Kopf auf den Schoß.
»Er mag dich! Du musst aber streng mit ihm sein, Liebes. Er kann ziemlich eigensinnig sein – genau wie alle anderen Bewohner in diesem Haus.«
»Zu welcher Hunderasse gehört er eigentlich?«, wollte Edith wissen und strich ihm wieder behutsam über den gewaltigen Kopf.
»Er ist bisschen dies, ein bisschen das. Vor allem Wolfshund, vermischt mit ein bisschen Deutscher Dogge, ein klein wenig Bernhardiner vielleicht, aber eine Spur Rhodesian Ridgeback ist auf alle Fälle auch mit dabei. Seine Vorfahren hat man möglicherweise bei der Löwenjagd eingesetzt, aber das Einzige, das Arnold hier jagt, ist alles, was ich in der Küche koche. Er ist wirklich eine Katastrophe. So ein Riesenkerl, aber wenn’s regnet, traut er sich nicht raus, und er fürchtet sich vor jedem lauten Knall. Also kurz gesagt, obwohl er furchterregend aussieht, ist er wirklich lieb, aber er ist ohne Frage der nutzloseste Hund, den ich je gesehen habe. Wir haben ihn jetzt ungefähr vier Jahre, glaube ich. Das war so eine Art Rettung, musst du wissen; seine vorigen Besitzer hatten nicht damit gerechnet, dass er so groß wird, und da hat ihn dein Onkel aufgenommen. So war das – und seitdem ist er hier!«
Jetzt wo sie mit den Kartoffeln fertig war, brachte die Frau zwei dampfende Teetassen zum Couchtisch und ließ sich in einem Lehnstuhl neben dem Sofa nieder.
»Trinke einen Schluck, Edie, Liebes. Ich darf dich doch Edie nennen, oder?« Edith nickte, und die freundliche Frau fuhr mit strahlender Miene fort: »Der Tee wird gegen den Schock helfen. Er ist aus besonderen Blättern aus einer entlegenen Region in Thailand. Dein Onkel hat ihn von einer Reise mitgebracht. Er wird sich ziemlich von dem unterscheiden, was du gewohnt bist, aber das gilt vermutlich für deinen ganzen Aufenthalt bei uns.«
Edith nahm die Tasse und blickte hinein. Es sah tatsächlich keinem Getränk ähnlich, das sie kannte. Der Tee hatte eine grünlichrosa Färbung, es gab keine Milch dazu, und in der Tasse ringelte sich eine Art blauer Strudel. Weil es sehr unhöflich gewesen wäre, den Tee abzulehnen, hob Edith ihn an die Lippen, pustete ein wenig darauf und nahm dann vorsichtig einen kleinen Schluck.
Fast im selben Moment breitete sich ein wunderbar warmes Gefühl in ihrem ganzen Körper aus, und auch das Summen in ihrem Kopf schien sich zu legen. Überrascht blickte sie die Haushälterin an, die sie nicht aus den Augen gelassen hatte.
»Köstlich, nicht wahr? Aber bevor wir jetzt die feineren Vorzüge des thailändischen Tees erörtern, sollten wir uns erst einmal ordentlich vorstellen. Mein Name«, verkündete sie, »ist Lady Elizabeth Beatrice Violet Thornfrulnaught …, aber weil ich Edie zu dir sagen darf, nennst du mich bitte einfach Betty! Sag gerne Du zu mir. Wie du festgestellt hast, bin ich die Haushälterin deines Onkels – aber angesichts der Unordnung hier fragst du dich bestimmt, was ich den lieben langen Tag so tue!«
»Überhaupt nicht«, sagte Edith rasch, eingedenk ihrer guten Manieren.
Betty kicherte und deutete mit der Hand vage auf das Chaos in der Küche. »Lieb, dass du das sagst, Kleines, aber du wirst das bald alles selbst sehen. Francis, der Mann, dem du schon begegnet bist, ist mein Sohn. Wissenschaftliche Arbeit war nie sein Ding, aber er ist gutherzig, zuverlässig und hilft mir mit den Tieren, für die wir sorgen.«
Um Bettys Augen bildeten sich vergnügte Fältchen, als sie Ediths Überraschung sah.
»Haha! Ich sehe schon, du wunderst dich, weil wir uns nicht ähnlich sehen, aber ich habe Francis adoptiert, musst du wissen. Es heißt, sein Vater sei ein berühmter isländischer Muskelmann gewesen. Du wirst ihn mögen, da bin ich mir sicher. Francis ist nicht nur sehr stark, er hat auch etwas an sich, das nervöse Tiere – und Menschen – beruhigt.«
Edith hielt es jetzt nicht mehr aus. Wo die Kühnheit herkam, konnte sie nicht sagen. Vielleicht war es der Tee mit der merkwürdigen Farbe, der ihr den nötigen Mut gespendet hatte. Sie setzte die Tasse ab und fragte: »Als ich Francis gesehen habe, kam ein … Tier aus der Scheune. Was war das?«
Betty zog die Augen zusammen. »Was hast du denn gesehen?«
Edith zögerte. »Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist alles ein bisschen unklar – und dann fingen auch wieder die Kopfschmerzen an und … ich dachte, es wäre eine Art Pferd, aber …«
»Aber natürlich! Was hätte es auch sonst sein sollen, Liebes?«
Edith biss sich auf die Zunge. Es kam ihr so unsinnig vor. Pferde hatten keine Flügel!
Sie schwieg offensichtlich zu lange, denn Betty beugte sich vor und berührte sie am Handrücken. »Keine Angst, Liebes. Du weißt doch, dein Onkel ist ein berühmter Tierarzt, nicht wahr? Das hier ist Pilgrims Tierklinik.«
Edith nickte, obwohl sie eigentlich gar nicht gewusst hatte, dass ihr Onkel berühmt war.
Genau genommen kannte sie ihn überhaupt nicht, aber aus irgendeinem Grund wollte sie damit nicht herausplatzen. Was, wenn Betty sie für eine Schwindlerin hielt? Wo sollte sie dann hin?
Betty bemerkte Ediths Unsicherheit und lächelte. »Er ist nicht auf die Art berühmt, wie du vielleicht denkst – er ist nicht im Fernsehen oder in den Zeitungen, aber in seinem Fach genießt er hohes Ansehen. Er ist auch kein normaler Tierarzt, auf keinen Fall, nicht im üblichen Sinn. Wir haben keine offene Sprechstunde und machen auch keine Termine mit Tierhaltern aus. Aber wir sorgen hier für Tiere aller Arten, und aus der ganzen Welt kommen Patienten, um seine Dienste in Anspruch zu nehmen, und das seit schon bald dreißig Jahren. Manche dieser Tiere sind überaus kostbar – man könnte sagen, sie sind seltene oder ungewöhnliche Wesen. Deshalb müssen wir hier unbedingt unter uns bleiben; sie könnten sonst bei den falschen Leuten Aufmerksamkeit erregen.«
Arnold hob den enormen Kopf und fing traurig zu winseln an. Betty beugte sich vor, kraulte ihm die Ohren, und er beruhigte sich wieder.
»Du meinst … jemand könnte versuchen, die Tiere zu stehlen?«
Arnold heulte erschrocken auf.
»Ja, mein Liebes«, antwortete Betty. »Manchmal geht es finster zu in der Welt. Aber vergiss nie die goldene Regel: Schatten gibt es nur, wo auch Licht ist! Aber das genau ist der Grund, weshalb wir hier leben. Und weshalb du uns noch nie besucht hast. Wir erlauben gewöhnlich keine Besuche, nicht einmal von Familienmitgliedern. Nicht, dass wir Gäste nicht mögen – aber es ist einfach zu riskant. Wenn die Öffentlichkeit von unserer Arbeit Wind bekommt, taucht hier wer weiß wer auf und stört unsere Patienten. Nur wenn man sehr genau weiß, wo man hinmuss, kann man uns finden.«
»Und was ist mit dem Schild?«, flüsterte Edith.
»Ach, das haben wir nur für dich aufgestellt, Liebes. Francis hat es bestimmt schon wieder abgenommen. Wir passen wirklich gut auf, dass wir unter uns bleiben.« Sie blickte nachdenklich drein. »Aber deine Schulleiterin hat mir ein bisschen die Lage geschildert – sie sagte, deine Eltern würden irgendwo im Hochwassergebiet feststecken?«
»Sie sind am Amazonas«, antwortete Edith. »Und zu einer anderen Expedition in der Region – dem Syndikat oder so – ist offenbar ebenfalls der Kontakt abgerissen. Das ist alles, was ich weiß.«
Bettys Gesicht hatte kaum merklich gezuckt. »Syndikat, sagst du?«
Ediths Rucksack lag auf dem Boden. Sie musste Arnolds gewaltigen Schädel beiseiteschieben, um an ihn heranzukommen. Sie zog den Brief aus der Deckeltasche und reichte ihn Betty, die durch die dicken Brillengläser linste und ihn aufmerksam durchlas.
Betty schwieg, so schien es jedenfalls Edith, aus großer Sorge.
»Was ist ein Syndikat?«, fragte Edith schließlich.
Betty legte den Brief weg: »Das ist eine Gruppe von Leuten mit einem gemeinsamen Interesse.« Ihre Stimme klang dabei sehr gemessen, fast vorsichtig.
Edith wollte Betty gerade fragen, was sie von dem Brief hielt, als irgendetwas ohrenbetäubend laut aufkreischte, gefolgt von einem Krachen. Edith schoss vom Sofa hoch, und Betty sprang geradezu aus ihren Stiefeln und erschreckte Arnold damit so sehr, dass er floh und versuchte, sich unter den Küchentisch zu quetschen, der heftig ins Wanken geriet.
Edith blickte hinüber in die Küche. Draußen stand ein riesiger, vom Aufprall auf die Fensterscheibe benommener schwarzer Vogel mit einem weißen Brustlatz und einem gewaltigen grell orangefarbenen Schnabel.
»Oh, Gerry!«, rief Betty, als sie den Vogel entdeckte. »Was soll das! Geh zur Eingangstür, du dummes Tier!«
Der Vogel schwankte immer noch, fasste sich aber wieder und verschwand in die Nacht.
Betty verdrehte theatralisch die Augen und schlurfte aus der Küche. Edith hörte, wie sie die Haustür öffnete. Wieder erscholl ein ohrenbetäubendes Kreischen, und dann kam ein Knäuel aus schwarzen Federn mit einem Schnabel in Leuchtorange hereingesaust. Der Vogel zog noch ein paar Kreise und ließ sich auf der Lehne von Ediths Sofa nieder.
Erst jetzt sah sie den Faden um seinen Hals und das winzige Papierröllchen, das daran gebunden war. Voller Stolz schien der Vogel ihr die Sendung zu präsentieren.
Betty kam ächzend und keuchend zurück in die Küche und nickte Edith zu, die daraufhin vorsichtig die Nachricht herauszog.
»Roll es auseinander, Liebes, und lies mir vor, was da steht«, drängte Betty und bedachte den gefiederten Eindringling mit einem mürrischen Blick.
Betty, hoffentlich findet Gerry im Dunkeln zurück nach Hause! Wir haben einen dringenden Notruf bekommen. Eines der Ponys ist verletzt. Ich weiß nicht, was es angefallen hat, aber es könnten noch mehr davon hier draußen sein. Ich bringe das Junge zurück zu seiner Herde, aber das kann ein bisschen dauern.
Lasst mir was vom Abendessen übrig! Und wünscht mir Glück …
Edith musste sich ganz auf das Lesen der Worte konzentrieren, ohne sich dabei Gedanken zu machen, denn ihre Kopfschmerzen drohten wieder einzusetzen. Sie hatte kaum zu Ende gelesen, als der Vogel übers Sofa herangehüpft kam, ihr den Zettel mit dem Schnabel aus der Hand schnappte und an Betty weitergab. Die alte Frau nickte, als hätte sie solche Nachrichten schon hundertmal bekommen.
»Ist in Ordnung, Gerry, du kannst ins Bett gehen, wir brauchen keine Antwort zurückzuschicken. Das Essen halten wir im Kohleherd warm. Danke, dass du die Nachricht gebracht hast.«
Gerry quäkte noch einmal laut und hüpfte dann auf den Boden hinunter.
Betty blickte wieder zu Edith hinüber.
»Nun, da ist nichts zu machen. Ich fürchte, du wirst deinen Onkel erst morgen früh sehen.«
Edith antwortete nicht gleich, weil sie den Vogel nicht aus den Augen lassen konnte. Er war zuerst wieder übers Sofa gehüpft, dann aufs Fensterbrett und weiter auf den Küchentresen – und dort versuchte er jetzt, sich in eine Einkaufstasche zu zwängen.
»Ach, typisch Gerry«, erklärte Betty, als wäre ein solches Verhalten das Natürlichste der Welt. »Wenn er mit deinem Onkel draußen im Wald unterwegs war, ist er meistens ziemlich müde und verkriecht sich am liebsten in der Tasche. Das ist ein Problem, denn wenn er erst einmal drin ist, bekommt man ihn nur schwer wieder heraus. Man könnte ihn mit Fug und Recht einen störrischen alten Vogel nennen«, meinte sie mit einem Lächeln. »Und mit dieser Eigenschaft ist er hier vermutlich nicht der Einzige.«
»Ist er ein Tukan?«, fragte Edith mit einem Blick auf Gerrys riesigen gelben Schnabel und sein auffälliges Federkleid.
Der Vogel bemerkte offenbar, dass man über ihn sprach; er krähte noch einmal und hüpfte aus der Tasche. Erst da sah Edith, dass er auf einem Bein hüpfte.
»Genau, ein Tukan – ein einbeiniger Tukan. Dein Onkel hat ihn auf einer Expedition aufgegabelt, musste ihm aber leider ein Bein amputieren. Der Ärmste war in eine Klebefalle geraten. Er musste schon fast eine Woche in diesem Baum festgehangen haben, halb tot und mit einem abfaulenden Bein.« Betty machte eine Kunstpause.
»Ach, du Ärmster!«, rief Edith entsetzt.
»Ja, das war er. Dein Onkel musste ihn mit zurückbringen und hier wieder zusammenflicken, aber dann ist er geblieben. Im Dschungel ist es mit nur einem Bein nicht so einfach. Das Balancieren auf den Ästen fiel ihm schwer, und mit dem fehlenden Bein fliegt er immer ein bisschen schräg. Aber jetzt gehört er hier in Pilgrims sozusagen zum Inventar. Und macht sich an einem Ort ohne Mobilfunkempfang als Bote nützlich. Macht euch nur miteinander bekannt.« Betty schmunzelte. »Aber beim Frühstück musst du aufpassen; man würde es bei einem Tukan nicht erwarten, aber er hat eine große Schwäche für Bohnen in Tomatensoße …«
Edith stützte sich aus dem Sofa hoch und ging auf den großen Vogel zu. Dann streckte sie die Hand in Gerrys Richtung aus, ging in die Hocke und wartete ab. Der Vogel beobachtete sie, hüpfte dann von seiner Tasche fort und zu ihr hin, senkte den Kopf und hielt ihn ihr zum Kraulen hin.
»Du meine Güte!«, rief Betty. »Er ist noch nie aus seiner Tasche gekommen, um jemanden zu begrüßen, und schon gar nicht so!«
»Er ist so schön!«, sagte Edith.



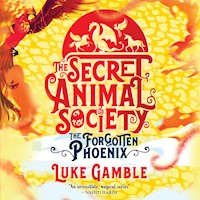
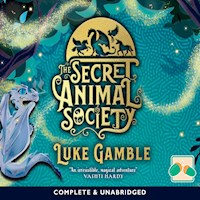













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










