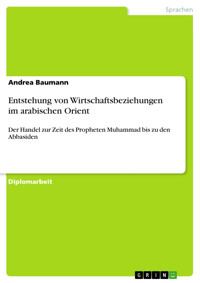Die Gewährung eines Triumphs im alten Rom. Untersuchung ausgewählter Senatsdebatten E-Book
Andrea Baumann
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Weltgeschichte - Frühgeschichte, Antike, Note: 1,0, Universität Rostock (Heinrich-Schliemann-Institut), Veranstaltung: Der Adel in der römischen Republik, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Triumph galt in der römischen Antike als höchste Ehrung für einen Feldherrn. In der Zeit um die Wende des dritten zum zweiten Jahrhundert vor Christus hat es besonders viele Debatten im Senat um die Gewährung eines Triumphs gegeben. Aus den Jahrhunderten zuvor sind nur wenige Einzelfälle bekannt, in denen die Triumphvergabe strittig war. Weshalb also gerade zu dieser Zeit eine solche Phase eintrat, soll diese Arbeit zeigen, die sich ausschließlich mit dem republikanischen Triumph befasst. Dabei soll zunächst auf die Bedingungen für die Bewilligung eines Triumphs eingegangen werden, um zu demonstrieren, dass die Vergabe des Triumphs nicht ganz so willkürlich geschah, wie es den Anschein haben wird. Danach werden kurz mit die Möglichkeiten, die dem siegreichen Feldherrn zur Verfügung standen, wenn der Senat den Triumph ablehnte, geschildert Dies sind die ovatio und der triumphus in monte Albano. Danach wendet sich die Arbeit einigen Fallbeispielen aus den zu behandelnden Jahren zu; zwei der Feldherren haben den Senat von der Rechtmäßigkeit ihres Triumphs überzeugen können, zwei sind in den Verhandlungen gescheitert. Die Fallbeispiele werden Auffälligkeiten bereithalten und eine Überleitung zu den Gründen liefern, aus denen es zu dieser Phase der Kämpfe um die Gewährung eines Triumphs kam, die immerhin von 211 bis etwa 185 v. Chr. andauerte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
1.Einleitung
2. Bedingungen für die Gewährung eines Triumphs
3. Varianten des Triumphs
3.1 Die ovatio
3. 2 Der triumphus in monte Albano
4. Die Phase – Die Wende vom 3. zum 2. Jh. v. Chr.
4.1 Fallbeispiele
4.1.1 Marcus Claudius Marcellus
4.1.2 Lucius Cornelius Lentulus
4.1.3 Lucius Furius Purpureo
4.1.4 Marcus Fulvius Nobilior
5. Die Suche nach den Gründen
6. Schlussbetrachtung
7.Quellen- und Literaturverzeichnis
7.1 Antike Autoren
7.2 Sekundärliteratur
7.2.1 Lexika
8.Anhang
8.1 Postumius Megellus
8.2 Claudius Marcellus
8.3 Cornelius Lentulus
8.4 Furius Purpureo
8.5 Fulvius Nobilior
1.Einleitung
Wir befinden uns im Jahre 187 v. Chr., der Prokonsul Marcus Fulvius Nobilior überquert in der Quadriga die heilige Stadtgrenze, das pomerium. Das Volk jubelt ihm zu, es ist ein besonderer Tag für alle Römer. Denn Fulvius Nobilior ist als Triumphator für einen Tag lang über alle anderen Bürger erhaben, selbst über die Konsuln, und er wird diesen Ruhm für alle Ewigkeit für sich beanspruchen können. Vergessen sind die mühevollen Verhandlungen, die dem vorausgingen, vergessen die am Ende wirkungslosen Intrigen eines mit ihm verfeindeten Konsuls.
Gerade um jene Verhandlungen und um die zahlreichen Gründe, aus denen manche von ihnen scheiterten, soll es in dieser Hausarbeit gehen. In der Zeit um die Wende des dritten zum zweiten Jahrhundert v. Chr. hat es besonders viele Debatten im Senat um die Gewährung eines Triumphs, der höchsten erreichbaren Ehre für einen römischen Feldherrn, gegeben. Aus den Jahrhunderten zuvor sind nur wenige Einzelfälle bekannt, in denen die Triumphvergabe strittig war. Weshalb also gerade zu dieser Zeit eine solche Phase eintrat, soll diese Arbeit zeigen, die sich ausschließlich mit dem republikanischen Triumph befasst.
Ich werde dabei zunächst auf die Bedingungen für die Bewilligung eines Triumphs eingehen, um zu demonstrieren, dass die Vergabe des Triumphs nicht ganz so willkürlich geschah, wie es den Anschein haben wird.
Danach beschäftige ich mich kurz mit den Möglichkeiten, die dem siegreichen Feldherrn zur Verfügung standen, wenn der Senat den Triumph ablehnte. Dies sind die ovatio und der triumphus in monte Albano.
Nach dieser kurzen Schilderung werde ich mich einigen Fallbeispielen aus den zu behandelnden Jahren zuwenden; zwei der Feldherren haben den Senat von der Rechtmäßigkeit ihres Triumphs überzeugen können, zwei sind in den Verhandlungen gescheitert.
Die Fallbeispiele werden Auffälligkeiten bereithalten und mir eine Überleitung zu den Gründen liefern, aus denen es zu dieser Phase der Kämpfe um die Gewährung eines Triumphs kam, die immerhin von 211 bis etwa 185 v. Chr. andauerte.
2. Bedingungen für die Gewährung eines Triumphs
Der siegreiche, republikanische Feldherr musste einige Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt daran denken zu können, den Senat um einen Triumph zu bitten. Zunächst einmal war es notwendig, dass er das imperium und das Recht des auspicium innehatte[1] und von Geburt an römischer Bürger war. Zudem sollte er eine ordentliche Magistratur bekleiden[2], also Praetor, Konsul oder Diktator sein; Triumphgewährungen an Promagistrate wurden erst im Zweiten Punischen Krieg üblich[3]. Waren mehrere ordentliche Magistrate am Sieg beteiligt, triumphierte der Höchstkommandierende, ein Konsul musste demnach vor dem Diktator zurücktreten und ein Praetor vor dem Konsul[4]. Von zwei Konsuln konnte derjenige in den Genuss eines Triumphs kommen, der am Tag der Schlacht imperium und auspicium für ebenjene Schlacht innegehabt und sich nicht in eine fremde provincia[5] eingemischt hatte. Nach dem Ersten Punischen Krieg waren allerdings auch diese Regeln etwas gelockert worden, wie am Beispiel des Furius Purpureo ersichtlich werden wird. Genau dieses Beispiel widerlegt auch die nächste Regel, die nach dem Zweiten Punischen Krieg aufgeweicht worden war: kehrte der Imperator ohne seine Truppen nach Rom zurück, weil er sie an seinen Nachfolger abgegeben hatte, sollte der Triumph verwehrt werden, denn der Krieg war in diesem Falle nicht beendet. Ursprünglich galt, dass ein Triumph nicht für die Beendigung einer Schlacht, sondern für den endgültigen Sieg in einem Krieg und das damit einhergehende Ende des Krieges gewährt werden sollte, sodass auch die Truppen das befriedete Gebiet verlassen und nach Rom zurückkehren konnten[6].
Für eine sehr lange Zeit galt allerdings die Bedingung des gerechten Krieges, des bellum iustum[7]. Der Triumph wurde nicht bewilligt, wenn ein Sieg in einem Sklaven- oder Bürgerkrieg errungen worden war[8], denn diese zählten nicht als bella iusta. Erst am Ende des ersten Jahrhunderts v. Chr. war auch diese Regel nicht mehr zwingend[9].
Außerdem musste der Kampf mit Blutvergießen geführt worden sein[10] und der Triumph konnte verweigert werden, wenn dem Sieg eine schwere Niederlage vorausgegangen war[11].
Die Entscheidung über die Triumphvergabe lag ohnehin ursprünglich wohl im Ermessen des Feldherrn selbst[12] und nicht beim Senat, was den Fall des Postumius Megellus erklärt, auf den ich noch eingehen werde.