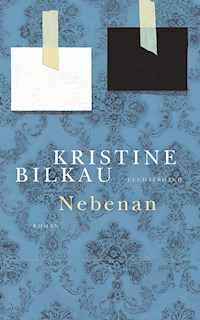9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großes Generationsporträt unserer Zeit
Isabell und Georg sind ein Paar. Ein glückliches. Wenn die Cellistin Isabell spätabends von ihren Auftritten mit dem Orchester nach Hause geht oder der Journalist Georg von seinem Dienst in der Redaktion auf dem Heimweg ist, schauen sie oft in die Fenster fremder Wohnungen, dringen mit ihren Blicken in die hellen Räume ein. Bei abendlichen Spaziergängen werden sie zu Voyeuren. Regalwände voller Bücher, stilvolle Deckenlampen, die bunten Vorhänge der Kinderzimmer. Signale gesicherter Existenzen, die ihnen ein wohliges Gefühl geben. Das eigene Leben in den fremden Wohnungen erkennen. Doch das Gefühl verliert sich.
Mit der Geburt ihres Sohnes wächst nicht nur ihr Glück, sondern auch der Druck und die Verunsicherung. Für Isabell erweist sich die Rückkehr in ihren Beruf als schwierig: Während des Solos zittern ihre Hände, nicht nur am ersten Abend, sondern auch an den folgenden. Gleichzeitig verdichten sich in Georgs Redaktion die Gerüchte, der Verlag würde die Zeitung verkaufen. Währenddessen wird ihr Haus saniert. Im Treppenhaus hängt jetzt ein Kronleuchter, im Briefkasten liegt eine Mieterhöhung. Für die jungen Eltern beginnt damit ein leiser sozialer Abstieg. Isabell und Georg beginnen mit einem Mal zu zweifeln, zu rechnen, zu vergleichen. Jeder für sich. Je schwieriger ihr Alltag wird, desto mehr verunsichert sie, was sie sehen. Die gesicherten Existenzen mit ihren geschmackvollen Wandfarben sagen jetzt: Wir können, ihr nicht. Was vertraut und selbstverständlich schien – die Cafés, Läden, der Park, die Spielplätze mit jungen Eltern –, wirkt auf einmal unzugänglich. Gegenseitig treiben sich Isabell und Georg immer mehr in die Enge, bis das Gefüge ihrer kleinen Familie zu zerbrechen droht.
Kristine Bilkau zeichnet in ihrem Debütroman »Die Glücklichen« das präzise Bild einer nervösen Generation, überreizt von dem Anspruch, ein Leben ohne Niederlagen zu führen, die sich davor fürchtet, aus dem Paradies vertrieben zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
KRISTINE
BILKAU
Die Glücklichen
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen. © 2015 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-15636-7V003
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
www.twitter.com/luchterhandlit
Für
T. und T.
Now a new day comes
Clears the darkness out of sight
And the shadows that were sleeping
Come and dance beneath the light
Belle and Sebastian,
»Waiting for the Moon to Rise«
1. TEIL
(Bald ist Winter)
1| Es ist dunkel und der Abendverkehr schiebt sich langsam durch die Straße vor dem Haus, die Lichter der Autos schimmern hinter dem Plastikvorhang, die gesamte Außenwelt verschwimmt hinter der Plane und dem Baugerüst. Ein Zustand, der sie nicht sonderlich stört, im Gegenteil, der gar nicht so schlecht ist, wie die Nachbarn finden, die im Treppenhaus nörgeln, wie lange denn noch. Die milchige Hülle macht die Wohnung zu einem verborgenen Raum, sie verbreitet ein Höhlengefühl. Tagsüber filtert sie das Licht und lässt es geschwächt in die Zimmer, nachts ist sie wie ein schützender Mantel. Isabell stellt sich ihren Ahornbaum hinter dem Gerüst vor. Die feinen Anzeichen der Jahreswechsel bemerkt sie an ihm zuerst; wenn sich an den Zweigen Knospen bilden und Tage später hellgrüne Spitzen, wenn sich die Blätter rot und gelb färben und nach drei, vier stürmischen Nächten die Äste kahl sind, und sie Georg mitteilen kann: Wir haben Frühling; bald ist Winter. Während sie die Plane betrachtet, sieht sie den Baum in all seinen Details vor sich. Das handtellergroße, gezackte Ahornblatt löst sich wie zufällig von seinem Zweig und fällt langsam, kreiselnd, vom Wind getragen. Sie hat ihre Straße vor dem Auge, die Fassaden in Hellblau, Lindgrün und aufreizendem Himbeerrot mit weißen Ornamenten, nach und nach herausgeputzt während der letzten Jahre. Dazwischen, wie kümmerliche Provisorien, Häuser aus stadtschmutzigem Gelbklinker. Gegenüber die Hutmacherei und der Feinkostladen mit seinem Bistro, daneben das kleine Geschäft, in dem es überteuerte, schöne Dinge gibt: Rosenseife aus Portugal, Alpaka-Decken aus Norwegen, Strickpullis einer südfranzösischen Manufaktur. Die hohen Fenster des Yogastudios im ersten Stock, darin am späten Nachmittag die Umrisse der Körper, ihre synchronen Bewegungen im warmen Licht. Die Zweige der hochgewachsenen Bäume über den Dächern der parkenden Autos. Alles, ihr Zuhause.
Sie reißt einen kleinen Zettel in Hälften und beginnt zu schreiben.
Meine Hände werden nicht zittern.
Mit geschwungener Schrift notiert sie den Satz. Das Ganze hat etwas Lächerliches, Kindisches, aber sie kann nicht anders.
Meine Hände, schreibt sie auf das zweite Stückchen Papier. Das M und das H zieht sie größer als die anderen Buchstaben. Der Bleistift erzeugt ein Wispern.
Werden nicht zittern.
Sie schaut auf die Uhr, in einer Viertelstunde muss sie los. Schnell faltet sie die Papierstreifen und stopft sie in die Taschen ihrer Jeans, einen in die rechte, einen in die linke, einen für die rechte Hand, der ist wichtig, einen für die linke Hand, zur Sicherheit.
Auf dem Weg in die Küche schiebt sie die Zettel tiefer in die Taschen, fest stecken sie unter dem engen Jeansstoff.
Georg sitzt am Tisch und füttert Matti, zwischendurch beißt er von seinem eigenen Brot ab und blättert in einer Zeitschrift. Auf dem Teller hat er Apfelringe und Gurkenwürfel arrangiert, dazu einige Häppchen Toast mit Butter, die Matti erstaunlich brav isst. Manchmal müssen sie mit Tricks seine Aufmerksamkeit suchen, damit er das Essen nicht vergisst, denn er spielt lieber mit seinem Löffel, schaut in der Küche umher, zeigt mit seinem speichelnassen Finger fordernd auf die Lampe, eine Banane, eine Flasche, weil er das Wort dazu hören will. Dann sitzen sie beide neben ihm, jeder an einer Seite, und machen aus der Mahlzeit ein Spiel, ein Löffel Grießbrei brummt wie ein Flugzeug auf Mattis offenen Mund zu, ein Stückchen Gurke kreist wie eine Hummel durch die Luft, und mittendrin, sieht sie vor sich das komische Bild, das sie beide dabei abgeben, erkennt Georg nicht, erkennt sich selbst nicht; zwei seltsame Erwachsene, die Theater spielen, die sich über ihr sattes Kind freuen wie über ein großartiges Geschenk.
Auf dem Herd zischt die Espressokanne, dazu hat Georg wieder Milch aufgesetzt. »Da ist Kaffee, wenn du möchtest«, sagt er, den Blick weiter auf die Zeitschrift gerichtet. Sie stellt die Gasflamme aus, »ich bin heut nicht müde«, sagt sie, kann jedoch ein Gähnen nicht unterdrücken. Georg blickt sie fragend an, sie hält sich die Hand vor den Mund und muss lachen. »Ich brauch heut keinen Kaffee, ich bin konzentriert genug.« Die Milch gießt sie in einen Becher und rührt Honig hinein, Koffein kann Hände zittern lassen, warme Milch beruhigt die Nerven. Sie hat konzentriert gesagt, obwohl sie angespannt dachte. Doch sie will nicht Georgs Neugier wecken, sie will nicht darüber reden. Es wird von allein vergehen, wenn sie erst in ihren alten Rhythmus zurückgefunden hat. Seit es Matti gibt, fallen ihr abends die Augen zu, nun muss sie um diese Zeit wieder hellwach sein. Nach der Vorstellung geht es für manche Kollegen noch weiter, in den Nachtclub des Theaters, wo ihnen die Bühne gehört, wo sie das spielen dürfen, was sie wirklich wollen. Sie aber wird nach Hause eilen, nichts wie ins Bett gehen, sie wird auf den Schlaf warten und wissen, dass Matti sie bald rufen wird, selten schafft er mehr als drei oder vier Stunden am Stück ohne aufzuwachen. Ihre nimmermüden Ohren werden seine Stimme oder sein Weinen erwarten. Die Leuchtziffern des Weckers im Auge, wird sie an den kommenden Tag und den nächsten Abend denken. Sie hat Sehnsucht nach den letzten Wochen der Schwangerschaft, nach der Langsamkeit und der Ruhe dieser Zeit. Als sie zu Hause Musik machte, ohne Dirigent, ohne Kollegen, ohne Publikum. Sie spielte für einen unsichtbaren Menschen. Ihre Musik und die Gegenwart des Kindes, das sich unter ihrer Bauchdecke regte. Sie war allein und wusste doch: Jemand hört mich.
Sie drückt ihre Wange an Mattis, atmet dabei seinen Geruch, buttrige Haut und Apfelsäure – seine Augen weiten sich, weil er versteht, dass sie geht –, dann gibt sie Georg einen Kuss. »Einen schönen Abend«, ruft er ihr hinterher, als sie im Flur den Cellokasten schultert.
Bevor sie das Haus verlässt, hört sie von der Straße her Musik, Blechbläser, Pauken, dann Flöten, etwas schrill. Ein Streifenwagen fährt langsam vorbei, dahinter geht der kleine Spielmannszug, Schüler mit roten Wangen, die Hände in fingerlosen Wollhandschuhen, das spielende Grüppchen gefolgt von Müttern, Vätern und Kindern, die Laternen vor sich hertragen. Sie bleibt stehen und schaut zu, wie der Umzug an ihr vorbeizieht. Nächstes Jahr könnte sie mit Matti dabei sein. Eine Frau mit Pudelmütze schiebt ihr Kind in der Karre vorbei, in seiner Faust hält es einen Holzstab, an dem nur ein Lämpchen mit etwas Draht befestigt ist, die Mutter bewegt die Lippen zum Lied. Es ist schön und einfach, Papierlampen durch die Dunkelheit zu tragen, wie gern hätte sie jetzt Matti im Tragetuch vor dem Bauch, wie schön wäre es, mit ihm eine Weile dabei zu sein, mit den anderen zu singen und in der Menge zu verschwinden.
Weil sie sich bemüht, nicht an ihre Hände zu denken, während sie den Spind öffnet und sich zur schwarzen Jeans eine schwarze Bluse anzieht, nimmt sie jeden Handgriff bewusst wahr, die Knöpfe durch die Löcher schieben, den Blusenkragen richten, den Schrank abschließen.
Durch den langen Korridor geht sie zur Cafeteria, Gesang dringt aus den Garderoben und es riecht nach Haarspray. Eine Tänzerin schiebt ihren schmalen Körper durch die Tür, sie trägt einen Catsuit, falsche Wimpern flattern an ihren Lidern, grazil kreist sie die eine Schulter, danach die andere, biegt ihren Oberkörper mühelos nach vorn und richtet ihn wieder auf, am Bühnenausgang bleibt sie stehen, Feuerzeug und Zigaretten in der Hand. Isabell streckt unwillkürlich den Rücken und legt den Kopf ein wenig zur Seite, um den Nacken zu dehnen.
Am Automaten in der Cafeteria holt sie sich heißes Wasser und einen Beutel Minztee. Die Techniker sitzen an den Tischen und essen Braten mit Rotkohl und Knödeln, Isabells Blick schweift über sie hinweg zu den Bildern an der Wand, Fotos von vergangenen Inszenierungen, bei einer weiteren war sie dabei; sie sollte sich hier nicht fremd fühlen. Sie hält den Becher unters Kinn und spürt, wie der Dampf die Lippen berührt, auch der Tee ändert nichts daran, dass sie friert. Nach einer Weile geht sie ins Untergeschoss, schiebt die Eisentür zum Graben auf, die mit einem dumpfen metallischen Ton wieder zuklappt, das Geräusch erinnert sie an die Kellertüren von Parkhäusern.
Ein kleines schrumpfendes Ensemble sind sie, fünfzehn Leute, vor Mattis Geburt waren sie noch zwanzig. Eine schwarz gekleidete Truppe in einem mit schwarzem Filz ausgekleideten Graben, verborgen unter der Bühne, wie in einem Tunnel. Für das Publikum sind sie unsichtbar, bis zu den Pausen. Dann stellen sich Zuschauer an das Geländer und blicken zu ihnen herab, Eltern mit ihren Kindern, Rentnerpaare oder Freundinnen, die sich für den Abend zurechtgemacht haben, mit Glitzerblusen und Handtäschchen. Sie stehen oben am Rand des Grabens und schauen auf uns herunter, als wären wir Tiere in einem Gehege, hat sie früher gedacht. Die meisten Kollegen arbeiten an anderen Projekten, das Musical bringt ihnen Geld, raubt ihnen aber die Zeit, es ist etwas Vorläufiges, nicht das Eigentliche. Ob die Musik vom Tonband käme, wollte ein grauhaariger Strickjackenmann gestern wissen, als wären sie und ihre Instrumente nur zur Zierde da, und sie hat geduldig geantwortet, vom Tonband, das war geradezu rührend, wo gab es noch Tonbänder?
Sie setzt sich und ordnet ihre Noten, die sie eigentlich nicht braucht, zumindest nicht zum Spielen, aber für das sichere Gefühl, dass alles an seinem Platz liegt. Sie löst ihren Zopf, dreht ihn zu einem Strang und rollt ihn zu einem festen Knoten, den sie sich im Nacken bindet. Sie friert wieder und reibt sich die Oberarme. Alexander begrüßt sie überschwänglich, mit einem lang gezogenen Hey, sie misstraut ihm, er kann boshaft sein, die Schwächen der anderen erspüren und mit seinen Bemerkungen aufspießen, erste Geige, selbstverständlich erste Geige, Studium in Bukarest, sein Akzent lässt alles, was er sagt, auch die Gemeinheiten über Kollegen, auf reizvolle Art nachlässig wirken. Gestern begleitete er sie im Regen ein Stück zum Eingang, er eskortierte sie elegant mit seinem Schirm, und sie fühlte sich angezogen von ihm, die Mädchen an der Bar im Foyer fallen reihenweise auf ihn herein.
Sie hebt ihr Cello vom Boden und lässt den Bogen leicht über die Saiten gleiten, spielt ein paar Takte aus dem Solo, dann wieder einzelne Töne mit Druck. Sebastian setzt sich, in sich gekehrt und wortkarg, die ewige zweite Geige, zufrieden dabei, er scheint genau das zu wollen. Sie beobachtet, wie er aus seinem Rucksack die gewohnte Thermoskanne holt und sie unter seinen Stuhl stellt. In der Kantine isst er selbst gemachte Brote, sie hat seine Stullen in der Tupperdose immer belächelt. Ihr Blick fällt auf seine derben Schuhe, wie Wanderschuhe sehen sie aus, drei Kinder hat er, drei.
Während sie ihre Instrumente stimmen, stellt Sean sich an sein Pult, das Publikum applaudiert ihm nicht, denn er verschwindet wie alle im Graben, nur sein Kopf ragt gerade genug heraus, damit die Darsteller ihn sehen können. Der Bogen liegt ruhig in der Hand, es gibt keinen Grund sich zu fürchten, sie ist hier, den dritten Abend nach einer langen Pause, sie ist hier, als wäre sie nicht weg gewesen, die Geräusche sind vertraut, die Gesichter auch, nur nicht auf die Hände achten, einfach spielen, alles wie immer sein lassen, das muss doch möglich sein. Maggie schlängelt sich dicht an Sebastian vorbei, den Arm um ihre Bratsche geschlungen wie um einen kleinen Hund. Sie trägt ein langes Kleid, als wären sie ein Sinfonieorchester. Ihr Pony ist toupiert, die Augen mit dramatischem Lidstrich geschminkt.
Im Saal wird es dunkel, acht Uhr, Georg singt Matti gerade in den Schlaf, er wird neben dem Gitterbett sitzen und eine Melodie summen, bald wird er vorsichtig aufstehen, langsam und auf Zehenspitzen zur Tür gehen, damit keine Diele knackt und seinen Rückzug verrät, damit er ungehindert in die Freiheit seines Abends gleiten kann.
Vereint in konzentrierte Stille warten sie hier unten darauf, dass Sean den Arm hebt. Sie atmet wieder gegen das Herzklopfen an.
Mit jeder Minute wächst die Zuversicht: Es wird nicht wieder passieren.
Die Musik strömt über sie hinweg, alle Stimmen schicken ihre Wogen durch den Raum, sie ist eine Schwimmerin und wird getragen, sie treibt im Strom des satten Klangs, sicher und leicht.
Stille im Graben, Schritte über ihnen auf der Bühne, auf dem kleinen Monitor neben sich beobachtet sie die Darsteller, die Szene da oben wird dauern. Alexander sinkt in seinen Stuhl, im Gesicht der bläuliche Schimmer seines Telefons, sein Finger wischt über das kleine Lichtquadrat. Ein Zwist auf der Bühne, Schlagzeugwirbel, sie bringt sich in Position, Trommelkrach, oben soll etwas zu Bruch gehen, mit Geräuschen untermalt, Bogenanstrich, Abstrich, zwei raue Töne, ein Zupfen, Pling, dann wieder Pause. Minuten vergehen und sie versucht herauszufinden, was sie in den Händen spürt. Klavier vom Keyboard mit Synthiestreichern, Chor auf der Bühne, anschwellendes Pathos, Liebe und Schmerz, Sean dirigiert mit wiegendem Körper und begleitet den Chor mit Grimassen, manche finden lächerlich, wie er sich da reinhängt, Abend für Abend. Polternde Schritte und Dialog, Alexander lehnt sich wieder zurück, die Geige auf dem Schoß und das Telefon in der Hand. Im Schein ihres Halogenlämpchens blättert Maggie in einem Buch über den Himalaya.
Isabell schaut wieder auf den Monitor, achtet auf jede Bewegung der Schauspieler, weit, weit ist sie entfernt von der Trägheit der anderen. Solo Querflöte. Sie lässt den Arm hängen und schüttelt die Hand, nur ein wenig, damit die anderen nichts merken. Einsatz Fagott. Sie friert wieder und die gefährliche Unruhe wandert in die Glieder, sie spürt es in den Armen, sogar in den Beinen, wie ein leises Beben. Nicht das Atmen vergessen. Ihr Körper verlässt sie, und wenn sie davonlaufen könnte, würde sie das jetzt tun. Die Achseln unter dem Blusenstoff sind nass. Noch vier, noch drei, noch zwei, und – sie setzt einen Tick zu früh ein, der Auftakt scheint misslungen – oder nicht, oder doch?
Schon ist der Moment verflogen, nun piano und zart, piano, doch sie kann nur mit Kraft spielen, sie kann den Druck nicht vom Bogen nehmen, sie muss die Kontrolle behalten, viel zu laut ist sie, starr und laut – oder nicht, oder doch?
Maggie dreht sich zu ihr, und sie muss auch das noch schaffen, nicht hinsehen. Sean, Alexander, Sebastian, die anderen, alle Gesichter verschmelzen zu einer einzigen Frage: Was stimmt nicht mit dem Cello? Sie spürt das Mitleid und das Erstaunen der anderen, mit jedem Ton, den der starre Bogen erzwingt, wächst die Neugier der anderen, das Solo scheint endlos, und doch, sie erreicht die finalen Takte, nur nicht schneller werden, das letzte Stück Würde bewahren, das Tempo einhalten. Einsatz Blechbläser, es ist vorbei. Streicher und Synthiestreicher übertönen jeden Zweifel, jede Unebenheit. Eben noch wie blind und taub, reißt sie nun der Strom wieder mit sich, sie legt eine übertriebene, fast peinliche Hingabe in ihr Spiel, als könne sie ihr Solo damit ungeschehen machen, seht her, ich bin eins mit meinem Instrument, ich falle nicht aus, ich habe meine Sinne beisammen, ich bin weder krank noch unfähig.
Während der Pause geht sie zum Bühnenausgang und huscht an dem Grüppchen Raucher, draußen an der Treppe vorbei, als wäre sie auf der Flucht, hinter der Hausecke bleibt sie stehen. So schlimm war es nicht, es ging, es ging gerade noch, sie wünschte, jemand würde ihr das sagen, sie wünschte, sie könnte jemanden fragen. Sie spielte wie unter einer Glasglocke. Jeder konnte ihr dabei zusehen: Sie hatte den Klang verloren, und die Leichtigkeit.
»Wie wars?«, fragt Georg in die Dunkelheit des Schlafzimmers. Sie schlüpft zu ihm unter die Decke.
»Gut.«
2| Alle aus der Nachbarschaft scheinen handgemachte Brötchen zu wollen, bis vor die Ladentür stehen die Leute Schlange, an einem gewöhnlichen Mittwochmorgen, viele vertraute Gesichter, manche von ihnen grüßen, andere starren mürrisch vor sich hin. Sie mag diesen Andrang nicht, es hat etwas Dümmliches, trotzdem steht sie auch hier. Ihr gefällt die offene Backstube, Hände kneten Teig, verstreuen Mehl, verreiben es auf den Klumpen und kneten weiter. Die groben rotvioletten Hände des Meisters, die schlanken Hände einer jungen Frau, die gerade Petits Fours verziert. Die Brötchen liegen in Körben, keines gleicht dem anderen, manche haben Spitzen wie hervorspringende Nasen, andere knotige Dellen wie Bauchnabel, wie ein Bauchnabel am Ende der Schwangerschaft.
Nachdem sie bezahlt hat, nimmt sie die Tüte vom Tresen und verlässt den Laden. An einer roten Ampel fallen ihr die Zettel ein, sie trägt die Jeans von gestern. Manche tragen zu Konzerten ein bestimmtes Paar Socken, das sie vermeintlich beschützt. Manche hüten einen Bleistiftstummel, legen ihn auf die Kante des Notenständers, in dem Glauben, ohne hätten sie kein Talent mehr. Sie klaubt die zerdrückten Papierschnipsel aus den Taschen und wirft sie in einen Mülleimer.
Georg hat den Tisch gedeckt und nimmt ihr die Tüte ab. Zwei Brötchen hält er sich vor die Brust, aus beiden wölbt sich ein Teigknopf. Bevor das Blech in den Ofen kommt, muss der Lehrling jedem Teil den letzten Schliff geben, stellen sie sich gemeinsam vor, mit dem Finger stippt er in den Teig oder dreht einen Wirbel hinein. »Damit wir merken, dass wir Unikate essen«, sagt Georg. Während sie lachen, werden sie gebannt von Matti beobachtet, dann lacht er mit, und sie können nicht aufhören, weil das unwissende heitere Kind, das nach seinen eigenen Regeln etwas Lustiges entdeckt hat, sie von Neuem ansteckt.
Ihre und Georgs Hand an der Schranktür, »lass nur, ich mach schon«, sagt sie, einen Augenblick schneller als er nimmt sie das Dinkelpulver aus dem Schrank. Im Wasserkocher brodelt es, soll ich? Willst du? Sie kümmern sich zu zweit um ein Kind und kommen sich dabei ständig in die Quere. Georg reicht ihr die Porzellanschale für den Brei, »da steht schon eine«, sagt sie und zeigt zum Tisch.
Er nimmt die Bäckertüte und knüllt sie etwas zusammen. »Steht da Manufaktur drauf?«, fragt er und faltet das Papier wieder ein wenig auseinander. »Natürlich, Idioten«, murmelt er und lässt die Tüte in den Mülleimer fallen. »Und für den eitlen Quatsch musste der andere Laden dran glauben.« Graubrot, Bienenstich, seine Mutter habe dort früher gekauft, und außerdem die besten Schokoladeneclairs seines Lebens. Der alteingesessene Bäcker musste vor fast einem Jahr schließen, weil die Leute sich lieber bei dem neuen die Beine in den Bauch stehen, bis sie an der Reihe sind. Ein Blumengeschäft ist heute in den Räumen des früheren Bäckers, Floristenwerk, denkt sie und sagt den Namen lieber nicht, weil Georg den genauso blöd finden würde wie Manufaktur. Dort lagen dicke Blumenbündel in Zinnwannen, allein unzählige Rosensorten. Sie dachte an Postkarten mit historischen Schwarzweißbildern, Fotos von Hinterhöfen und nackten Kindern, die in Zinnwannen badeten. Matti war gerade vier Monate alt, als sie für Georg zum Geburtstag dort einen Strauß Wiesenblumen kaufte. Im Laden roch es nach feuchten Blättern und frisch geschnittenen Stielen. Kräuter wuchsen aus Emaillekübeln, sie waren beschriftet: Bohnenkraut, Liebstöckel, Kerbel, Majoran. Sie stellte sich den Alltag in dieser Gegend vor vielen Jahrzehnten, vor einem Jahrhundert vor, als es einen Milchmann gab, einen Kaufmannsladen, einen Kohlehändler, und als im Winter Eisblumen an den Fenstern wuchsen. Die Augen der Floristin glänzten, als würde sie sich und ihren Laden einfach nur wunderbar finden. Sie trug eine weiße Baumwollschürze mit einer Spitzenbordüre am Ausschnitt. Auf einem Tisch neben der Kasse standen kleine Töpfe, darin Pflanzen mit gelben Blüten, Butterblumen, wie lange hatte sie keine mehr gesehen, Scharfer Hahnenfuß,3 Euro, stand auf einem Schild, das an einem Stäbchen in der Erde eines der Töpfe steckte, so hießen sie also unter Floristen. Als Kind hatte sie Butterblumen auf Kuhwiesen oder Deichen, wo Schafe grasten, gepflückt und achtlos wieder fallen lassen oder einer Kuh unters Maul gehalten. »Das wären dann fünfunddreißig Euro«, sagte die Verkäuferin und wickelte den Strauß in Seidenpapier. Sie weiß noch genau, dass sie sich anstrengte, nicht überrascht oder erschrocken zu wirken, denn sie hatte nicht genug Geld dabei, auch keine Karte, sie musste nach Hause, den Rest holen. Auf dem Weg fühlte sie sich hintergangen, nicht allein wegen der Summe, auch wegen der Zinnwannen und Butterblumen. Sie nahm sich vor, sobald wieder Sommer wäre, einen Ausflug zu machen, irgendwohin, wo Butterblumen wuchsen. Sie würde eine samt Wurzel ausgraben und mit nach Hause nehmen. »Die findest du auch um die Ecke, in Baulücken oder auf Hundewiesen«, sagte Georg nur.
Er kaut noch, während er sich die Turnschuhe zubindet und seinen Mantel überzieht. Sie mag den dunkelblauen Wollstoff und die Knebelverschlüsse aus glänzendem Holz. Während er seinen Mantel zuknöpft, hängen ihm die Locken in die Stirn, vereinzelt schimmern graue Haare hervor, wie feine Drähte setzen sie sich von den dunklen ab. Er selbst scheint es noch nicht bemerkt zu haben, selten schaut er sich länger im Spiegel an, es sei denn, er rasiert sich oder benutzt Zahnseide, aber auch dann schaut er sich nicht wirklich an. Manchmal, wenn er aus der Dusche steigt und die Tür offen steht, betrachtet sie ihn und stellt sich vor, wie es in dreißig Jahren sein wird. Sie, Mitte sechzig, mit hängenden Wangen und praktischem Kurzhaarschnitt, nein, mit langen Haaren, schulterlang wenigstens noch. Er, über siebzig, nicht mehr schlank, sondern mager. Ihr Sohn, Anfang dreißig; die Alten, ich muss mal wieder die Alten besuchen, wird er denken, und sie, das Ehepaar, werden nicht merken, dass ihre Wirbelsäulen krumm geworden sind, aber Matti wird es sehen. Nein, so wird es nicht kommen. Georg, ein grauhaariger Junge im Dufflecoat. Isabell, die alte Dame mit dem Cello, etwas dünn der Zopf, aber noch rötlich und glänzend, weil sie ihre Friseurtermine einhält. Die Stunden am Cello werden den Rücken gerade halten und die Musik wird das Gesicht glätten, die Musik glättet auch die Gedanken, es gibt Stücke, die das können, sie wird nachher üben, sie wird sich für den Abend wappnen, leichthändig wird ihr Spiel heute Abend sein, leichthändig, sie würde es gern glauben. Georg umarmt sie von hinten und drückt ihr seinen Mund auf den Nacken, dann geht er. Während sie seine Schritte im Treppenhaus hört, nimmt sie Matti sein Lätzchen ab und hebt ihn aus dem Kinderstuhl. Die Teetasse in der einen Hand, Matti im anderen Arm, geht sie ins Wohnzimmer. Auf der Steppdecke lässt sie ihn herunter, sofort greift er nach seinen Stofftieren und Holzklötzen, in denen es knistert und rasselt. Sie legt sich zu ihm und schiebt sich ein Kissen unter den Kopf. Durch die Plane kann sie den blauen Himmel erahnen, ein klarer Novembertag. Sie denkt an Sommertage, als das Gerüst noch nicht stand, wenn die Sonne schien, öffnete sie die Fenster weit und legte sich auf den gewärmten Parkettboden, so döste sie, während Matti im Stubenwagen schlief. Sie fragt sich, wo die Handwerker bleiben, auf dem Gerüst knarrt sonst jeder ihrer Schritte.
Matti krabbelt auf ihren Bauch und will beschäftigt werden, sie hebt ihn in die Luft, sein Gesicht über ihrem, er macht zufrieden gurgelnde Geräusche, von seinen Lippen löst sich ein dicker Speichelfaden, dem sie nicht ausweicht. Noch einmal stemmt sie den kleinen schweren Körper so hoch sie kann, dann lässt sie ihn langsam herunter und legt ihn sich zurück auf den Bauch. Ihre Lippen bleiben an seiner weichen Kopfhaut. Sein Haar wächst spärlich, nur hinten und über den Ohren hat sich ein Kranz aus Flusen gebildet, die wild abstehen, als hätte ein Windstoß sie aufgebauscht. Professor Hastig nennen sie ihn deshalb.
Die Abwesenheit der Handwerker ist wie eine wertvolle Ruhepause. Sobald einer der Männer vor dem Fenster arbeitet, stören die Geräusche und sie fühlt sich beobachtet, beim Üben, beim Telefonieren, Windeln wechseln, beim Herumsitzen und vor sich Hinstarren. Sie sollte die Stille nutzen, und die Freiheit, nicht gesehen zu werden. Sie legt eine CD ein, etwas kleines, kurzes, Lied ohne Worte, das Cello von Jacqueline du Pré, einen Moment bleibt sie bewegungslos stehen, lauscht und denkt über diese Frau nach. Mit Anfang zwanzig ein Star, ein paar Jahre später an Multipler Sklerose erkrankt, schließlich ein vom Körper erzwungenes Abschiedskonzert, mit Anfang vierzig starb sie. Die Zeit, in der sie zu krank gewesen war, um den Bogen nur zu halten, war länger als die, in der sie alles konnte. Ihre Geschichte ist wie ein Konzentrat aller Träume, allen Glücks und aller Risiken dieses Berufs. Angewiesen auf den Körper und sich selbst ausgeliefert zu sein. Schaut sie sich Videos von Konzerten an, wirkt das Spiel der Frau, als folge sie einem Trieb, alles geschieht instinktiv; kindlich, mädchenhaft sind ihre Gesichtszüge, der Körper straff und doch natürlich und entspannt, als geschehe alles wie angeboren.
Sie schiebt die Flügeltür auf und geht ins andere Zimmer, vor der Küchenanrichte bleibt sie stehen, ihrem Erinnerungsschrank, wie sie die Anrichte nennt, seitdem sie mit Georg zusammenwohnt und in den Fächern und Schubladen Kleinigkeiten aus ihren Schuljahren und der Studienzeit aufbewahrt, Notizen, Fotos und Kassetten, auf denen sie ihr eigenes Spiel aufgenommen hat. Sie sollte sich einen alten Rekorder besorgen, um sich die Kassetten anzuhören, vielleicht wäre sie überrascht, wie gut sie während ihrer Ausbildung gespielt hat, wie unbedarft.
Und nun diese Angst.
Die Zuneigung zu ihrem Instrument muss davon unberührt bleiben.
Vor den Fotos an der Wand bleibt sie stehen. Ein Bild von ihr im Bett, sie schläft im Sitzen, ein Kissen im Rücken, und Matti, wenige Tage alt, an der Brust. Ihr eigener Körper und der des Säuglings wussten einvernehmlich, was zu tun war. Sie staunte über das Zusammenspiel, verliebt in das überlebensgierige Wesen, überrascht von dem, was ihr Körper konnte. Jacqueline du Pré spielt tiefe, satte Töne, den düsteren Takten wird der Refrain folgen, ein harmlos schönes Motiv. Sie hat Matti das Stück selbst oft vorgespielt, wenn er in seinem Stubenwagen lag. Der Refrain klingt wie ein Kinderlied. Sie betrachtet die geschlossenen Augen des Säuglings auf dem Foto. Ihr Körper ernährte ein Kind, und er brauchte dafür nicht einen einzigen Gedanken von ihr.
Das Zittern kommt, wenn es nicht kommen darf.
Denk an etwas anderes.
Das Zittern steckt in den Gedanken.
Von dort wandert es in die Hände.
Baden im Fluss. Dicht belaubte Zweige hängen über dem Ufer, ihre weiße Haut scheint durch das grünschwarze Wasser, es war ein früher Morgen in Südfrankreich, Georg und sie waren ein halbes Jahr zusammen und hatten ein kleines Haus gemietet. Sie wurde immer vor ihm wach und ging schwimmen. Sie erinnert sich an den Moment der Überwindung, noch warm und benommen vom Schlaf in den kühlen Fluss zu steigen. Bis zu den Schultern kauerte sie im Wasser und wippte auf den Zehen. Das Haar wirr hochgesteckt, der Blick träge, das Gesicht ernst, so fotografierte Georg sie. Er war ihr leise gefolgt und stand zwischen den Bäumen am Ufer. Sie hatte ihn gesehen, ließ sich aber nichts anmerken, tat weiterhin, als fühlte sie sich unbeobachtet, um den Moment in die Länge zu ziehen, die Situation gefiel ihr. Jacqueline du Prés Cello klingt streng und furchtlos; das Foto ist eine Liebeserklärung.
|3Das Telefon klingelt. Er schaut auf das Display seines Apparats, ja, ist für ihn; zwei Schreibtische gegenüber, der dritte quer, drei Telefone in der Mitte. Matthias und der Praktikant blicken kurz auf, Georg hebt ab und meldet sich.
»Guten Tag, mein Name ist«, kennt er nicht, sagt ihm nichts, »von der Agentur«, die helle Stimme spult etwas herunter und er hört nicht richtig hin.
»Und zwar«, so beginnen überflüssige Anrufe, Und-zwar-Sager wissen, dass sie stören. Sie rufen unaufgefordert an, wegen einer Marke oder eines Produkts, oder was immer sie anpreisen müssen, telefonieren eine Liste ab.
»Wir haben Ihnen eine Mail geschickt zum Thema erfrischende Cocktails mit Weinbrand. Mit raffinierten, aber einfachen Rezepten unseres Kunden –«, er löscht drei Mails, deren Betreffzeilen auf Spam hinweisen.
Die liebliche Stimme macht eine Pause. Sie scheint zu hoffen, dass er an dieser Stelle einsteigt – Ja, richtig, habe ich bekommen, die Rezepte, ich erinnere mich – toll! Er sagt aber nichts und wartet auf die übliche Frage.
»Haben Sie diese Mail bekommen?«
»Ich nehme es an.« Pause. Er lässt sie hängen, ein bisschen Spaß bringt es ihm sogar.
»Wir starten eine Offensive für unseren Kunden. Wir wollen, dass Weinbrand auch als exquisites Cocktailgetränk wahrgenommen wird. Wäre das redaktionell interessant für Sie?«
Er würde am liebsten auflegen, einfach so, ohne zu antworten.
»Ich glaube, das Thema ist nix für uns.«
»Wir bieten auch Gewinnaktionen für die Leser. Eine Flasche Weinbrand mit einem Cocktailset.«
»So was machen wir nicht, sorry.«
»Kann ich Ihnen trotzdem weitere Unterlagen und exklusives Fotomaterial schicken?«
»Warum?«
»Na ja, unsere Offensive möchte zeigen, dass Weinbrand auch in Cocktails toll schmeckt.«
»Nein, danke.«
»Ach so.«
»Einen schönen Tag noch.«
»Okay.«
Sie verabschiedet sich und legt auf. »Was war?«, murmelt Matthias und schaut weiterhin wie hypnotisiert auf seinen Bildschirm. Die Haare mit Gel frisiert, sie glänzen etwas. Jeden Tag ein weißes Hemd unter einem Kaschmirpulli. Dunkle Augenringe. Matthias kann seine Überstunden nicht mehr zählen. Ihm stünden mal wieder drei Wochen Urlaub als Ausgleich zu, mindestens. Als Ressortleiter würde er die natürlich nicht nehmen.
»Nichts, Weinbrand.«
Hunderte solcher Mails bekommen sie jeden Tag. Alles Mögliche landet bei ihnen, die Vermarktung für ein Mittel gegen Fußpilz, für eine neue Schokolade oder schamlos teure Fahrräder, als wäre ihr Gesellschaftsressort das Schaufenster eines Kaufhauses. Auf dem Po, durch den Po. Vor einigen Tagen las Matthias diese Betreffzeile vor, sichtlich beglückt über den frisch eingetroffenen Bullshit. »Rate, worum es geht.«
Georg versuchte es, Stringtangas, Sexspielzeug, schlug er vor, nix, falsch, Matthias schüttelte den Kopf. Was Pharmazeutisches, ein Mittel gegen Hämorrhoiden, oder ein Toilettenaufsatz eines Sanitärherstellers, Georg hing in niederen Assoziationswelten fest und gab auf. Matthias legte eine Kunstpause ein, bevor er die Lösung verriet. Eine Fahrradtour durch die Po-Ebene. »Auf dem Po – durch den Po! Ist das nicht wunderschön?«
Georg setzt seine Kopfhörer auf, öffnet ein neues Dokument und schaltet sein Diktiergerät ein. Er muss das Interview morgen fertig haben. Den jungen Landwirt traf er auf einem Ideenkongress in Berlin. Ein Typ, der Agrarmaschinen entwickelt hat und Investoren für die Produktion sucht. Seine Maschinen sind einfach zu bedienen und nicht für die Industrie gedacht, sondern für Selbstversorger. Fünf, sechs oder zehn Familien kaufen gemeinsam Land und dazu die Ausrüstung, damit sie genug anbauen können, um dreißig bis vierzig Menschen zu ernähren. Die Idee überzeugt ihn.
Seitdem er Vater ist, hat er ein Auge für den Kooperationswillen junger Familien. Der Wille lässt sich überall beobachten, selbst in einem Umfeld wie seinem, in dem sich niemand etwas teilen muss, um durch den Alltag zu kommen. Es fängt schon beim Urlaub an, drei Kollegen von ihm bilden seit Jahren ein Team, weil sie sich nur gemeinsam die Finca mit Pool und Strandlage in Andalusien während der Ferienzeit leisten können. Sie kochen gemeinsam, einer von ihnen achtet auf die spielenden Kinder, und wenn ein Paar abends ausgehen will, sind die anderen da, um aufzupassen. Urlaub mit anderen Familien, er weiß nicht, ob er dafür bereit ist. Er fremdelt mit seiner neuen Umgebung, mit Spielplätzen und Babyschwimmen, nicht, weil er keine Lust hat, mit Matti in der Sandkiste zu sitzen oder ihn durch das Wasser zu tragen, nein, ihm sind die anderen Väter suspekt. Ihre Stimmen klettern einige Tonlagen nach oben, wenn sie mit ihren Kindern sprechen. Wenn sie einem Zweijährigen pädagogisch vorbildlich erklären, dass andere Kinder nicht in die Wange gebissen werden wollen, nein, möchten, es heißt möchten.
Die Vorstellung, etwas anzubauen gefällt ihm. Er sitzt auf einem Traktor und zieht einen kleinen Pflug über den Acker. Matti dabei auf dem Schoß. Im Hintergrund geht die rote Sonne unter und durch die Luft schwirren fiepend die Schwalben.
Gemüsebeete auf dem Dach oder ein Bienenstock im Hinterhof wären nicht mehr als eine niedliche Reaktion auf das Bewusstsein um die zukünftige Versorgungsproblematik, sagt der Maschinenerfinder.
Georg versucht sich diese Zukunft vorzustellen. Sollten Energie und Rohstoffe wie Getreide immer teurer werden, wäre ein Gemüsegarten die beste Altersvorsorge. Man sollte ein Haus mit Land kaufen, besser noch, einen Bauernhof.
Er öffnet seinen Explorer und geht ins Immobilienportal. In die Suchmaske gibt er Schleswig-Holstein ein und klickt auf Häuser kaufen. Er wählt Dithmarschen und Nordfriesland aus, Nordseenähe. Die sanierten Reetdachkaten für eine halbe Million übergeht er. Nach den Schnäppchen sucht er, alles unter Hunderttausend. Resthöfe mit riesigen maroden Scheunen, in denen sich jeder Handgriff verlieren würde. Trostlose Häuser mit feuchten Wänden und kaputten Dächern. Zwei Objekte sehen gut aus, gepflegte Höfe mit modernen Heizsystemen, doch sie liegen an einer Bundesstraße. Er ändert die Summe, geht nun bis Zweihunderttausend. Er möchte gut erhaltene Häuser sehen, mit gesunden Dächern und ohne vergilbte Tapeten, unter denen es bröckelt. Er möchte Fotos von hellen Zimmern sehen, anregende Bilder, die nicht nach Problemen und Hindernissen aussehen. Eine Villa aus dem Jahr 1902, weiß verputzt, efeubewachsen, mit altem Baumbestand im Garten. Das Grundstück umfasst über fünftausend Quadratmeter. Sieben Zimmer, Diele, zwei Salons mit Verbindungstür und Kachelöfen, eine große Küche, Terrassentür in den Garten und die Kuhweide dahinter. Er stellt sich das vor: früh aufstehen, Teewasser aufsetzen, ins Grün schauen, Frühstück decken, die Räume mit einer großen, lauten Familie füllen, kein Geld für Wegwerfspielzeug ausgeben, die Natur ist der Spielplatz, Solaranlage aufs Dach, Kartoffeln setzen, Kartoffeln ernten.
Noch einmal klickt er durch die Fotos. Mit seinem Ersparten könnte er gerade einmal die Grundsteuer zahlen. Er öffnet ein neues Fenster und gibt das Dorf in der Nähe der Villa ein. Achthundert Einwohner, keine Schule, kein Kindergarten. Isabell, Georg und Matti allein auf dem Land.
Die ersten Wochen wären wie Urlaub. Sie würden die Umgebung entdecken und das Andere, das andere Leben, willkommen heißen. Nach einiger Zeit würde sich das Gefühl abnutzen. Sie würden darüber nachdenken, dass es kein Programmkino in der Nähe gibt und auch keinen Sushi-Lieferanten. Was würde Isabell machen? Musikworkshops für Kinder und Erwachsene geben?
Nach und nach arbeitet er sich die Preisspanne der Häuser hoch, bleibt nun doch dort hängen, wo es teurer wird, und wandert zweimal durch die Zimmer eines historischen Landhauses, das von einem Architekten ausgebaut wurde. Da gibt es keine handwerklichen Probleme, keine optischen Störfaktoren, keine Hindernisse, die Räume sehen hell und schön aus, ideal geradezu, um sofort einzuziehen.
4| Die Pause der Handwerker wird bald vorbei sein und Matti brüllt vor Müdigkeit. Bevor die Männer wieder auf dem Gerüst stehen und mit Metallwerkzeug gegen die Wand schlagen, muss er zur Ruhe kommen. Wenn er erst eingeschlafen ist, weckt ihn auch der Baulärm nicht und sie kann Cello üben.
Die Erkenntnis, keinen Einfluss auf den Lärm und die Launen ihres Kindes zu haben, macht sie noch ungeduldiger; die Zeit zum Üben hängt am seidenen Faden, Matti liegt wie ein verkrampftes Bündel in ihren Armen und sie wiegt ihn, trägt ihn vom Kinderzimmer langsam durch den Flur ins Wohnzimmer und wieder zurück, doch er wehrt sich gegen die Ruhe, die sie ihm aufzwingen will, drückt sich mit seinen Ärmchen von ihrem Körper ab, will nicht gehalten, will nicht ins Bett gelegt werden. Sein Atem riecht sauer, nach Erschöpfung und Zorn. Beide sind sie erschöpft und zornig, »sei still«, spricht sie leise in sein Ohr, »sei doch still, bitte«, der letzte Funken Fürsorglichkeit verglimmt, sein Geschrei verschlingt jedes ihrer Worte. Wieder im Wohnzimmer. Er weint heiser und ohne Tränen, sie kann tief in seinen Mund sehen, das Zäpfchen im Rachen hebt und senkt sich. Sei endlich still.
Mit dem Fuß stößt sie gegen den leeren Cellokoffer, das Instrument liegt auf der Seite neben dem Stuhl bereit, und Matti brüllt in Wellen, atmet Luft ein, stößt Schreie aus. Sie drückt ihn an sich, will nur, dass Ruhe ist, sie wandert von der Tür zum Fenster, wieder zurück, im Zimmer umher. Das glänzende Holz, die geschwungene Form, den langen Hals im Augenwinkel, auch das Cello bedrängt sie.
Wieder stehen sie im Kinderzimmer, du musst mich jetzt lassen, du musst, sie wird ihn beschimpfen, ihr wird die Stimme entgleiten, sie presst die Lippen zusammen und legt ihn ins Bett, legt ihn ab wie ein schweres Paket, das sie lange genug mit sich herumgetragen hat. Sein Geschrei wird kehlig und schrill, er windet sich und dreht sich auf alle viere, sie verlässt das Zimmer, schließt die Tür und geht, erschrocken von ihrer Kälte. Die andere Seite der Wohnung ist gerade weit genug von ihm entfernt, auch dort schließt sie die Tür. Sie hebt das Cello vom Boden, setzt sich und beginnt zu spielen. Doch der Klang kommt gegen das Weinen aus dem Kinderzimmer nicht an. Getrieben von ihrer Wut auf den kommenden Abend, auf alles, spielt sie das Solo einmal durch. Obwohl sie sich schäbig fühlt, oder gerade deshalb, steckt in den Händen pure Entschlossenheit, du musst. Noch einmal spielt sie die Sequenz, diesmal mit mehr Tempo. Sie hört, wie Matti ruckartig Schluchzer ausstößt, stellt sich vor, wie er von ihnen geschüttelt wird. Verquollene Augen. Kleiner Körper im Gitterbett. Jetzt brüllt er wieder. Sie könnte aus der Wohnung auf die Straße laufen, und noch weiter, bis in den Park, und auch dort würde sie sein Weinen durch das Gewirr der Straßengeräusche hören. Sie würde es überall hören.
Um hart zu bleiben, stellt sie sich ein Ultimatum, wenn sie das Solo noch einmal bis zum Ende durchspielt, hat sie es überwunden, es, wie sie es auch nennen mag, was da abends mit ihren Händen geschieht. Doch mittendrin setzt sie den Bogen ab, legt ihn auf den Notenständer und hält sich die Ohren zu. Worum kämpft sie hier? Eine unerhörte Sehnsucht packt sie auf einmal, als wolle ihr jemand den Jungen nehmen. Sie legt das Cello auf den Boden, reißt die Tür auf und läuft zurück ins Kinderzimmer. Dort hebt sie Matti aus dem Bett und drückt ihn an sich. Vor Überraschung wimmert er nur noch, doch fasst sich wieder und beginnt von Neuem zu weinen. Sie schämt sich, wird es wiedergutmachen, wird ihm alle Zeit geben, die er braucht.
Sie trägt ihn zurück ins Wohnzimmer und stellt sich vor die Fotowand, um ihm etwas über die Bilder zu erzählen, einfach erzählen, erzählen und nicht mehr daran denken, wann sie üben darf.
Ihre Stimme ist leise, was sie sagt, spielt keine Rolle, ihre Stimme genügt Matti, und um den Faden nicht abreißen zu lassen, weckt sie die Erinnerungen an die Momente auf den Bildern, an alles, was mit ihnen zusammenhängt, und redet Matti mit Erinnerungen in den Schlaf. »Da sitzt das zwölfjährige Mädchen an seinem Schreibtisch, verschränkt die Arme und guckt trotzig.« Aufgewachsen in einer Reihenhaussiedlung, doch ihre Mutter hielt es dort nicht aus, ohne den Vater zogen sie hierher, in diese Wohnung; ihre monotone Stimme legt sich über die eigene Ungeduld. Matti hat aufgehört zu schreien und streckt den Finger aus, er scheint zu verstehen, dass es um die Fotos geht. »Hier waren früher die Häuser grau und beschmiert, und vor dem Kiosk an der Kreuzung hatte ein Grüppchen Punks seinen Stammplatz.« In der Wohnung unter ihnen hauste ein zahnloser Rentner ohne Heizung und ohne Dusche, er war der Letzte, der Briketts aus dem Keller holte. Sie fürchtete sich vor einer Clique Jungs, die anderen ihre Jeansjacken, Turnschuhe und das Taschengeld abnahmen. An den Wochenenden übernachtete sie bei ihrer Freundin in ihrer alten Nachbarschaft, wo alles seine Ordnung hatte, die Väter abends ihre Gärten wässerten und jeder die Berufe, Kinder und Urlaubspläne des anderen kannte. Obwohl sie heute nicht mehr dort leben wollte, kann sie sich gut an das Gefühl von Verlust erinnern, sie erzählt Matti von dem Fahrrad. »Ich ließ die Luft aus den Reifen, riss an der Kette und steckte Zweige zwischen die Speichen.« Sie beschmierte den dunkelrot glänzenden Rahmen mit Dreck. »Ich war böse auf die Nachmieter meines Hauses, eine Familie mit einem Mädchen in meinem Alter, das vielleicht nun in meinem Zimmer wohnte.« Das Mädchen sollte wenigstens ein kaputtes Fahrrad haben und sich fragen müssen, wer das getan hatte. Weiter, weiter, Mattis Kopf wankt müde, das ist gut, sie ärgerte die Familie mit anonymen Anrufen, die Nummer wählen, warten, bis jemand abhob und auflegen. Telefonnummern wurden damals nicht übertragen, sie war wirklich anonym. »Nach einer Weile traute ich mich mehr, und sagte der Mutter von dem Mädchen, Ihre Tochter hat geklaut, oder Der Vater sitzt im Auto und trinkt Schnaps!« Solche Ideen sprudelten aus ihr heraus und sie knallte danach den Hörer auf. Es hatte in der Straße wirklich einen Mann gegeben, der abends in seinem eierschalenfarbenen Mercedes saß und trank, aber er hatte mit der Familie nichts zu tun.
Mattis Kopf sinkt auf ihre Schulter, dann richtet er sich wieder auf, sie hat es noch nicht geschafft. Die Punks vor dem Kiosk sind verschwunden, bis auf drei, vier Männer mit ihren Hunden. Wohnungen ohne Heizung und Dusche gibt es nicht mehr, und Fassaden mit über Jahre gewachsener Abgaspatina auch nicht. Nur noch dieses Haus wartet hinter der Plane auf seine Verwandlung.
Am Fenster gehen zwei Maurer vorbei, bitte nicht, denkt sie, bitte nicht jetzt