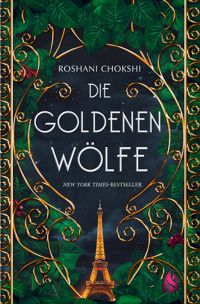
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die goldenen Wölfe
- Sprache: Deutsch
Ein Team aus talentierten Schatzjägern begibt sich zur Zeit der Pariser Weltausstellung 1889 auf die Suche nach einem überaus kostbaren Artefakt. Und was sie finden werden, dürfte die Welt verändern … Der New York Times-Bestseller von Roshani Chokshi ist laut 'Booklist' eine "faszinierende Welt voller Kraft und Magie".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Roshani Chokshi
Die goldenen Wölfe
Aus dem amerikanischen Englisch von Hanna Christine Fliedner und Jennifer Thomas
Für Aman, der gesagt hat:
»Schreib irgendwas Cooles über mich.«
Nope.
Fléctere si néqueo súperos, Acheronta movebo!
Kann ich die Himmlischen nicht beugen, versetze ich die Unterwelt in Aufruhr!
VERGIL
• • • • •
Es waren einst vier Häuser Frankreichs.
Wie alle Häuser des Ordens von Babel schworen sie, das Wissen um den Verbleib ihres Babelfragments zu hüten, Quell aller Schmiedekunst.
Schmieden galt als Gabe der Schöpfung, übertroffen lediglich von der Macht Gottes selbst.
Doch ein Haus fiel.
Und die Blutlinie eines anderen versiegte ohne Erben.
Was bleibt, ist ein Geheimnis.
Prolog
Die Matriarchin des Hauses Kore verspätete sich. Unter normalen Umständen machte sie sich nichts aus Pünktlichkeit. Denn Pünktlichkeit, mit diesem unziemlichen Hauch von Übereifer, war etwas für das gemeine Volk. Und weder war sie Teil des gemeinen Volkes noch besonders erpicht darauf, ein Souper mit diesem Mischlingserben von Haus Nyx über sich ergehen zu lassen.
Wenn sie allerdings noch später käme, hätte das nur Gerede zur Folge. Weit lästiger und unziemlicher noch als Pünktlichkeit.
»Was dauert da so lange?«, rief sie durch das Vestibül.
Sie schnipste ein unsichtbares Staubkörnchen von ihrer neuen Robe. Das Kleid war aus feinster Seide, entworfen von den Couturiers bei Raudnitz & Cie an der Place Vendôme im ersten Arrondissement. Über Turnüre und Tüllschleppe zog sich ein Geflecht aus Efeuranken und Butterblumen, die im Kerzenlicht ihre Blüten öffneten. Lilien aus Taft bewegten sich im blauen Seidenstrom des Saumes auf und nieder. Die Schmiedearbeit war makellos. Was man allerdings bei dem exorbitanten Preis auch erwarten konnte.
Der Kutscher reckte seinen Kopf durch den Vordereingang. »Ich bitte Madame vielmals um Verzeihung. Es kann sich nur noch um wenige Augenblicke handeln.«
Die Matriarchin wedelte verächtlich mit der Hand. Licht brach sich in ihrem Babelring, einem Kranz aus Dornen, den ein blaues Leuchten durchzog. Seit dem Tag, an dem sie sich erfolgreich gegen Familienmitglieder und innerhäusliche Rivalen durchgesetzt hatte, war der Ring untrennbar an sie als neue Matriarchin von Haus Kore gebunden. Ihr war durchaus bewusst, dass ihre Nachkommen und einige andere Angehörige des Hauses die Tage zählten, bis sie starb und den Ring weitergab. Doch noch war sie dazu nicht bereit. Und bis es so weit war, wussten nur sie und der Patriarch des Hauses Nyx um das Geheimnis des Rings.
Als sie die Tapete berührte, leuchtete sachte ein Symbol im goldenen Muster auf: ein Dornenkranz. Sie lächelte. Wie jeder einzelne Gegenstand ihres Haushaltes war auch die Tapete hausgezeichnet.
Nie würde sie vergessen, wie sie zum ersten Mal das Emblem des Hauses auf einem Artefakt hinterlassen hatte. Die Macht des Rings verlieh ihr das Gefühl, eine Göttin in Menschengestalt zu sein. Das war allerdings nicht immer der Fall. Gestern hatte sie die Hauszeichnung von einem Objekt entfernt. Nicht, dass sie es gewollt hätte, aber für die Ordensauktion war es unumgänglich und mit manchen Traditionen ließ es sich schlecht brechen …
Zu ihnen gehörte auch, ab und an das Souper mit dem Oberhaupt eines anderen Hauses einzunehmen.
Die Matriarchin lief auf das offene Tor zu und blieb auf der Türschwelle aus Granit stehen. Durch die kalte Nachtluft schlossen sich die seidenen Blüten auf ihrem Kleid.
»Die Pferde werden doch jetzt wohl angeschirrt sein?«, rief sie durch die Nacht.
Der Kutscher antwortete nicht. Sie zog sich ihre Stola fester um die Schultern und trat einen Schritt vor. Da stand die Kutsche, mit den wartenden Pferden … Aber wo war der Kutscher?
»Mein Gott, hat denn die Seuche der Inkompetenz jeden meiner Domestiken niedergestreckt?«, murmelte sie und lief auf die Pferde zu.
Selbst ihr Kurier, der lediglich einen Gegenstand im Auktionshaus des Ordens hätte abliefern sollen, hatte versagt. Seiner Liste klar umrissener Aufgaben hatte er offenbar eigenmächtig eine hinzugefügt: Sich spektakulär zu betrinken, ausgerechnet im L’Éden, dieser pseudoaristokratischen Spelunke von einem Hotel.
Neben dem Wagen sah die Matriarchin nun den Kutscher mit dem Gesicht nach unten im Kies liegen. Sie zuckte zurück. Ganz plötzlich war kein Laut mehr zu hören, nicht einmal das Stampfen der Pferdehufe. Stille senkte sich wie ein scharfes Beil über die Auffahrt.
Wer ist da?, wollte sie fragen, doch die Worte fielen tonlos in sich zusammen.
Beunruhigt trat sie einen Schritt zurück. Das Geräusch ihrer Sohlen auf dem Kies wurde verschluckt, als wäre sie unter Wasser. Sie rannte zur Tür, hatte den tröstlichen Schein des Kronleuchters aus dem Vestibül fast erreicht. Für einen Moment glaubte sie sich in Sicherheit. Dann verfing sich ihr Absatz im Saum des Kleides. Sie stolperte. Doch nicht der Boden kam ihr entgegen.
Sondern ein Messer.
Sie sah die Klinge nicht, spürte nur den scharfen Druck, als der Gegenstand mühelos in ihren Finger drang. Sie fühlte, wie ihre Knochen nachgaben, eine warme Flüssigkeit ihr über Handfläche und Unterarm lief und ihren teuren Trompetenärmel besudelte. Jemand nahm ihr unwirsch den Ring vom Finger. Die Matriarchin von Haus Kore hatte nicht mal Zeit, nach Luft zu schnappen.
Vor ihren weit aufgerissenen Augen glitten geschmiedete Mottenlichter mit Flügelchen aus smaragdgrünem Glas über die Decke. Einige ließen sich dort nieder, wie schläfrige Sterne.
Aus dem Augenwinkel sah sie noch den massiven Knüppel auf sich zukommen.
TEIL I
Aus den Archiven des Ordens von Babel
Die Anfänge des Imperiums
Großmeister Emanuele Orsatti, Haus Orcus der Italienischen Fraktion
Im Jahre 1878 unter der Herrschaft Königs Umbertos I.
Die Kunst des Schmiedens ist so alt wie die Zivilisation selbst. Nach den uns vorliegenden Übersetzungen schrieben Imperien aus alter Zeit den Ursprung der Schmiedegabe verschiedenen mythischen Artefakten zu. In Indien glaubte man etwa, sie entspringe dem Krug des Schöpfergottes Brahma. Die Perser führten sie auf den mythischen Kelch des Dschamschid zurück … und so fort.
Ihre Vorstellungen – so lebhaft wie auch bildreich – sind falsch.
Die Schmiedekunst entspringt der Präsenz der Babelfragmente. Obgleich niemand die genaue Anzahl der Fragmente kennt, ist es die Überzeugung dieses Autors, dass Gott es für recht hielt, nach der Zerstörung des Turmes zu Babel (1. Buch Mose, 11: 1-9) wenigstens fünf Fragmente zu zerstreuen. Wo die Fragmente niedergingen, wuchsen Hochkulturen: Die Ägypter und Afrikaner am Nil, Hindus im Industal, die Orientalen am Gelben Fluss, Mesopotamier an Euphrat und Tigris, die Maya und Azteken in Mesoamerika und die Inka in den Anden. Und so begann dort die Schmiedekunst auf ganz natürliche Art und Weise zu florieren.
Die ersten Aufzeichnungen über das Fragment des Westens sind auf das Jahr 1112 datiert. Unsere Ahnen und Brüder, die Tempelritter, brachten uns ein Babelfragment aus dem Heiligen Land und betteten es in unseren Boden. Seitdem hat die Schmiedekunst einen schier unvergleichlichen Grad der Entwicklung erreicht. Für diejenigen, die mit der Schmiedegabe gesegnet sind, ist es ein göttliches Erbe, wie jedes Talent. Denn so, wie wir nach Seinem Ebenbild geschaffen wurden, spiegelt auch die Schmiedekunst die Schönheit Seiner Schöpfung wider. Schmieden bedeutet nicht nur, eine Schöpfung zu veredeln, sondern ihr eine neue Form zu verleihen.
Es ist die heilige Pflicht des Ordens, diese Fähigkeit zu hüten, unsere heilige und gottgewollte Aufgabe, das Wissen um den Ort des Westlichen Babelfragments zu schützen.
Würde uns diese Macht entrissen, wäre dies, so fürchte ich, das Ende der Zivilisation.
Séverin
Eine Woche zuvor …
Séverin warf einen Blick auf die Uhr: noch zwei Minuten.
Um ihn herum standen maskierte Mitglieder des Ordens von Babel, die hinter vorgehaltenen weißen Fächern tuschelten, während sie gespannt auf die letzte Auktionsrunde warteten.
Séverin legte den Kopf in den Nacken. Von der mit Fresken übersäten Decke starrten längst verstorbene Götter auf die Menschenmenge herab. Er bemühte sich vergebens, den Wänden keine Beachtung zu schenken. Wo er auch hinsah, prangten die Embleme der zwei noch bestehenden Häuser der Französischen Fraktion. Halbmonde für Haus Nyx. Dornen für Haus Kore.
Die anderen beiden Embleme waren sorgfältig aus dem Muster entfernt worden.
»Meine sehr verehrten Damen und Herren des Ordens, unsere Frühlingsauktion neigt sich dem Ende«, verkündete der Auktionator. »Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme an dieser außergewöhnlichen Transaktion. Wie Sie bereits feststellen durften, konnten die Objekte des heutigen Abends von weit entlegenen Schauplätzen zu uns gebracht werden – aus den Wüsten Nordafrikas und den schillernden Palästen Indochinas. Noch einmal möchten wir uns bei den beiden Häusern Frankreichs bedanken und ihre Bereitschaft honorieren, Gastgeber dieser Frühlingsauktion zu sein. Ehre, Haus Nyx. Ehre, Haus Kore.«
Séverin hob die Hände, applaudierte aber nicht. Die lange Narbe auf seiner Handfläche schimmerte silbern im Licht des Kronleuchters – eine Erinnerung an das Erbe, das man ihm verwehrt hatte.
Als letzter Angehöriger der Montagnet-Alarie-Linie und Erbe von Haus Vanth flüsterte Séverin dennoch: Ehre, Haus Vanth.
Vor zehn Jahren hatte der Orden die Blutlinie von Haus Vanth für ausgestorben erklärt.
Der Orden hatte gelogen.
Während der Auktionator sich in einer ausgedehnten Rede über die heiligen und beschwerlichen Pflichten des Ordens erging, berührte Séverin seine gestohlene Maske. Sie bestand aus einem Geflecht metallischer Dornen und Rosen, die mit Raureif überzogen und so geschmiedet waren, dass das Eis nie schmolz und die Rosen nie verwelkten. Die Maske gehörte dem Kurier von Haus Kore, der – falls Séverin die richtige Dosis verwendet hatte – noch sabbernd in einer großzügigen Suite seines Hotels, des L’Éden, liegen musste.
Gemäß seinen Informationen musste das Objekt, für das er hergekommen war, jeden Moment zur Auktion freigegeben werden. Er wusste schon, was als Nächstes passierte. Es würde zaghafte Gebote geben, aber Vermutungen zufolge hatte Haus Nyx diese Runde schon im Voraus für sich entschieden. Doch auch wenn Haus Nyx gewann, würde das Artefakt mit Séverin nach Hause gehen.
Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln und er hob die Hand. Sofort löste sich ein Glas aus dem Champagnerlüster über ihm und schwebte auf ihn zu. Er setzte es an die Lippen, nippte aber nicht daran, sondern prägte sich über den Glasrand hinweg noch einmal den Aufbau des Ballsaals und die Ausgänge ein. Perlmuttfarbene Macarons, kunstvoll arrangiert in Form eines gigantischen Schwans, kennzeichneten den Ostausgang. Dort stand auch Hypnos, der junge Erbe von Haus Nyx, und stürzte seinen Champagner hinunter, bevor er die Hand für das nächste Glas hob. Das letzte Mal hatte Séverin mit Hypnos gesprochen, als sie Kinder gewesen waren. Damals waren sie eine Mischung aus Spielkameraden und Rivalen gewesen, denn beide hatten eine fast identische Erziehung genossen, dazu bestimmt, die Ringe ihrer Väter zu übernehmen.
Doch das war eine Ewigkeit her.
Séverin löste den Blick von Hypnos und ließ ihn über die lapislazuliblauen Säulen am Südausgang wandern. Der Westausgang wurde von vier bewegungslosen Sphinxwächtern flankiert. Gekleidet in feine Anzüge, trugen sie vor dem Gesicht die für sie charakteristischen Krokodilsmasken. Sie waren der Grund dafür, dass niemand dem Orden etwas stehlen konnte. Ihre Masken konnten die Spur eines jeden Gegenstands, der durch die Ringe der Matriarchinnen und Patriarchen hausgezeichnet war, aufnehmen und verfolgen.
Doch Séverin wusste, dass alle Artefakte ungezeichnet zur Auktion kamen und erst nach der Versteigerung, wenn ihr neuer Besitzer sie abholte, hausgezeichnet wurden – was ein wertvolles Zeitfenster eröffnete, in dem man das Objekt stehlen konnte. Und niemand, nicht einmal eine Sphinx, würde herausfinden, wohin es verschwunden war.
Ein Objekt ohne Hauszeichnung blieb jedoch nicht ohne jeglichen Schutz.
Schräg gegenüber von Séverin, am Nordende, lag der Verwahrungssaal – der Ort, an dem alle ungezeichneten Objekte auf ihre neuen Eigentümer warteten. Vor dem Eingang kauerte ein riesiger Löwe aus Quarz. Sein Kristallschwanz klatschte immer wieder träge auf den Marmorboden.
Ein Gong ertönte. Gerade war ein hellhäutiger Mann hinter das Podium auf die Bühne getreten.
»Wir sind hocherfreut, Ihnen unser letztes Objekt präsentieren zu dürfen. Der Kompass wurde zu Zeiten der Han-Dynastie geschmiedet und 1860 aus dem Sommerpalast in China geborgen. Dieses Objekt ermöglicht eine Navigation anhand der Sterne und die Unterscheidung von Wahrheit und Lüge«, sagte der Auktionator. »Er misst zwölf mal zwölf Zentimeter und wiegt 1,2 Kilogramm.«
Über dem Kopf des Auktionators flirrte ein Hologramm des Kompasses, ein viereckiges Stück Metall mit einer kreisförmigen Rille in der Mitte. Die Seiten waren mit chinesischen Schriftzeichen versehen, die in das Metall eingestanzt waren.
Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten waren beeindruckend. Allerdings war es nicht der Kompass an sich, der Séverins Interesse weckte, sondern die Schatzkarte, die sich in seinem Inneren verbarg. Aus dem Augenwinkel sah er, dass Hypnos begeistert in die Hände klatschte.
»Das Mindestgebot liegt bei fünfhunderttausend Franc.«
Ein Herr der Italienischen Fraktion hob seinen Bieterfächer.
»Fünfhunderttausend an Monsieur Monserro. Höre ich …?«
Hypnos hob die Hand.
»Sechshunderttausend«, sagte der Auktionator. »Sechshunderttausend, zum Ersten, zum Zweiten …«
Die Ordensmitglieder nahmen ihre Gespräche wieder auf. Allein der Versuch, in einer von vornherein entschiedenen Runde zu bieten, war sinnlos.
»Verkauft!«, rief der Auktionator mit aufgesetzter Begeisterung. »An Haus Nyx, für sechshunderttausend Franc. Patriarch Hypnos, bitte schicken Sie nach Beendigung der Auktion Ihren Hauskurier und den zuständigen Dienstboten in den Verwahrungssaal zur üblichen achtminütigen Begutachtung. Das Objekt wird in dem dafür vorgesehenen Träger bereitliegen, wo Sie es anschließend mit Ihrem Ring hauszeichnen können.«
Séverin wartete noch einen Augenblick, dann ließ er sich entschuldigen. Forschen Schrittes ging er am äußeren Rand des Atriums entlang, bis er den Quarzlöwen erreichte. Hinter dem gigantischen Tier erstreckte sich ein düsterer, von Marmorsäulen gesäumter Korridor. Gleichgültig richteten sich die Augen des Quarzlöwen auf ihn, und Séverin widerstand dem Drang, die gestohlene Maske zu berühren. Als Kurier von Haus Kore verkleidet, war es ihm möglich, den Verwahrungssaal zu betreten und ein Objekt für genau acht Minuten zu berühren. Hoffentlich reichte die gestohlene Maske, um den Löwen zu passieren. Wenn der Löwe allerdings zur Verifizierung nach seiner Katalogmünze fragte – eine geschmiedete Münze, die den Standort jedes einzelnen Gegenstands im Besitz von Haus Kore kannte –, wäre er tot. Er hatte das verflixte Ding am Körper des Kuriers nirgends finden können.
Séverin verneigte sich vor dem Quarzlöwen und hielt in stiller Erwartung inne. Der Löwe reagierte nicht. Sein durchdringender Blick brannte sich in seine Kopfhaut, während die Sekunden verstrichen. Ihm fiel das Atmen immer schwerer. Er verabscheute den Hunger nach diesem Artefakt. Es gab so viele Dinge, nach denen er sich verzehrte, dass er schon befürchtete, in seinen Gedanken keinen Platz mehr für irgendetwas anderes zu haben.
Séverin hob den Blick nicht vom Boden, bis er das Geräusch hörte – das Knirschen von Steinen, die sich neu zusammensetzten. Er stieß den Atem aus. Seine Schläfen pochten, als die Tür zum Verwahrungssaal erschien. Ohne Einwilligung des Löwen wäre die geschmiedete Tür unsichtbar geblieben.
Entlang der Wände des Verwahrungssaals ragten Marmorstatuen verschiedener Götter und mythischer Kreaturen aus den Nischen hervor. Séverin ging schnurstracks auf einen fauchenden Minotaurus zu und setzte sein Taschenmesser unterhalb der geblähten Nüstern an. Der warme Atem der Statue ließ die geschmiedete Klinge beschlagen. In einer geschmeidigen Bewegung zog Séverin die Schneide des Messers von oben nach unten durch Kopf und Körper der Statue. Der Marmor zischte und dampfte, als die Figur in der Mitte aufbrach und sein Historiker daraus hervorstolperte. Mit voller Wucht prallte er gegen Séverin. Enrique schnaufte und schüttelte sich.
»Ihr habt mich in einen Minotaurus gesteckt? Hätte Tristan nicht irgendeinen gut aussehenden griechischen Gott als Versteck wählen können?«
»Seine Gabe gilt flüssiger Materie. Mit Stein tut er sich schwer«, sagte Séverin und steckte sein Taschenmesser wieder ein. »Es standen nur der Minotaurus und eine mit Stierhoden verzierte etruskische Vase zur Auswahl.«
Enrique erschauderte. »Also ehrlich. Wer guckt sich denn bitte eine Vase mit Stierhoden an und denkt sich: ›Hallo! Dich muss ich unbedingt haben‹?«
»Leute mit zu viel Zeit und Geld oder einer Vorliebe für Rätselhaftes.«
Enrique seufzte. »Alles, was ich mir je erträumt habe.«
Die beiden drehten sich zu den Schätzen um. Viele Objekte waren geschmiedete, altertümliche Relikte, auf die man bei Plünderungen von Tempeln und Palästen gestoßen war: Statuen und Schmuckstücke, Messgeräte und Fernrohre.
Am hinteren Ende des Saals starrte sie der Onyxbär von Haus Nyx an, finster und mit weit aufgerissenem Maul. Daneben schlug der Smaragdadler von Haus Kore mit den Flügeln. Tiere, die Ordensfraktionen aus aller Herren Länder repräsentierten, standen wachsam in Reih und Glied. Darunter waren ein brauner Bär aus Feueropal für Russland, ein Wolf aus Beryll für Italien und ein Adler aus Obsidian für das Deutsche Kaiserreich.
Enrique, der als Ordensdiener verkleidet war, zog ein viereckiges Metallstück hervor, das genauso aussah wie der Kompass, den Haus Nyx soeben ersteigert hatte.
Séverin nahm das gefälschte Artefakt entgegen.
»Ich warte immer noch auf mein Dankeschön«, grollte Enrique. »Die Forschung und der Nachbau haben ewig gedauert.«
»Es hätte nicht so lange gedauert, wenn du dich nicht ständig mit Zofia angelegt hättest.«
»Das war unvermeidlich. Sobald ich auch nur atme, würde deine Ingenieurin mir ja am liebsten eine Kriegsflotte auf den Hals hetzen.«
»Dann halt in ihrer Gegenwart den Atem an.«
»Nichts leichter als das«, sagte Enrique und verdrehte die Augen. »Das übe ich sowieso bei jeder Akquisitionsmission.«
Séverin lachte. Akquirieren war die Bezeichnung für seinen ganz besonderen Zeitvertreib. Es klang so … vornehm. Fast schon unverfänglich. Diese Gewohnheit hatte er dem Orden zu verdanken. Seitdem man ihm seinen Titel als Erbe von Haus Vanth aberkannt hatte, war er von sämtlichen Auktionen ausgeschlossen worden und konnte geschmiedete Antiquitäten nicht länger rechtmäßig erwerben. Allerdings wäre er so vielleicht auch nicht neugierig auf die Objekte geworden, von denen sie ihn eigentlich fernhalten wollten. Wie sich dann herausstellte, waren einige dieser Objekte früher im Besitz seiner Familie gewesen. Nachdem man die Montagnet-Alarie-Linie für ausgestorben erklärt hatte, war das gesamte Hab und Gut von Haus Vanth verkauft worden. In den Monaten nach seinem sechzehnten Geburtstag, als er seinen Anspruch auf das Familienvermögen geltend gemacht hatte, hatte Séverin sich jedes einzelne Objekt zurückgeholt und seine Akquisitionsdienste anschließend internationalen Museen und kolonialen Zünften angeboten – sämtlichen Vereinigungen, die zurückhaben wollten, was der Orden ihnen gestohlen hatte.
Wenn die Gerüchte über den Kompass stimmten, könnte er den Orden erpressen und die eine Sache akquirieren, die ihm noch fehlte: sein Haus.
»Du tust es schon wieder«, sagte Enrique.
»Was?«
»So diabolisch in die Ferne schauen. Was verschweigst du, Séverin?«
»Nichts.«
»Du und deine Geheimnisse.«
»Geheimnisse verleihen meinen Haaren diesen gewissen Glanz«, erwiderte Séverin und fuhr sich mit der Hand durch die dichten Locken. »Kanns losgehen?«
Enrique nickte. »Raumsicherung.«
Er warf eine geschmiedete Kugel hoch, die in der Luft hängen blieb. Ein Lichtstrahl schoss daraus hervor, glitt an den Wänden hinab und durchleuchtete die Objekte.
»Keine Aufzeichner vorhanden.«
Auf Séverins Nicken hin traten sie vor den Onyxbären von Haus Nyx. Er stand auf einem Podest, das Maul so weit aufgerissen, dass die rote Samtschatulle mit dem chinesischen Kompass wie ein reifer Apfel darin schimmerte. Hatte Séverin die Schatulle erst einmal berührt, blieben ihm weniger als acht Minuten, um sie wieder zurückzustellen. Sonst – sein Blick glitt über die blitzenden Zähne – würde die Bestie sie ihm gewaltsam entreißen.
Während Enrique eine Waage hervorholte, entfernte Séverin vorsichtig die rote Schatulle aus dem Maul des Bären. Zuerst wogen sie die Schatulle mit dem Originalkompass, dann markierten sie die Zahl, bevor sie das Original durch die Fälschung austauschten.
Enrique fluchte. »Weicht um Haaresbreite ab. Sollte aber funktionieren. Der Unterschied ist auf der Waage kaum auszumachen.«
Séverin biss die Zähne zusammen. Es spielte keine Rolle, ob er auf der Waage auszumachen war. Wichtig war, ob der Onyxbär den Unterschied bemerkte. Aber er war zu weit gekommen, um jetzt noch einen Rückzieher zu machen.
Séverin legte die Schatulle zurück ins Maul des Bären und schob sie immer weiter nach hinten, bis sein Handgelenk darin verschwand. Die Onyxzähne streiften seinen Arm. Die Kehle der Statue fühlte sich kühl und trocken an. Und viel zu unbeweglich. Seine Hand zitterte.
»Atmest du noch?«, flüsterte Enrique. »Ich jedenfalls nicht.«
»Wenig hilfreich«, brummte Séverin.
Jetzt war er schon bis zum Ellbogen drin. Der Bär stand starr da. Er blinzelte nicht einmal.
Warum hatte er die Schatulle noch nicht angenommen?
Ein Knirschen durchbrach die Stille. Ruckartig zog Séverin die Hand zurück. Zu spät. Im Handumdrehen hatten sich die Zähne des Bären verlängert und waren zu spitzen Gitterstäben geworden. Enrique warf einen kurzen Blick auf Séverins eingeklemmte Hand und wurde blass. »Mist.«
Laila
Laila schlüpfte in das Hotelzimmer des Kuriers von Haus Kore.
Mit dem ausrangierten Kleid eines Zimmermädchens, das sie aus der letzten Ecke des Lagerraums gekramt hatte, blieb sie am Türrahmen hängen. Sie zog daran, sodass die Naht aufriss.
»Na toll«, grummelte sie.
Wie die anderen Suiten im L’Éden war auch diese äußerst luxuriös ausgestattet. Das Einzige, was nicht so richtig ins Bild passte, war der bewusstlose Kurier, der bäuchlings in einer Pfütze aus Speichel auf dem Boden lag. Laila runzelte die Stirn.
»Die Rüpel hätten Sie ja wenigstens ins Bett legen können, Sie Armer.« Laila drehte ihn mit dem Fuß auf den Rücken.
Die nächsten zehn Minuten nutzte sie, um ein wenig zu dekorieren. Sie kramte alles Mögliche aus den Taschen ihrer Arbeitskleidung, warf Damenohrringe auf den Boden, drapierte zerschlissene Strümpfe über Lampen, durchwühlte das Bett und goss Champagner über die Laken. Anschließend kniete sie sich neben den Kurier.
»Als Abschiedsgeschenk«, sagte sie. »Oder Wiedergutmachung. Wie auch immer Sie es nennen möchten.«
Sie zog ihre Visitenkarte aus dem Cabaret hervor. Dann nahm sie den Daumen des Mannes und drückte ihn aufs Papier. Es begann in allen Farben zu schillern, und allmählich erblühten Worte darauf. Die Visitenkarten des Palais des Rêves waren so geschmiedet, dass sie auf den Daumenabdruck derjenigen Person reagierten, die sie erhielt. Nur der Kurier konnte sie lesen, und auch nur, wenn er sie berührte. Laila überflog die Schriftzeilen auf dem cremefarbenen Papier, bevor sie sich wieder auflösten:
Palais des Rêves
90 Boulevard de Clichy
Sagen Sie, L’Énigme schickt Sie …
Eine Einladung zu einer Veranstaltung schien eine armselige Wiedergutmachung für das, was ihm widerfahren war. Doch diese war etwas Besonderes. Das Palais des Rêves war das stilvollste Cabaret von Paris. In der nächsten Woche gaben sie dort ein Fest zum hundertjährigen Jubiläum der Französischen Revolution. Momentan wurden die Einladungen auf dem Schwarzmarkt zum Preis von Diamanten gehandelt. Aber nicht nur das Cabaret versetzte die Leute in Aufregung. In ein paar Wochen richtete die Stadt die Exposition Universelle 1889 aus, eine gigantische Weltausstellung zu Ehren der europäischen Mächte. Dort wurden Erfindungen vorgestellt, die den Weg in das neue Jahrhundert ebnen sollten. Das Hotel L’Éden war daher vollständig ausgebucht.
»Ich bezweifle, dass Sie sich daran erinnern werden, aber bestellen und probieren Sie unbedingt die mit Schokolade überzogenen Erdbeeren im Palais«, sagte Laila zu dem Kurier und ließ die Karte in die Brusttasche seines Sakkos gleiten. »Die sind einfach himmlisch.«
Laila warf einen Blick auf die Standuhr: halb neun. Séverin und Enrique sollten frühestens in einer Stunde zurück sein, trotzdem sah sie ständig auf die Uhr. Schmerzhaft loderte Hoffnung in ihrer Brust. Zwei Jahre wartete sie nun schon auf einen Durchbruch bei der Suche nach einem uralten Buch, und die Schatzkarte könnte die Antwort auf all ihre Gebete sein. Es geht ihnen gut, redete sie sich ein. Eine Akquisition war für sie alle nichts Neues. Als Laila angefangen hatte, für Séverin zu arbeiten, war er gerade dabei gewesen, sich seinen Familienbesitz zurückzuholen. Als Gegenleistung für ihre Hilfe suchte er mit ihr nach dem antiken Werk. Soweit sie wusste, trug es keinen Titel. Ihr einziger Anhaltspunkt war, dass es sich im Besitz des Ordens befand.
Auf der Jagd nach einem Kompass zu sein, der eine Schatzkarte enthielt, klang im Gegensatz zu früheren Missionen recht harmlos. Laila würde nie vergessen, wie sie einmal über dem aktiven Vulkan der Insel Nisyros hing, als sie einem sehr alten Diadem auf der Spur waren. Doch diese Akquisition war etwas vollkommen anderes. Wenn Enriques Recherche und Séverins Geheiminformationen stimmten, konnte dieser winzige Kompass den Verlauf ihrer aller Leben ändern. Oder, wie in Lailas Fall, ihr Leben retten.
Achtlos strich Laila sich das Kleid glatt.
Ein Fehler.
Wenn ihre Gedanken Karussell fuhren, sollte sie lieber nichts anfassen. Dieser kurze unbedachte Moment hatte den Erinnerungen des Kleides ermöglicht, sich in ihren Kopf zu bohren: am nassen Saum klebende Chrysanthemenblüten, ein mit Brokat überzogener Schemel, zum Gebet gefaltete Hände, und dann …
Blut.
Überall Blut, eine umgestürzte Kutsche, Knochen, die durch den Stoff drangen …
Laila zuckte zusammen und riss die Hand zurück. Aber es war zu spät. Die Erinnerungen des Kleides hielten sie fest umschlungen. Sie schloss die Augen und kniff sich in den Arm. Der Schmerz schoss durch ihre Gedanken wie eine Stichflamme. Mit aller Macht versuchte sie, sich auf ihn zu konzentrieren, als könnte er sie wieder aus der Dunkelheit führen. Als die Erinnerungen verblassten, öffnete sie die Augen. Ihre Hände zitterten.
Einen Moment lang kauerte sie auf dem Boden, die Arme um die Knie geschlungen. Séverin hatte gesagt, ihre Fähigkeit sei »von unschätzbarem Wert«, bevor sie ihm erzählt hatte, warum sie Gegenstände lesen konnte. Danach war er zu verblüfft oder vielleicht auch zu entsetzt gewesen, um dem noch irgendetwas hinzuzufügen. Von der ganzen Bande wusste nur Séverin, dass sie in der Lage war, Gegenständen durch Berührung ihre geheimen Geschichten zu entlocken. Ob das nun von unschätzbarem Wert war oder nicht, es war einfach nicht … normal.
Sie war nicht normal.
Laila nahm sich zusammen und stand auf. Als sie den Raum schließlich verließ, zitterten ihre Hände noch immer.
Im Treppenhaus für die Bediensteten schälte sie sich aus dem Kleid und stieg wieder in ihre abgetragene Küchenkluft. Die Zweitküche des Hotels war allein fürs Backen gedacht und gehörte in den Abendstunden ganz ihr. Den nächsten Auftritt im Palais des Rêves hatte sie erst in einer Woche, was ihr viel freie Zeit für ihre zweite Tätigkeit ließ.
Im engen Korridor des L’Éden hasteten die Kellner an ihr vorbei. Sie trugen Austern auf Eis, in Knochenbrühe schwimmende Wachteleier und dampfenden Coq au Vin, der den Raum mit einer Duftmischung aus Burgunder und Knoblauchbutter füllte. Ohne ihre Maske und ihren Kopfschmuck erkannte sie nicht einer von ihnen als die Cabaret-Legende L’Énigme. Hier war sie eine von vielen – eine einfache Arbeitskraft.
Als sie allein in der Backküche stand, ließ Laila ihren Blick über die Arbeitsplatten aus Marmor schweifen. Dort gab es Küchenwaagen, Backpinsel, essbare Perlen im Glas und – seit heute Nachmittag – einen Croquembouche-Turm von knapp zwei Metern Höhe. Sie war mit der Morgendämmerung aufgestanden, hatte Windbeutel gebacken, sie mit süßer Sahne gefüllt und sichergestellt, dass jede Kugel so münzgolden war wie ein Sonnenaufgang, bevor sie sie durch Karamell gerollt und zu einer Pyramide aufgesteckt hatte. Jetzt fehlte nur noch die Verzierung.
Das L’Éden hatte schon zahlreiche Auszeichnungen für die herausragende Küche erhalten – Séverin würde sich auch nicht mit weniger zufriedengeben –, aber es waren die Nachspeisen, bei denen die Gäste ins Schwärmen gerieten. Lailas Desserts, die ganz ohne Schmiedekunst auskamen, waren zum Verzehr geeignete Zauberei. Sie backte Torten in Form von Balletttänzerinnen mit ausgebreiteten Armen – die Haare aus gesponnenem Zucker und essbarem Gold, die Haut blass wie Sahne und mit süßem Perlenstaub versetzt.
Die Gäste bezeichneten ihre Kreationen als »göttlich«. In der Küche über die kleinsten Teilchen eines Universums zu wachen, das noch zu erschaffen war, gab ihr wahrhaftig das Gefühl, eine Göttin zu sein. Sogar das Atmen fiel ihr an diesem Ort leichter. Zucker und Mehl und Salz besaßen keine Erinnerungen. Hier war ihre Berührung nur das, was sie war: eine Berührung. Eine überbrückte Entfernung, eine abgeschlossene Bewegung.
Eine Stunde später, als sie einer Torte gerade den letzten Schliff verpasste, flog die Tür auf. Laila seufzte, sah aber nicht auf. Sie wusste, wer es war.
Ungefähr sechs Monate nachdem Laila begonnen hatte, für Séverin zu arbeiten, hatte sie mit Enrique in der Sternwarte gesessen und Karten gespielt. Plötzlich war Séverin mit einem schmutzigen und unterernährten polnischen Mädchen im Schlepptau hereingekommen. Ihre Augen waren blauer als das Innere einer Flamme. Séverin setzte sie auf das Sofa und stellte sie ihnen ohne weitere Erklärung als seine Ingenieurin vor. Erst später fand Laila mehr über sie heraus. Zofia war wegen Brandstiftung festgenommen worden und von der Universität geflogen, sie besaß eine seltene Schmiedegabe für sämtliche Metalle und ging geschickt mit Zahlen um.
Die erste Zeit im L’Éden sprach Zofia nur mit Séverin und war allen anderen gegenüber äußerst wortkarg. Eines Tages bemerkte Laila, dass Zofia von den Süßspeisen, die Laila immer zu ihren Gruppenbesprechungen mitbrachte, nur die hellen Butterplätzchen aß. Die farbenfroh verzierten Sachen ließ sie völlig außer Acht. Also stellte Laila am nächsten Tag einen Teller mit Butterplätzchen vor Zofias Tür. Das machte sie drei Wochen lang jeden Tag, bis sie einmal so viel in der Küche zu tun hatte, dass sie es vergaß. Als sie dann die Tür öffnete, um durchzulüften, stand Zofia davor, streckte ihr einen leeren Teller entgegen und sah sie abwartend an. Das war nun ein Jahr her.
Jetzt griff Zofia wortlos nach einer sauberen Schale, füllte sie mit Wasser und stürzte es an Ort und Stelle hinunter. Sie wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. Dann schnappte sie sich eine Schüssel mit Zuckerguss. Mit dem Nudelholz verpasste Laila ihr einen leichten Klaps auf die Hand. Zofia warf ihr einen bösen Blick zu, tauchte ihren tintenverschmierten Finger aber trotzdem hinein. Nach einer Weile der Stille begann sie, gedankenverloren Messgefäße der Größe nach zu stapeln. Laila wartete geduldig. Mit Zofia fing man keine Gespräche an, vielmehr ergaben sie sich zufällig und wurden dann so lange aufrechterhalten, bis ihr langweilig wurde.
»Ich habe ein paar Feuer im Zimmer des Haus-Kore-Kuriers gelegt.«
Laila fiel der Backpinsel aus der Hand. »Wie bitte? Du solltest doch nicht im Zimmer sein, wenn er aufwacht!«
»War ich auch nicht. Ich habe sie entzündet, als ich rausgegangen bin. Sie sind winzig klein.« Als Zofia Lailas erschrockenen Blick bemerkte, wechselte sie schlagartig das Thema. »Ich mag Krokodilsmuskulatur nicht. Séverin will eine Fälschung dieser Sphinxmasken …«
»Könnten wir kurz auf die Feuer zurückkommen …«
»… die Maske passt sich einfach nicht an menschliche Gesichtszüge an. Das muss ich unbedingt noch hinbekommen. Oh, und ein neues Reißbrett brauche ich auch noch.«
»Was ist mit dem letzten passiert?«
Zofia betrachtete konzentriert die Schüssel mit dem Zuckerguss und zuckte mit den Schultern.
»Du hast es kaputt gemacht«, sagte Laila.
»Mein Ellbogen ist darauf gelandet.«
Laila schüttelte den Kopf und warf Zofia einen sauberen Lappen zu. Verwirrt starrte sie den Stofffetzen an.
»Wofür brauche ich einen Lappen?«
»Du hast Schwarzpulver im Gesicht.«
»Und?«
»… und das ist etwas beunruhigend, meine Liebe. Wisch es ab.«
Ständig schien Zofia aus Asche oder Flammen aufzutauchen, was ihr im L’Éden den Spitznamen »Phönix« eingebracht hatte. Es machte ihr nichts aus, obwohl ein solcher Vogel überhaupt nicht existierte. Während sie sich das Gesicht abwischte, verfingen sich die Zipfel des Lappens in ihrer ungewöhnlichen Halskette, die aussah, als bestünde sie aus aneinandergereihten Messerspitzen.
»Wann kommen die beiden zurück?«, fragte Zofia.
Laila durchzuckte es eiskalt. »Enrique und Séverin sollten um neun Uhr wieder da sein.«
»Ich muss meine Briefe noch abholen.«
Laila runzelte die Stirn. »So spät noch? Es ist schon dunkel, Zofia.«
Zofia berührte ihre Halskette. »Ich weiß.«
Sie warf ihr den Lappen zu. Laila fing ihn auf und pfefferte ihn ohne Umschweife in den Ausguss. Als sie sich wieder umdrehte, hatte Zofia sich schon den Löffel für den Zuckerguss geschnappt.
»Entschuldige bitte, Phönix, aber den brauche ich!«
Zofia steckte ihn in den Mund.
»Zofia!«
Die Ingenieurin grinste. Dann stieß sie die Tür auf und rannte davon, den Löffel noch immer im Mund.
Als die Desserts fertig waren, räumte Laila auf und verließ die Küche. Sie war nicht die offizielle Pâtissière, und sie wollte es auch gar nicht sein. Gerade weil sie die Tätigkeit aus reinem Vergnügen machte, war sie so reizvoll. Wenn sie keine Lust auf Backen hatte, tat sie es auch nicht.
Je weiter sie den Personalflur zum Speisesaal hinunterschritt, desto lebendiger wurden die Geräusche des L’Éden – Gelächter schallte durch das gläserne Wispern der Bernsteinkronleuchter und Champagnerflöten, leise surrten die geschmiedeten Motten, die mit ihren Buntglasflügeln funkelnde Lichter an die Wände warfen. Laila blieb vor dem Merkurkabinett stehen, der Post für den hotelinternen Briefwechsel. Darin befanden sich kleine Metallfächer mit den Namen der Hotelbediensteten. Laila öffnete ihr Fach mit dem Dienstschlüssel. Obwohl sie keine Post erwartete, streiften ihre Finger etwas, das sich wie kalte Seide anfühlte. Es war eine einzelne Blüte, die mit einem kleinen Schriftstück versehen war, worauf nur ein einziges Wort geschrieben stand:
Neid.
Auch ohne die Blume hätte Laila die enge, geneigte Schrift wiedererkannt: Tristan. Krampfhaft unterdrückte sie ein Lächeln. Sie war noch immer sauer auf ihn.
Das würde sie aber nicht davon abhalten, sein Geschenk anzunehmen.
Vor allem nicht, wenn es etwas war, das er geschmiedet hatte.
Geschmiedet. Das Wort kam ihr auch heute noch schwer über die Lippen, obwohl sie nun schon seit zwei Jahren in Paris lebte. Die Kaiser- und Königreiche des Westens nannten Tristans und Zofias Fähigkeit »Schmieden«, in anderen Sprachen hatte diese Kunstfertigkeit jedoch auch andere Namen. In Indien nannten sie es chhota saans, der »kleine Atem«. Nur Götter waren in der Lage, einer Schöpfung Leben einzuhauchen und die Schmiedekunst war ein kleiner Vorgeschmack solcher Kräfte. Und auch wenn es unterschiedliche Namen für diese Fertigkeit gab, so blieben die grundlegenden Regeln doch dieselben.
Es gab zwei Formen der Schmiedekunst: die des Geistes und die der Materie. Jemand mit einer materiellen Gabe konnte einen der drei Aggregatzustände beeinflussen: flüssig, fest oder gasförmig. Sowohl Tristan als auch Zofia besaßen eine Gabe für Materie. Zofia für feste Materie, vor allem Metalle und Kristalle, und Tristan für flüssige Materie, besonders aber für Flüssigkeiten in Pflanzen.
Die Schmiedekunst war von drei Faktoren abhängig: wie willensstark jemand war, wie deutlich man das Ziel vor Augen hatte und wie die Materie beschaffen war, die man zu formen gedachte. Das bedeutete, dass man mit der Gabe für feste Materie, beispielsweise für Steine, nichts ausrichten konnte, solange man die entsprechenden chemischen Formeln und physikalischen Eigenschaften des Steins, den man verändern wollte, nicht verstand.
In der Regel zeigte sich die Gabe bei Kindern spätestens im dreizehnten Lebensjahr. Wenn das Kind die Gabe verfeinern wollte, konnte es sich weiterbilden. In Europa studierten die meisten Schmiedekunsthandwerker jahrelang an renommierten Instituten oder gingen über einen sehr langen Zeitraum bei einem Schmiedemeister in die Lehre. Zofia und Tristan allerdings hatten keinen dieser Wege eingeschlagen. Zofia nicht, weil sie von der Hochschule geflogen war, bevor sie ihre Ausbildung hatte abschließen können. Und Tristan … nun ja, Tristan hatte es schlicht und einfach nicht nötig. Seine Landschaftskunst sah aus, als wäre sie dem Fiebertraum eines Naturgeistes entsprungen. Sie war verstörend schön, und Paris konnte nicht genug von ihm bekommen. Bereits jetzt, im Alter von sechzehn Jahren, standen Hunderte von Kunden bei ihm auf der Warteliste.
Laila hatte sich immer gefragt, was Tristan im L’Éden hielt. Vielleicht die Loyalität zu Séverin. Oder weil Tristan dort seine bizarre Spinnensammlung behalten durfte. Als Laila nun aber die Gärten betrat, spürte sie den wahren Grund. Der Duft der Blumen erfüllte ihre Lunge. Vor der hereinbrechenden Dunkelheit hob sich der Garten in einer wilden Silhouette ab und ließ sie verstehen. Die anderen Kunden von Tristan hatten so viele Regeln. Haus Kore etwa, welches für das bevorstehende Frühlingsfest extravagante Formschnittfiguren bei ihm in Auftrag gegeben hatte. Im L’Éden war das anders. Zwar liebte Tristan Séverin wie einen Bruder, aber er blieb vor allem deshalb im L’Éden, weil er nur hier seiner wundervollen Fantasie freien Lauf lassen konnte, ohne jegliche Einschränkungen.
Sobald sie die Gärten des L’Éden betrat, war sie mitten in Tristans Kopf. Obwohl der Name Éden etwas anderes vermuten ließ, waren die Gärten kein Paradies, sondern ein Labyrinth aus Sünden. Sieben an der Zahl.
Der erste Garten war Wollust. Hier ergossen sich rote Blumen aus den hohlen Mündern von Statuen. In der einen Ecke spuckte Cleopatra granatfarbene Amaryllis und pink gerüschte Windröschen. In der nächsten wisperte die schöne Helena Mohnblumen und Zinnien. Laila eilte durch das Labyrinth. Vorbei an Maßlosigkeit mit einem Dach aus glänzenden Blüten, die nach Ambrosia dufteten und sich fest schlossen, sobald man die Hand danach ausstreckte. Vorbei an Habgier, wo jeder noch so schmale Pflanzenstiel mit Gold überzogen war. Sie ließ die langsam wachsenden Sträucher der Trägheit hinter sich, ebenso wie Zorn mit seinen feurigen Blüten und Hochmut mit den gigantischen, dahinschreitenden Formschnittfiguren – grüne Hirsche mit blühendem Geweih und majestätische Löwen mit Mähnen aus Jasmin – bis sie schließlich zu Neid gelangte. Hier entfaltete sich die komplette Palette aus Grüntönen, der sprichwörtlichen Farbe dieser speziellen Sünde.
Laila blieb vor dem Tezcat-Portal stehen, das als Eingang diente. Für jeden, der das Geheimnis nicht kannte, sah das Tezcat-Portal wie ein gewöhnlicher Spiegel aus, wenngleich mit einem auffällig hübschen Rahmen aus vergoldeten Efeublättern. Es war unmöglich, Tezcat-Portale von Spiegeln zu unterscheiden, es sei denn, man führte, so Zofia, ein kompliziertes Experiment mit Feuer und Phosphor durch. Zum Glück blieb Laila das erspart. Um das Portal zu öffnen und auf die andere Seite zu gelangen, musste sie in das vierte vergoldete Blatt auf der linken Seite des Rahmens zwicken. Ein versteckter Mechanismus. Ihr Spiegelbild kräuselte sich und die silberfarbene Oberfläche des Tezcat-Portals verblasste, bis sie vollkommen durchsichtig war.
Im Inneren befand sich Tristans Werkstatt. Laila atmete den Duft von Erde und Wurzeln ein. Entlang der Wände standen kleine Glaskästen mit Landschaften im Miniaturformat. Tristan kreierte sie mit einem an Besessenheit grenzenden Eifer. Als sie ihn einmal nach dem Grund gefragt hatte, hatte er ihr erklärt, er wünschte, die Welt wäre ein bisschen einfacher. Klein und überschaubar genug, um sie mit einer Hand fassen zu können.
»Laila!«
Tristan kam ihr entgegen, mit einem breiten Lächeln auf dem rundlichen Gesicht. Seine Kleidung war dreckverschmiert, und erleichtert stellte sie fest, dass seine gigantische Hausspinne nirgends zu sehen war.
Sein Lächeln erwiderte sie jedoch nicht. Stattdessen zog sie streng eine Augenbraue in die Höhe. Tristan wischte sich die Hände an seinem Kittel ab.
»Oh … du bist wohl immer noch sauer?«, fragte er.
»Ja.«
»Wärst du weniger sauer, wenn ich dir etwas schenken würde?«
Laila reckte das Kinn. »Kommt auf das Geschenk an. Aber zuerst möchte ich etwas hören.«
Tristan trat von einem Fuß auf den anderen. »Es tut mir leid.«
»Was genau?«
»Dass ich Goliath auf deinen Toilettentisch gesetzt habe.«
»Wohin gehört Goliath? Und wo wir schon mal dabei sind – wohin gehören alle deine Hausinsekten und was sonst noch alles?«
Tristan sah sie mit großen Augen an. »Nicht in dein Zimmer?«
»Lasse ich gelten.«
Er drehte sich zur Arbeitsplatte um, auf der ein großer Schaukasten mit Milchglasscheiben die Hälfte des Platzes einnahm. Er nahm den Deckel ab, und zum Vorschein kam eine einzige dunkelviolette Blume. Die zarten Blüten sahen aus wie Teile des Abendhimmels, in einem kraftvoll samtigen Violett, das nach Sternenlicht hungerte. Sanft strich Laila über die Ränder. Die Blüten hatten fast den gleichen Farbton wie Séverins Augen. Bei diesem Gedanken zog sie die Hand zurück.
»Voilà! Schau es dir an. Es ist mit einem winzigen bisschen Seide geschmiedet, von einem deiner Kostüme …«
Als er ihren panischen Blick bemerkte, fügte er hastig hinzu: »Eines von denen, die du sowieso entsorgen wolltest, ich schwöre es!«
Laila entspannte sich ein wenig.
»Also … verzeihst du mir?«
Eigentlich wusste er, dass sie ihm längst verziehen hatte. Aber sie wollte den Augenblick noch ein bisschen länger auskosten. Sie wippte mit dem Fuß und wartete auf den richtigen Moment. Tristan wand sich.
»Na schön!«
Er stieß einen Laut der Freude aus, und Laila musste lächeln. Mit diesen großen grauen Augen kam er immer davon.
»Ach ja! Ich habe mir was Neues ausgedacht, das ich Séverin zeigen wollte. Weißt du, wo er ist?« Als er ihren Gesichtsausdruck sah, verblasste sein Grinsen. »Sie sind noch nicht zurück?«
»Noch nicht«, betonte Laila. »Mach dir keine Sorgen. Du weißt doch, dass so was dauern kann. Warum kommst du nicht mit rein? Dann mache ich dir was zu essen.«
Tristan schüttelte den Kopf. »Vielleicht später. Ich muss noch nach Goliath sehen. Ich glaube, es geht ihm nicht gut.«
Laila fragte nicht, woher Tristan den Gemütszustand einer Vogelspinne kennen wollte. Stattdessen nahm sie ihr Geschenk und machte sich auf den Weg zurück ins Hotel. Sorge überschattete ihre Gedanken. Die Standuhr am oberen Ende der Treppe schlug zehn, und die vergangene Stunde bereitete ihr physische Schmerzen. Mittlerweile hätten sie längst wieder zurück sein müssen.
Irgendetwas stimmte da nicht.
Enrique
Angestrengt versuchte Enrique, Ober- und Unterkiefer des Bären auseinanderzudrücken. »Hattest du nicht gesagt ›Das wird lustig‹?«
»Können wir das später diskutieren?«, presste Séverin durch seine zusammengebissenen Zähne hervor.
»Ich denke, das lässt sich einrichten.«
Enrique sagte das so leicht dahin, Séverins Körper wirkte jedoch schwer wie Blei. Der Onyxbär hielt seine Hand fest zwischen den Zähnen. Mit jeder Sekunde, die verstrich, erhöhte sich der Druck. Blut rann seinen Arm hinab. Bald würde diese Kreatur Séverins Handgelenk nicht mehr nur mit ihrem Kiefer festhalten.
Sie würde es entzweibrechen.
Wenigstens hatte sich der Adler von Haus Kore bisher nicht eingemischt. Diese besondere Steinstatue reagierte auf »verdächtige Aktivitäten« und würde auch dann zum Leben erwachen, wenn das eigene Objekt nicht betroffen war. Enrique wollte gerade ein Dankgebet murmeln, als er ein leises Krächzen vernahm. Im Gesicht spürte er einen Luftzug, ausgelöst durch das unverkennbare Schlagen von Flügeln.
Na großartig.
»War das der Adler?«, fragte Séverin und zuckte zusammen.
Umdrehen konnte er sich nicht.
»Nein, nein«, antwortete Enrique.
Auf seinem Sockel legte der Adler den Kopf schief. Enrique zerrte an Séverins Arm. Séverin stöhnte auf.
»Vergiss es«, keuchte er, »ich stecke fest. Wir müssen es in den Somnomodus versetzen.«
Das würde Enrique mit Freuden tun, die Frage war nur, wie. Da es zu gefährlich war, Schmiedekunstgeschöpfe unkontrolliert umherwandern zu lassen, waren alle Kunsthandwerker gesetzlich dazu verpflichtet, eine Sicherheitsfunktion einzubauen. Diese zusätzliche Eigenschaft wurde Somno genannt und diente dazu, das Objekt, wenn nötig, in den Ruhemodus zu versetzen. Doch selbst wenn er den Mechanismus fand, war dieser möglicherweise zusätzlich verschlüsselt. Schlimmer noch – sobald er den Bärenkiefer losließe, würden sich die Zähne nur noch tiefer in Séverins Handgelenk graben. Sollten sie jedoch die kritischen acht Minuten überschreiten, wären die Schmiedekunstgeschöpfe ihre geringste Sorge.
Séverin ächzte. »Kein Problem, lass dir ruhig Zeit. Es geht doch nichts über einen langsamen, qualvollen Tod.«
Enrique ließ los. Er atmete tief durch und umrundete den Onyxbären, während er versuchte, das Geflattere des Jadeadlers zu ignorieren. Mit der Hand fuhr er über den Körper des Bären, das schwarze Hinterteil und die zotteligen Pranken. Nichts.
»Enrique«, stieß Séverin hervor und sank auf die Knie.
Rote Rinnsale liefen aus dem Maul des Bären. Enrique fluchte leise. Er schloss die Augen. Sie halfen hier nicht weiter. Bei so spärlicher Beleuchtung musste er sich auf sein Gefühl verlassen. Er tastete weiter über Bauch und Hinterbeine des Bären, bis er plötzlich nahe den Tatzen etwas entdeckte. Gemeißelte Einkerbungen, dicht beieinander und in regelmäßigen Abständen, wie eine Gravur. Unter seiner Berührung erwachten die Buchstaben und Wörter zum Leben.
Fiduciam in domum
»Vertrauen in das Haus«, übersetzte Enrique. Er flüsterte die Worte erneut und verschiedene Szenarien gingen ihm durch den Kopf. »Ich … ich habe eine Idee.«
»Klär mich auf«, brachte Séverin hervor.
Der Bär hob eine seiner schweren schwarzen Pranken und ein Schatten legte sich über Séverins Gesicht.
»Du musst ihm … vertrauen!«, rief Enrique aus. »Kämpf nicht dagegen an – schieb deine Hand weiter rein!«
Ohne zu zögern, stand Séverin auf und versuchte, die Hand tiefer in den Rachen des Bären zu schieben. Doch sie saß weiterhin fest. Schnaubend warf er sich gegen die Statue. Mit einem hässlichen Geräusch kugelte seine Schulter aus. Jede verrinnende Sekunde fühlte sich für Enrique an wie ein Messerstich. In diesem Moment erhob sich der Adler in die Luft, kreiste an der Decke und schoss mit ausgestreckten Krallen herab. Enrique duckte sich und die Edelsteinkrallen streiften seinen Nacken. Beim nächsten Mal würde er nicht so viel Glück haben. Und richtig: Wieder spürte er die Klauen, doch diesmal packten sie zu, rissen ihn nach oben. Er verlor den Boden unter den Füßen und kniff die Augen zusammen.
»Ruinier mir bloß nicht die Frisur –«, setzte er an, dann wurde er abrupt fallen gelassen. Er öffnete die Augen einen Spalt. Zuerst sah er nur die kahle Decke. Hinter sich hörte er das Schaben von Krallen auf einem Sockel. Er richtete sich vorsichtig auf.
Der Adler war wieder zur Statue erstarrt.
Séverin atmete schwer und stand auf. Er hielt sich das Handgelenk. Mit einer ruckartigen Bewegung renkte er sich die Schulter wieder ein. Knack. Enrique verzog das Gesicht. Séverin wischte sich das Blut an der Hose ab und fischte den geschmiedeten Kompass aus dem nun bewegungslosen Bärenmaul. Er ließ ihn geräuschlos in seine Tasche gleiten und strich sich die Haare nach hinten.
»Tja«, sagte er schließlich, »immerhin war es nicht wie auf Nisyros.«
»Mehr fällt dir dazu nicht ein?«, krächzte Enrique und trottete hinter seinem Freund zur Tür. »›Das wird kinderleicht‹, hast du behauptet. ›Das schaffen wir doch im Schlaf‹!«
»Albträume sind auch Teil des Schlafes.«
»Soll das ein Witz sein?«, fragte Enrique. »Ist dir klar, dass deine Hand gerade halb zerfleischt wurde?«
»Ist mir aufgefallen.«
»Du wurdest fast von einem Bären gefressen!«
»Keinem echten Bären.«
»Deine Hand hättest du aber in echt verloren.«
Séverin grinste bloß. »Bis gleich«, sagte er und schlüpfte durch die Tür.
Enrique wartete noch etwas, um Séverin einen Vorsprung zu verschaffen.
In der Dunkelheit spürte er die Präsenz des Ordensschatzes, als würden Tote ihre Blicke auf ihn richten. In ihm loderte Hass auf. Er brachte es nicht über sich, die Unmengen geborgener Schätze zu betrachten. Ja, vielleicht war das, wobei er Séverin half, stehlen. Aber die größten Räuber waren die Mitglieder des Ordens von Babel. Sie stahlen mehr als nur Gegenstände. Sie raubten Geschichten, verleibten sich ganze Kulturen ein, schmuggelten die Zeugnisse eines glorreichen Altertums an Bord großer Schiffe, um sie klammheimlich in Länder zu entführen, denen sie gleichgültiger nicht sein könnten.
»Länder, denen sie gleichgültiger nicht sein könnten«, sinnierte Enrique. »Die Formulierung muss ich mir merken.«
Für den nächsten Artikel, den er an die spanischsprachige Zeitung La Solidaridad schicken würde, die sich der Reform der spanischen Kolonialpolitik auf den Philippinen verschrieben hatte. Bisher hatte er noch keine wichtigen Leute davon überzeugen können, dass seine Gedanken lesenswert waren. Die heutige Akquisition könnte das ändern.
Doch zuerst musste er diesen Auftrag zu Ende bringen.
Enrique zählte dreißig Sekunden rückwärts, strich die geliehene Dienstbotenuniform glatt, setzte seine Maske auf und trat hinaus auf den schummrigen Flur. Zwischen den Marmorsäulen flatterten Fächer in angeregten Gesprächen.
Pünktlich zu seinem Treffen kam der vietnamesische Botschafter Vũ Văn Đinh um die Ecke. Aus seinem Ärmel lugte ein gefälschter Brief. Obwohl er es höchst ungern tat, war Tristan äußerst gut darin, anderer Leute Handschrift zu fälschen. Die Handschrift der Geliebten des Diplomaten bildete da keine Ausnahme.
Letzte Woche hatten Enrique und der Botschafter in der Bar des L’Éden zusammen etwas getrunken, und während der Diplomat abgelenkt war, hatte Laila ihm den echten Brief der Geliebten aus der Tasche stibitzt. Woraufhin Tristan ihre Schrift nachgeahmt hatte, um dieses Treffen einzufädeln.
Nun begutachtete Enrique die Kleidung des Botschafters. Wie so viele Diplomaten kolonisierter Länder hatte er sich rein äußerlich an den Orden angepasst. Einst hatte es viele Ausprägungen des Ordens überall auf der Welt gegeben, von denen eine jede auf ihre jeweilige Quelle der Schmiedekunst achtgab. Auch wenn nicht alle den gleichen Namen dafür ausgewählt oder diese Macht überhaupt auf die Babelfragmente zurückgeführt hatten. Allerdings existierten diese Ausprägungen nicht mehr. Ihre Schätze waren in fremde Länder gebracht, ihre Kunst verändert und ihre Zünfte vor die Wahl gestellt worden: Kollaboration oder Tod.
Erneut zog Enrique seine Uniform glatt und verbeugte sich dann galant. »Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, Monsieur?«
Er streckte die Hand aus. In ihm machte sich Panik breit. Bestimmt würde Đinh ihm ins Gesicht sehen und ihn erkennen. Mit den Fingerspitzen streifte er beiläufig Đinhs Anzug.
»Wohl kaum«, sagte der Diplomat kurz angebunden und entzog Enrique seinen Arm. In die Augen sah er ihm nicht ein einziges Mal.
»Wie Sie wünschen, Monsieur.«
Enrique verbeugte sich, überließ Đinh dem Treffen, das nie stattfinden würde, und näherte sich dem Saal. Mit den Fingerspitzen fuhr er sich über Gesicht und Hals. Die Berührung verursachte ein Prickeln. Haut und Kleidung wurden nun in kürzester Zeit von einer dünnen Schicht Farbe überzogen, die ihn nach und nach in den Botschafter verwandelte.
Dank des Spiegelstaubes hatte er nun exakt das gleiche Aussehen wie sein vorheriges Gegenüber.
Spiegelstaub war jetzt schon seit so langer Zeit verboten, dass der Orden es nicht für notwendig erachtete, sich auf Versammlungen dagegen zu wappnen. Séverins Freundschaft mit dem leitenden Beamten der Zoll- und Einwanderungsbehörde hatten sie dabei allerdings nicht bedacht.
Flink bewegte Enrique sich durch die Menge. So wirkungsvoll Spiegelstaub auch war – besonders lange hielt der Effekt nicht an. Er eilte die Haupttreppe nach unten, an deren Fuß sich ein Tezcat-Portal befand. Offenbar stammte der Spiegel noch aus einer Zeit, zu der man das Gefallene Haus noch nicht aus der Französischen Fraktion des Ordens von Babel ausgeschlossen hatte: Seinen Rand zierten immer noch die Symbole aller vier Häuser Frankreichs. Ein Halbmond für Haus Nyx. Dornen für Haus Kore. Eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz biss, für Haus Vanth und ein sechszackiger Stern für das Gefallene Haus. Geblieben waren nur die Häuser Nyx und Kore. Die Blutlinie des Hauses Vanth war offiziell für ausgestorben erklärt worden, während das Gefallene Haus … gefallen war. Gerüchten zufolge hatte dessen Führungsriege das Fragment des Westens gefunden und versucht, den in der Bibel erwähnten Turm zu Babel wiederaufzubauen. Ihre Absicht war, so die Behauptungen, statt nur eines Splitters göttlicher Macht, die vollständige Macht Gottes zu erlangen. Hätten sie das Babelfragment tatsächlich an einen anderen Ort gebracht, hätte das womöglich den Untergang der westlichen Zivilisation, so wie sie sie kannten, bedeutet. Séverin glaubte nicht, dass an diesen Gerüchten etwas dran war. Seiner Meinung nach hatte der Orden das Gefallene Haus zerschlagen, um mehr Macht zu erlangen. Enrique war sich da nicht so sicher. Man erzählte sich, von allen vier Häusern sei das Gefallene das am weitesten entwickelte gewesen. Selbst die vom Gefallenen Haus geschmiedeten Tezcat-Portale verbargen mehr als die der anderen Häuser. Angeblich waren sie in der Lage, größere Entfernungen zu überbrücken, statt lediglich normale Eingänge zu verdecken. Wie eine Art Transportmittel. Doch was auch immer das Haus einst besessen haben mochte, war in Vergessenheit geraten. Jahrelang hatte der Orden herauszufinden versucht, was aus dem Ring und den wichtigsten Wertgegenständen des Gefallenen Hauses geworden war, aber bisher ohne Erfolg.
Nach heute änderte sich das vielleicht, dachte Enrique.
Durch das Tezcat-Portal erkannte er glitzernde Korridore, gut gekleidete Menschen und das Funkeln von Kronleuchtern in der Ferne. Jedes Mal wieder fand er es beunruhigend, dass er zwar die Leute auf der anderen Seite sehen konnte, sie ihn jedoch nicht. Für sie hing dort nur ein hoher, glänzender Spiegel. Es gab ihm das Gefühl eines Gottes im Exil, einer schalen Allwissenheit: Soviel er von der Welt auch sah, die Welt sah ihn nicht.
Enrique trat durch das Tezcat-Portal und kam in einem der opulenten Flure des Palais Garnier heraus, dem berühmtesten Opernhaus in ganz Europa.
Überrascht sah ein Mann zu ihm auf und starrte dann den Spiegel an, bevor er misstrauisch sein Champagnerglas beäugte.
Die anderen Besucher schlenderten einfach weiter und ahnten nichts von dem geschmiedeten Ballsaal, den der Orden vor ihnen geheim hielt. Aber wie sollten sie auch: Alles, was den Orden betraf, wurde geheim gehalten. Selbst die Einladungen zu Ordensveranstaltungen ließen sich erst mit einem Tropfen Blut des Eingeladenen lesen. Für jeden anderen waren sie nur ein Stück leeres Papier.
Für die Öffentlichkeit war der Orden lediglich Frankreichs Organisation für Denkmalpflege. Niemand wusste von den Auktionen oder den Schätzen tief unter der Erde. Die halbe Bevölkerung glaubte nicht mal an die Existenz eines tatsächlichen Babelfragments. Für sie war das mehr eine Art ausgeschmückter biblischer Metapher.
Während Enrique sich eilig einen Weg durch die Menge bahnte, ließ der Effekt des Spiegelstaubs nach. Er zupfte an seinem Revers und die Dienstbotenuniform, die er nun wieder trug, veränderte sich: Die Fäden ribbelten auf und verwoben sich gleichzeitig neu, bis Enrique in einen eleganten schwarzen Frack gekleidet war. Mit einem Schlenker seines Arms wuchs aus dem geschmiedeten Lederarmband an seinem Handgelenk ein seidener Zylinder, den Enrique sogleich schwungvoll aufsetzte.
Bevor er das Opernhaus verließ, hielt er kurz vor einer Büste aus Verit inne. Diese befand sich dort nicht nur zu Dekorationszwecken, sondern diente dem Aufspüren von versteckten Waffen. Dreißig Gramm Verit wogen etwa ein Kilo Diamanten auf, sodass sich nur Banken und Paläste dieses Gestein leisten konnten. Ein letztes Mal überprüfte Enrique, ob er sein Messer auch wirklich nicht eingesteckt hatte, dann trat er über die Schwelle.
Draußen war es fast ein bisschen zu warm für April. Die Nacht hatte ihre Sterne bereits hervorgeholt. Auf der anderen Straßenseite glomm schwach die Laterne eines schwarzen Hansom Cab. Als Enrique einstieg, begrüßte Séverin ihn mit einem schelmischen Lächeln. Dann klopfte er gegen das Dach der Kutsche und das Pferd trabte los in die Nacht. Aus seiner Manteltasche zog Séverin seine stets griffbereite Nelkendose. Enrique rümpfte die Nase. An und für sich war der Duft von Nelken durchaus angenehm. Würzig und etwas holzig. Doch in den zwei Jahren, die er jetzt schon für Séverin arbeitete, hatten Nelken stets seine Entscheidungsprozesse begleitet. Ihr Geruch verhieß entweder Genuss oder Gefahr. Manchmal auch beides.
»Voilà«, sagte Séverin und übergab ihm den Kompass. Vorsichtig fuhr Enrique mit den Fingern über das kalte Metall, berührte die kleinen Kerben im Silber. Antike chinesische Kompasse unterschieden sich enorm von den westlichen.
Sie bestanden aus magnetisierten Platten, die eine kreisförmige Rille in der Mitte aufwiesen. Dort drehte sich ein löffelförmiger Zeiger hin und her. Ihn überkam ehrfürchtiges Staunen. Das Gerät war uralt, und nun hielt er es in der Hand.
»Du musst das Ding nicht gleich verführen«, unterbrach Séverin seinen Gedankengang.
»Ich bewundere es nur.«
»Du liebkost es.«
Enrique verdrehte die Augen. »Der Kompass ist ein Stück Geschichte und das sollte man zu würdigen wissen.«
»Du könntest ihn wenigstens vorher zum Essen ausführen«, sagte Séverin. Er deutete auf den Metallrand. »Nun? Sieht er so aus wie erwartet?«
Enrique wog den Gegenstand in den Händen, begutachtete die Konturen. Als er die Furchen befühlte, bemerkte er eine leichte Unregelmäßigkeit im Metall. Er klopfte kurz auf die Oberfläche, dann sah er auf.
»Er ist hohl«, stieß er atemlos hervor.
Warum ihn das so überraschte, wusste er selbst nicht. Das war von vornherein klar gewesen. Trotzdem erschienen nun vor seinem inneren Auge all die Möglichkeiten, welche die Karte, die sie in seinem Inneren finden würde, eröffnete. Enrique wusste nicht, zu welchem Schatz genau die Karte führte … nur, dass er wertvoll genug sein musste, um den Orden völlig in Aufruhr zu versetzen. Er vermutete, dass sie den Weg zu den Schätzen des Gefallenen Hauses wies.
»Brich ihn auf«, sagte Séverin.
»Wie bitte?« Enrique drückte das Artefakt an die Brust. »Der Kompass ist über tausend Jahre alt. Es muss einen Weg geben, ihn behutsam auseinanderzunehmen –«
Da griff Séverin auch schon zu. Enrique versuchte noch, den Kompass zu schützen, war aber nicht schnell genug. Mit einer einzigen raschen Bewegung packte Séverin beide Seiten des Kompasses und …
Enrique hörte es, bevor er es sah. Ein kurzes, unbarmherziges … Knack.
Aus dem Kompass fiel etwas auf den Kutschenboden. Séverin hob es auf. Als er es ins Licht hielt, hatte Enrique das Gefühl, eine kalte Hand würde ihm die Luft aus der Lunge pressen. Das Objekt aus dem Inneren des Kompasses sah tatsächlich aus wie eine Karte. Die Frage war nur: Wohin führte sie?
Zofia
Abends mochte Zofia Paris am liebsten.
Tagsüber war ihr diese Stadt zu viel. Voller Lärm und Gestank, enger Gassen und durchwoben von hektischen Menschenmassen. Die Dämmerung zähmte die Stadt. Machte sie erträglich.
Während sie zum L’Éden zurücklief, presste Zofia den neuesten Brief ihrer Schwester fest an die Brust. Hela wäre begeistert von Paris. Die Linden auf der Rue Bonaparte würde sie gern mögen – vierzehn an der Zahl. Die Rosskastanien fände sie liebreizend – neun insgesamt. Die Gerüche allerdings würden ihr nicht gefallen – zu viele, um sie zu zählen.
In diesem Moment war Paris nicht schön: Pferdemist nahm dem Kopfsteinpflaster jeglichen Charme, Männer erleichterten sich an Straßenlaternen. Und doch – irgendwie strahlte diese Stadt Leben aus. Nichts stand still. Selbst die Wasserspeier schienen sich von den Dächern zu beugen, als würden sie sich jeden Moment in die Lüfte erheben. Nichts wirkte einsam oder allein. Terrassen waren in ständiger Gesellschaft von Rattanmöbeln, Bougainvilleen in einem satten Violett schmiegten sich galant an graue Steinwände. Nicht einmal die Seine, die sich wie eine Tintenspur durch Paris zog, sah verlassen aus. Tagsüber schipperten Boote darüber, nachts tanzte das Licht der Straßenlaternen auf der Oberfläche.
Zofia schielte immer wieder auf Helas Brief, hangelte sich von Zeile zu Zeile unter dem Licht einer jeden Laterne auf ihrem Weg. Sie hatte den ersten Satz gelesen und konnte nun nicht aufhören. Jedes Wort brachte den Klang von Helas Stimme mit sich.
Zofia, bitte sag mir, dass du zur Weltausstellung gehen wirst! Wenn du es nicht tust, finde ich es heraus. Vertrau mir, Schwesterherz, das Labor wird dich für einen Tag entbehren können. Lern nur ein einziges Mal etwas außerhalb eines Hörsaals. Ich habe gehört, auf der Weltausstellung soll es einen verfluchten Diamanten geben. Und exotische Prinzen! Vielleicht bringst du ja einen mit nach Hause, sodass ich nicht länger die Gouvernante für unseren geizigen Stryk spielen muss. Wie er Vaters Bruder sein kann, weiß der Herrgott allein. Bitte geh hin, tu mir den Gefallen. Du schickst in letzter Zeit so viel Geld – ich mache mir Sorgen, dass du nicht genug für dich behältst. Bist du auch gesund und munter? Schreib mir bald, kleines Licht.
Hela war nicht ganz auf dem neuesten Stand. Zofia war nicht mehr an der Universität. Sie vertiefte ihre Fähigkeiten nur noch außerhalb der Hörsäle. In den letzten anderthalb Jahren hatte sie Dinge zu erfinden gelernt, die an der École des Beaux-Arts unvorstellbar gewesen wären. Noch dazu hatte sie gelernt, ein Sparkonto zu eröffnen. Vorausgesetzt, die von Séverin akquirierte Schatzkarte war tatsächlich so viel wert, wie sie sich erhofft hatten, würde sich darauf bald genug Geld befinden, um Hela das Medizinstudium zu ermöglichen. Zu lernen, wie man die eigene Schwester belog, war Zofia von allen Dingen am schwersten gefallen. Nach ihrer ersten Lüge in einem Brief an Hela hatte sie sich übergeben müssen. Aus Schuldgefühl hatte sie stundenlang geweint, bis Laila sie gefunden und getröstet hatte. Sie hatte keine Ahnung, woher Laila wusste, was ihr Kummer bereitete. Sie wusste es einfach. Und Zofia, die sich in gewöhnlichen Unterhaltungen nie ganz zurechtfand, war dankbar, dass ihr diese erspart blieb.
Noch ganz in Gedanken an Hela merkte Zofia zunächst nicht, dass plötzlich der Marmoreingang der École des Beaux-Arts vor ihr auftauchte. Sie stolperte und ließ beinahe den Brief fallen.
Das Tor bewegte sich nicht.
Man hatte den Eingang so geschmiedet, dass er vor allen eingeschriebenen Studenten erschien, sobald sie sich bis auf zwei Häuserblocks näherten. Ein erlesenes Beispiel für das Zusammenspiel von Schmiedekunst des Geistes und der Materie. Eine solche Meisterleistung vollbrachten nur diejenigen, die an der École ausgebildet wurden.
Einst hatte Zofia dazugehört.
»Ihr wollt mich nicht«, sagte sie leise.
Tränen schossen ihr in die Augen. Sie blinzelte und erinnerte sich daran zurück, wie es zu ihrem Ausschluss gekommen war. Ein Jahr nach Beginn des Studiums hatte sich das Verhalten ihrer Mitstudenten verändert. Zunächst waren sie von Zofias Fähigkeiten beeindruckt gewesen, doch mit der Zeit fühlten sie sich eher eingeschüchtert. Dann begann das Gerede. Zu Anfang hatte es niemanden interessiert, dass sie Jüdin war, doch das änderte sich. Es kam das Gerücht auf, Juden wären in der Lage, alles Mögliche zu stehlen.
Sogar anderer Leute Schmiedegabe.
Das war natürlich absoluter Humbug, und Zofia ignorierte die Gerüchte. Sie hätte vorsichtiger sein sollen. Doch so war das mit dem Glück: Es machte blind.
Für eine Weile war Zofia wirklich glücklich gewesen. Eines Nachmittags jedoch wurde ihr das Geflüster der anderen zu viel. An diesem Tag brach sie im Labor zusammen. Zu viele Geräusche, zu viel Gelächter. Zu viel Licht, das durch die Vorhänge drang. Sie vergaß den Rat ihrer Eltern, rückwärts zu zählen, um sich zu beruhigen. Im Anschluss war das Gerede nur noch lauter geworden. Die verrückte Jüdin. Einen Monat später schlossen sich zehn Kommilitonen mit ihr zusammen im Labor ein. Wieder Geräusche, Gerüche, Gelächter. Zunächst fassten sie sie nicht an. Sie wussten, dass kleine Berührungen, wie die einer Feder auf der Haut, schlimmer für sie waren. An Beruhigung war nicht zu denken, sooft sie auch rückwärts zählte. Oder darum bettelte, dass man sie gehen ließe. Oder fragte, was sie getan hatte.
Letzten Endes war es nur eine winzige Bewegung.





























