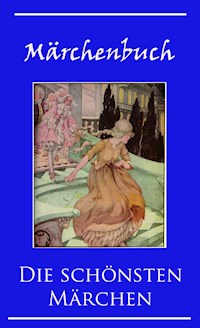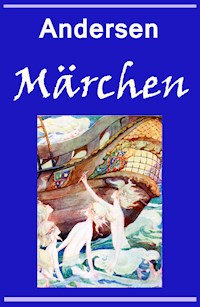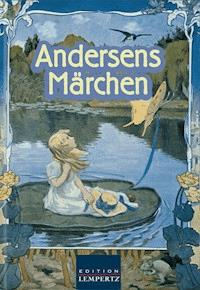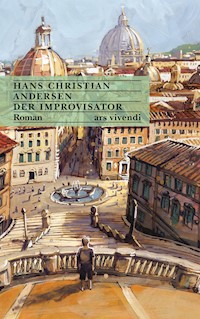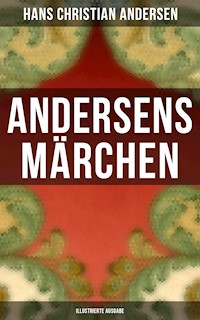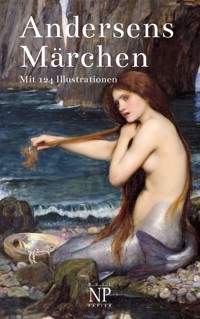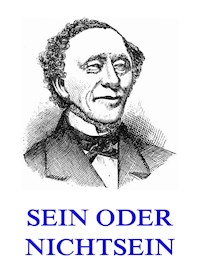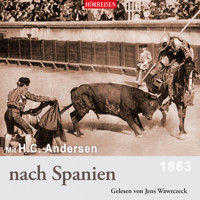Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In dieser großen Sammlung werden sämtliche Märchen, von Hans Christian Andersen vorgestellt, in einer einzigen vollständigen vom Verfasser besorgten Ausgabe. Diese sind mit zahlreichen Illustrationen versehen. Dazu der Ergänzungsband des Schriftstelers ohne Illustrationen. Hans Christian Andersen wurde am 2. April 1805 in Odense (Dänemark) geboren. Er war der Sohn eines armen Schuhmachers. Er konnte kaum die Schule besuchen, bis ihm der Dänenkönig Friedrich VI., dem seine Begabung aufgefallen war, 1822 den Besuch der Lateinschule in Slagelsen ermöglichte. Bis 1828 wurde ihm auch das Universitätsstudium bezahlt. Andersen unternahm Reisen durch Deutschland, Frankreich und Italien, die ihn zu lebhaften impressionistischen Studien anregten. Der Weltruhm Andersens ist auf den insgesamt 168 von ihm geschriebenen Märchen begründet. Andersen starb am 4. August 1875 in Kopenhagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Brendel (Hrg.)
Die große Märchensammlung von Andersen, Grimm und Hauff
Komplettausgabe
4. Band
Die große Märchensammlung von Andersen, Grimm und Hauff
Komplettausgabe
4. Band
Walter Brendel (Hrg.)
Impressum
Texte: © Copyright by Walter Brendel (Hrg.)
Umschlag:© Copyright by Walter Brendel
Illustrationen: © Copyright by Unbekannt
Übersetzer: © Copyright by Guido Höller
Verlag:Das historische Buch, 2023
Mail: [email protected]
Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH,
Berlin
Inhalt
4. Band: Sämtliche Märchen, von Hans Christian Andersen. Einzige vollständige vom Verfasser besorgte Ausgabe plus Ergänzungsband
1. »Schön.«.
5. Der Bischof auf Börglum und seine Sippe.
10. Peiter, Peter, Peer.
15. Lumpen.
20. Was die Distel erlebte.
25. Sonnenscheingeschichten.
30. »Tanze, tanze, Puppe mein!«.
35. Was die alte Johanne erzählte.
38. Tante Zahnweh.
4. Band: Sämtliche Märchen, von Hans Christian Andersen. Einzige vollständige vom Verfasser besorgte Ausgabe plus Ergänzungsband
1. »Schön.«.
Der Bildhauer Alfred, ja, du kennst ihn wohl? Wir kennen ihn alle! Er erhielt die goldene Medaille, reiste nach Italien und kam wieder zurück. Er war jung, ja, das ist er jetzt noch, aber doch schon gut zehn Jahre älter als damals.
Er kam heim und besuchte eine der kleinen Städte Seelands; die ganze Stadt wußte von dem Fremden, wußte, wer er war. Seinetwegen war Gesellschaft bei einer der reichsten Familien; alles, was etwas war oder etwas hatte, war eingeladen. Es war eine Begebenheit, von der die Stadt ohne Bekanntmachung wußte. Die Lehrjungen und die Kinder der kleinen Leute, auch wohl einige ihrer Eltern, standen draußen und betrachteten die erleuchteten, niedergelassenen Vorhänge. Der Wächter konnte sich einbilden, daß er Gesellschaft gäbe, so viele Menschen standen dort in der Ballgasse. Es roch nach Freude, aber drinnen war wirklich die Freude zu Hause; dort war Herr Alfred, der Bildhauer.
Er sprach, er erzählte, und alle hörten ihm mit Freude, ja mit Andacht zu; aber niemand mehr als eine ältere Witwe aus dem Beamtenstande. Sie war für alles, was Herr Alfred sagte, unbeschriebenes graues Papier, das das Gesagte sofort in sich sog und um mehr bat, höchst empfänglich und unglaublich unwissend, ein weiblicher Kaspar Hauser.
»Rom möchte ich auch wohl sehen,« sagte sie, »das muß eine reizende Stadt sein mit all den vielen Fremden, die dorthin kommen. Beschreiben Sie uns einmal Rom! Wie sieht es dort aus, wenn man zum Tore hineinkommt?« »Das ist nicht so leicht zu beschreiben.« sagte der junge Bildhauer. »Dort ist ein großer Platz; in seiner Mitte steht ein Obelisk, der seine viertausend Jahre alt ist.«
»Ein Organist!« schrie die Frau auf, sie hatte noch nie das Wort Obelisk gehört. Manche waren nahe daran zu lachen, auch der Bildhauer. Aber sein Lächeln verlor sich in Anstarren; denn neben der Frau, die sprach, sah er ein Paar große meerblaue Augen. Es war ihre Tochter, und wenn man eine solche Tochter hat, kann man nicht einfältig sein! Die Mutter war ein unerschöpflicher Fragequell und die Tochter war die schöne Najade des Quells, die zuhörte. Wie schön sie war! Sie war so recht ein Wesen zum Anschauen für einen Bildhauer, aber nicht zum Unterhalten, und sie sagte auch nichts, wenigstens nicht viel.
»Hat der Papst eine große Familie?« fragte die Frau.
Und der junge Mann antwortete, als wäre die Frage besser gestellt worden: »Nein, er ist nicht von hoher Familie.«
»Das meine ich nicht,« sagte die Frau: »ich meine, ob er Frau und Kinder hat?«
»Der Papst darf sich nicht verheiraten,« antwortete er.
»Das gefällt mir nicht,« sagte die Frau.
Klüger hätte sie wohl fragen und sprechen dürfen; aber wenn sie nicht so gefragt und gesprochen hätte, wie sie es tat, hätte sich dann wohl die Tochter auch so an ihre Schulter gelehnt und sie mit diesem fast rührenden Lächeln angesehen?
Und Herr Alfred erzählte, erzählte von der Farbenpracht Italiens, von den verblauenden Bergen, von dem blauen Mittelmeer, von dem Blau des Südens, dessen Schönheit man im Norden nur von den blauen Augen der nordischen Frauen übertroffen finden konnte. Und das wurde mit Beziehung gesagt; aber sie, die es verstehen sollte, ließ es sich nicht merken, daß sie es verstand, und das war ja nun auch schön.
»Italien!« seufzten einige; »Reisen!« seufzten andere. »Wie schön!«
»Ja, wenn ich die dreißigtausend Reichstaler in der Lotterie gewinne!« sagte die Witwe, »so reisen wir, ich und meine Tochter. Und Sie, Herr Alfred, sollen uns führen. Wir reisen alle drei und noch ein Paar gute Freunde!« und dabei nickte sie vergnügt den übrigen zu, daß jeder glauben konnte: »Ich bin es, der mit soll.« – »Nach Italien wollen wir; aber wir wollen nicht dahin, wo es Räuber gibt. Wir bleiben in Rom und auf den großen Landstraßen, wo man sicher ist.«
Und die Tochter tat einen kleinen Seufzer! Wieviel kann nicht in einem kleinen Seufzer liegen oder hineingelegt werden. Der junge Mann legte viel hinein Die beiden blauen Augen, die ihm diesen Abend leuchteten, verbargen Schätze, Schätze des Geistes und des Herzens, so reich wie alle Herrlichkeiten Roms. Und als er die Gesellschaft verließ, – ja da war er weg – weg in das Fräulein.
Das Haus der Witwe war das einzige von allen Häusern, das Herr Alfred, der Bildhauer, besuchte. Man begriff, daß es nicht wegen der Mutter sein konnte, trotzdem er und sie stets die Sprechenden waren; es mußte der Tochter wegen sein, daß er kam. Kala wurde sie genannt; sie hieß aber Karen Maline, und diese beiden Namen waren zu Kala zusammengezogen worden. »Schön war sie, aber etwas müde,« sagte der eine und der andere; sie schlief gern bis spät in den Morgen.
»Das ist sie aus ihrer Kindheit so gewöhnt,« sagte die Mutter; »sie ist immer ein Venuskind gewesen, und die werden so leicht müde. Sie liegt oft lange; aber daher hat sie ihre klaren Augen.«
Welche Macht lag nicht in diesen klaren Augen; in diesen blauen Seen, diesen stillen Wassern mit dem tiefen Grund. Das empfand der junge Mann; er saß auf dem tiefen Grunde fest. – Er sprach und erzählte, und die Mama fragte immer gleich lebhaft, gleich freudig und munter, wie bei der ersten Begegnung.
Es war ein Vergnügen, Herrn Alfred erzählen zu hören. Er erzählte von Neapel, von den Besteigungen des Vesuvs und zeigte ihnen mehrere der Ausbrüche in farbigen Bildern. Und die Witwe hatte niemals zuvor davon gehört, noch darüber nachgedacht.
»Gott bewahre mich!« sagte sie, »das ist ja ein feuerspeiender Berg. Kann niemand dabei zu Schaden kommen?«
»Ganze Städte sind zugrunde gegangen,« antwortete er. »Herkulanum und Pompeji.« »Ach, die armen Menschen! und das alles haben sie selber gesehen!«
»Nein, keinen der Ausbrüche hier auf den Bildern; aber ich will ihnen eine Zeichnung von mir zeigen, von einem Ausbruche, den ich selbst gesehen habe.«
Und er nahm eine Skizze hervor, die er mit Bleistift gezeichnet hatte, und Mama, die so sehr im Beschauen der stark kolorierten Bilder vertieft war, sah auf die blasse Bleistiftzeichnung und rief vor Überraschung aus: »O! Sie haben es weiß herausspeien sehen!«
Einen Augenblick verdunkelte sich die Hochachtung Alfreds vor Mama; aber in Kalas Lichte begriff er gar bald, daß ihrer Mutter der Farbensinn fehle. Das war alles; aber sie hatte das Beste, das Schönste, sie hatte Kala.
Und mit Kala ward Alfred verlobt; das war ganz natürlich, und die Verlobung stand im Tageblatt des Städtchens. Mama bestellte sich dreißig Exemplare, um die Anzeige auszuschneiden und in die Briefe an Freunde und Bekannte zu legen. Und die Verlobten waren glücklich und die Schwiegermama auch; sie wäre gleichsam mit Thorwaldsen in eine Familie gekommen.
»Sie sind doch seine Fortsetzung,« sagte sie.
Und Alfred schien es, als hätte sie etwas Geistreiches gesagt, Kala sagte nicht viel, aber ihre Augen strahlten; ein Lächeln saß um ihren Mund; jede Bewegung war schön. Und schön war sie; das kann nicht zuviel gesagt werden.
Alfred formte Kalas und Schwiegermamas Büste. Sie saßen vor ihm und sahen zu, wie er mit den Fingern den weichen Lehm formte und glättete.
»Es ist unsere Schuld,« sagte Schwiegermama, »daß Sie selbst diese geringe Arbeit machen, und sie nicht durch einen Hilfsmann zusammenklecksen lassen.«
»Es ist durchaus notwendig, daß ich sie in Ton forme,« sagte er.
»Ja, Sie sind stets so außerordentlich galant,« sagte Mama und Kala drückte ihm still die Hand, an welcher Lehm saß.
Und er zeigte ihnen beiden die Schönheit der Natur in der Schöpfung, wie das Lebendige über dem Toten stände, die Pflanzen über den Steinen, die Tiere über den Pflanzen und die Menschen über den Tieren; wie Geist und Schönheit sich in der Form offenbarten und daß der Bildhauer die irdische Gestalt in ihrer herrlichsten Offenbarung nachbilde.
Kala stand schweigend und erwog die ausgesprochenen Gedanken; Schwiegermama aber gestand:
»Es ist schwer ihnen zu folgen; doch ich gehe den Gedanken langsam nach, und surren sie auch umher, so halte ich sie doch fest.«
Und die Schönheit hielt ihn fest, erfüllte ihn und beherrschte ihn. Sie leuchtete aus Kalas ganzer Gestalt, aus ihrem Blick, aus ihren Mundwinkeln, ja selbst aus der Bewegung ihrer Finger. Das sprach Alfred aus und er, der Bildhauer, verstand sich darauf. Er sprach nur von ihr, dachte nur an sie. Die zwei wurden eins, und daher sagte sie auch etwas; denn er sagte besonders viel. So war's in den Tagen der Verlobung. Nun kam die Hochzeit mit Brautjungfern und Hochzeitsgeschenken, und die Hochzeitsrede wurde gehalten.
Schwiegermama hatte im Brauthause am Tischende Thorwaldsens Büste aufgestellt, er sollte nach ihrer Idee gleichfalls anwesend sein. Lieder wurden gesungen und Gesundheiten getrunken; es war eine vergnügte Hochzeit, ein schönes Paar. »Pygmalion erhielt seine Galathee,« stand in einem der Lieder. »Das ist nun wieder so etwas Mythologisches,« sagte Schwiegermama.
Am folgenden Tage reiste das junge Paar nach Kopenhagen, um sich dort niederzulassen. Schwiegermama ging mit, um sich des Groben anzunehmen, wie sie sagte, das sollte bedeuten, um den Haushalt zu leiten. Kala sollte wie in einer Puppenstube sitzen. Alles war neu, blank und schön. Da sahen sie alle drei, und Alfred – ja, der saß da, um ein Sprichwort zu gebrauchen, das es klar macht, wie ein Bischof im Gänsestall.
Der Zauber der Schönheit hatte ihn betört; er hatte nur auf das Futteral gesehen, und nicht auf das, was in dem Futteral steckte, und das war ein Unglück, ein großes Unglück für die Ehe. Ging das Futteral aus dem Leim und fällt das Flittergold ab, so bessert man den Handel. In großer Gesellschaft ist es höchst unbehaglich, wenn man merkt, daß einem beide Knöpfe für die Hosenträger fehlen und weiß, daß man sich nicht auf die Hosenschnalle verlassen kann, weil man keine hat; allein noch schlimmer ist es, wenn man in großer Gesellschaft empfindet, daß Frau und Schwiegermutter dummes Zeug schwatzen und daß man sich nicht auf sich verlassen und durch einen witzigen Einfall die Dummheiten fortblasen kann.
Gar oft saß das junge Paar Hand in Hand, und er erzählte, und sie ließ ein Wörtlein eintropfen, immer dieselbe Melodie, dieselben zwei, drei Glockentöne. Es war wie ein geistiger Hauch, wenn Sophie, eine ihrer Freundinnen kam.
Sophie war durchaus nicht schön; aber sie war ohne Fehl. Etwas schief wäre sie freilich, sagte Kala; aber es war sicherlich nicht mehr, als Freundinnen es sehen können. Sie war ein recht vernünftiges Mädchen; doch fiel es ihr niemals ein, daß sie hier gefährlich werden könnte. Sie war der erfrischende Luftzug in der Puppenstube, und frische Luft war nötig, das sahen sie alle ein. Lüften mußte man, und sie lüfteten deshalb; Schwiegermama und das junge Paar reisten nach Italien.
»Gott sei Lob und Dank, daß wir wieder daheim sind,« sagte die Mutter zur Tochter als sie ein Jahr später alle drei zurückkamen.
»Reisen ist kein Vergnügen,« sagte Schwiegermama; »es ist eigentlich doch sehr ermüdend! Entschuldige, daß ich es sage. Ich langweile mich, obschon ich meine Kinder bei mir hatte, und wie teuer, wie schrecklich teuer ist das Reisen! Alle die Galerien, die man sehen soll! Hinter allem soll man her sein! Sonst kennt man ja nichts, wenn man heimkommt und ausgefragt wird. Und dann muß man doch noch hören, daß man gerade das Schönste vergessen hat, sich anzusehen. Mich langweilten auf die Dauer diese ewigen Madonnen, man wird schließlich selbst zur Madonna.«
»Und das Essen, das es gibt,« sagte Kala.
»Nicht einmal eine ordentliche Fleischsuppe,« sagte Mama. »Es ist nichts mit ihrer Kochkunst.«
Und Kala war von der Reise müde, andauernd müde; das war das schlimmste. Sophie kam ins Haus und machte sich nützlich.
»Das muß man ihr lassen,« sagte Schwiegermama; »Sophie versteht sich auf den Haushalt wie auf die Kunst und auf alles, wozu sie nach ihrem Vermögen nicht einmal verpflichtet ist, und ist dabei recht achtbar und treu.« Das zeigte sich recht, als Kala krank lag und dahinsiechte.
Wo das Futteral alles ist, da muß das Futteral aushalten oder es ist mit ihm vorbei, und es war vorbei mit dem Futteral – Kala starb.
»Sie war schön,« sagte die Mutter. »Sie war wahrlich etwas anderes als die Antiken: die sehen so alt, so mitgenommen aus; aber Kala war frisch und das soll eine Schönheit sein.«
Alfred weinte, und die Mutter weinte, und beide gingen in schwarzen Kleidern. Schwarz kleidete Mama besonders gut, und sie ging am längsten in Schwarz und trug am längsten Trauer, und erlebte noch die Trauer, daß Alfred sich wieder verheiratete und Sophie nahm, die äußerlich nichts war.
»Er geht ins Extreme,« sagte Schwiegermama; »geht von dem Schönsten zum Häßlichsten; er hat seine erste Frau vergessen können. Es gibt keine Beständigkeit bei den Männern; mein Mann war anders; er starb auch vor mir.«
»Pygmalion erhielt seine Galathea,« sagte Alfred; »ja, das stand in den Hochzeitsliedern. Ich hatte mich wirklich in eine schöne Statue verliebt, die in meinen Armen lebendig wurde. Aber die verwandte Seele, die uns der Himmel sendet, einen seiner Engel, die mit uns fühlen, mit uns denken, uns aufrichten, wenn wir niedergedrückt sind, habe ich nun erst gefunden und gewonnen. Sophie, du kommst nicht in Schönheit und Glanz der Form, aber schön genug, schöner als es not tut. Die Hauptsache bleibt die Hauptsache! Du kommst und lehrst den Bildhauer, daß sein Werk nur Ton, nur Staub, nur ein Abdruck des inneren Kernes ist, den wir suchen sollen. Arme Kala! Unser Erdenleben war wie eine Reise! Droben, wo man sich in Sympathie zusammenfindet, sind wir uns vielleicht halb fremd.«
»Das war nicht liebevoll,« sagte Sophie; »das war nicht christlich. Dort oben, wo man sich nicht ehelicht, aber, wie du sagst, die Seelen sich voll Sympathie begegnen, dort, wo sich alles Herrliche entfaltet und erhebt, wird ihre Seele vielleicht so voller Kraft erklingen, daß sie mich überklingt, und du – du wirst dann wieder, wie in deiner ersten Verliebtheit, in die Worte ausbrechen: »Schön! Wie schön!«
2. Eine Geschichte aus den Dünen.
Es ist eine Geschichte aus den jütischen Dünen; aber sie beginnt nicht dort, nein, weit davon im Süden, in Spanien. Das Meer ist die große Fahrstraße zwischen den Ländern. Denke dich dorthin, nach Spanien! Dort ist es warm, dort ist es schön; dort wachsen die feuerroten Granatblüten zwischen dunklen Lorbeerbäumen. Von den Bergen weht ein erfrischender Wind hernieder über die Orangenhaine und die prächtigen maurischen Hallen mit goldenen Kuppeln und bunten Wänden. Durch die Straßen ziehen Kinder in Prozessionen mit Lichtern und wehenden Fahnen, und über ihnen, so hoch und klar, wölbt sich der Himmel mit den funkelnden Sternen. Lieder und Kastagnetten erklingen; Burschen und Mädchen schwingen sich im Tanz unter blühenden Akazienbäumen, während der Bettler auf behauenem Marmorsteine sitzt, sich an saftigen Wassermelonen erquickt und so das Leben verträumt. Es ist wie ein schöner Traum, und sich demselben hinzugeben – ja, das taten so ganz zwei junge, neuvermählte Menschen, denen alle irdischen Güter gegeben waren: Gesundheit, Frohsinn, Reichtum und Ehre.
»Wir sind so glücklich, wie es nur irgend jemand sein kann,« sagten sie so recht aus Herzensgrunde. Doch konnten sie sich noch eine Staffel höher auf der Glücksleiter erheben, und das würde geschehen, wenn Gott ihnen ein Kind schenkte, einen Sohn, der ihnen an Leib und Seele gliche. Das glückliche Kind würde mit Jubel begrüßt werden, die höchste Liebe und Sorgfalt finden, all das Wohlsein, welches Reichtum und einflußreiche Verwandtschaft geben kann.
Wie ein Fest glitten ihnen die Tage dahin.
»Das Leben ist eine Gnadengabe der Liebe, unermeßlich groß,« sagte die Frau, »und diese Fülle der Glückseligkeit soll im andern Leben noch wachsen bis in die Ewigkeit hinein. Ich fasse diesen Gedanken nicht!« »Er entspringt sicherlich nur dem Übermute der Menschen,« sagte der Mann. »Es ist im Grunde ein übermäßiger Stolz, zu glauben, man werde ewig leben – werden wie Gott! Das waren ja auch die Worte der Schlange, und sie war der Geist der Lüge.«
»Du zweifelst doch nicht an einem ewigen Leben?« fragte die junge Frau, und es war als führe zum erstenmal ein Schatten durch ihr sonniges Gedankenreich.
»Der Glaube verheißt es, die Priester sagen es,« sagte der junge Mann, »aber grade in all meinem Glück fühle und erkenne ich, daß es ein Stolz, ein übermütiger Gedanke ist, ein zukünftiges Leben, eine fortgesetzte Glückseligkeit zu fordern. Ist uns nicht in diesem Dasein so viel gegeben, daß wir zufrieden sein können und müssen?«
»Ja, uns ist es gegeben,« sagte die junge Frau, »aber wie vielen Tausenden wird nicht dieses Leben zu einer schweren Prüfung. Wie viele sind nicht in die Welt geworfen zu Armut, Krankheit, Schande und Unglück. Nein, wäre kein zukünftiges Leben, so wären die Güter dieser Erde ungleich verteilt, so wäre Gott nicht die Gerechtigkeit.«
»Der Bettler dort unten hat eine Freude, die für ihn ebenso groß ist, wie die des Königs in seinem reichen Schloß,« sagte der junge Mann. »Und glaubst du nicht, daß das Lasttier, welches geprügelt wird, hungert und sich zu Tode schleppt, auch eine Empfindung von seinen harten Lebenstagen hat? Es könnte ja auch ein anderes Leben verlangen, es ein Unrecht nennen, daß es nicht in eine höhere Reihe der Geschöpfe gestellt wurde.« »Im Himmelreich sind viele Wohnungen, hat Christus gesagt,« antwortete die junge Frau, »das Himmelreich ist unendlich, wie Gottes Liebe! Auch das Tier ist ein Geschöpf, und kein Leben, glaube ich, wird verloren gehen, sondern alle werden die Glückseligkeit gewinnen, die sie empfinden können und die ihnen genügt.«
»Aber mir genügt diese Welt,« sagte der Mann und schlang seinen Arm um sein schönes, geliebtes Weib und rauchte seine Zigarre auf dem offenen Altan, wo die kühle Luft von dem Dufte der Orangen und Nelken erfüllt war. Musik und Kastagnetten tönten von der Straße herauf, die Sterne blinkten von oben herab und zwei Augen, die Augen seiner Frau, sahen ihn voller Liebe, mit dem ewigen Leben der Liebe an. »Ein solcher Augenblick,« sagte er, »ist es wohl wert, daß man geboren wird, ihn genießt – und verschwindet.« Er lächelte, die Frau erhob sanft drohend ihre Hand, und die Wolke war wieder fort. Sie waren allzu glücklich, und alles schien sich ihnen zu fügen, daß sie in Ehre, Freude und Wohlstand fortschritten. Da trat ein Wechsel ein, aber nur in dem Orte, nicht in den Dingen, um die Lust und Freude des Lebens zu gewinnen und recht zu genießen. Der junge Mann wurde von seinem König als Gesandter an den kaiserlichen Hof in Rußland geschickt. Es war ein Ehrenposten, auf den Geburt und Kenntnisse ihm ein Recht gaben. Er besaß ein großes Vermögen; seine junge Frau hatte ihm kein geringeres mitgebracht. Sie war die Tochter einer der angesehensten Kaufleute. Eins seiner größten und besten Schiffe sollte gerade in diesem Jahre nach Stockholm abgehen. Es sollte die lieben Kinder, Tochter und Schwiegersohn, nach Rußland bringen, und wurde königlich ausgerüstet. Weiche Teppiche für die Füße, Seide und Pracht überall! Es gibt ein altes Heldenlied, welches heut noch alle Dänen kennen. Es heißt: »Der Sohn des englischen Königs.« Auch er segelte auf einem kostbaren Schiffe fort, seine Anker waren mit rotem Golde ausgelegt und jedes Tau mit Seide umwunden. An dieses Schiff mußte man denken, als man jenes aus Spanien auslaufen sah. Es war dieselbe Pracht, derselbe Abschiedsgedanke: »Gott gebe uns allen ein freudiges Wiedersehen.« Ein starker Wind blies von der spanischen Küste her; der Abschied war kurz; in wenig Wochen mußten sie das Ziel ihrer Reise erreichen. Aber als sie draußen waren, legte sich der Wind; das Meer wurde glatt und still; das Wasser glitzerte, die Sterne des Himmels funkelten. Da gab es Feste in der reichen Kajüte. Aber man wünschte doch, daß es auffrischen, ein günstiger Wind wehen möchte, aber er kam nicht. Erhob sich ein Wind, so war er ihnen entgegen. So vergingen Wochen, ja zwei volle Monate; erst dann wurde der Wind günstig, er blies aus Südwest. Sie waren mitten zwischen Schottland und Jütland, und der Wind nahm zu, wie in dem Liede von dem Sohne des englischen Königs.
»Ringsum kein Land; die Wolke türmtsich schwarz empor; es heult und stürmt.Sie warfen aus die Anker starkund trieben doch westlich gen Dänemark.«
Das ist nun viele Jahre her! König Christian VII. saß auf dem dänischen Thron und war damals jung. Vieles ist seit der Zeit geschehen, vieles hat gewechselt und sich verändert. Seen und Moore sind üppige Wiesen, Heidestriche fruchtbares Ackerland geworden, und im Schutze der westjütischen Häuser wachsen Apfelbäume und Rosenstöcke. Aber sie müssen gesucht werden! denn wegen des scharfen Westwindes erheben sie sich nur an geschützten Orten. Man kann sich dort leicht in frühere Zeiten zurückdenken, die weiter zurück sind als Christians VII. Regierung. Wie damals, so erstreckt sich noch heute meilenweit die braune Heide mit ihren Hünengräbern, ihren Luftspiegelungen und ihren sich kreuzenden, holperigen und tiefsandigen Wegen. Im Westen, wo große Bäche sich in die Buchten ergießen, breiten sich Wiesen und Moore aus, von hohen Dünen begrenzt, die sich gleich einer zackigen Alpenkette gegen das Meer erheben. Sie werden von hohen, steilen Lehmhügeln unterbrochen, von denen das Meer mit unersättlichem Schlunde riesige Brocken verschlingt, so daß Höhen und Hügel, wie durch ein Erdbeben erschüttert, zusammenstürzen. So sieht es dort noch heute aus; so war es dort auch vor vielen Jahren, als die beiden Glücklichen auf dem reichen Schiffe hinaussegelten.
Es war gegen Ende September an einem Sonntag und sonniges Wetter. Die Töne der Kirchenglocken verschmolzen ineinander am Nissumfjord. Großen behauenen Felsblöcken gleichen die Kirchen, jede ist ein Stück Gebirge. Das Meer könnte über sie hinwegrollen und sie würden stehen bleiben. Den meisten fehlt der Turm, und die Glocken hängen dann frei zwischen zwei Balken. Der Gottesdienst war zu Ende; die Menschen traten aus dem Gotteshaus auf den Kirchhof hinaus, wo sich damals, wie heute noch, weder Baum noch Strauch fand, wo weder Blumen gepflanzt noch Kränze auf das Grab gelegt wurden. Nur niedrige Hügel zeigten, wo die Toten begraben lagen. Rauhe Gräser, vom Winde gepeitscht, wuchsen über den ganzen Kirchhof. Ein einziges Grab hatte vielleicht ein Denkmal, das heißt einen verwitterten Baumstamm, der wie ein Sarg zurechtgehauen war. Er stammte aus den Wäldern des Westens. Im wilden Meere wachsen für die Küstenbewohner Bäume, Planken und Bretter. Die Brandung spült sie ans Land. Wind und Seenebel verwittern bald die angespülten Holzstücke. Ein solcher Stumpf lag auf einem Kindergrab, und nach demselben ging eine der Frauen, die aus der Kirche kamen. Sie stand still und sah auf den halbverwitterten Holzblock. Dicht hinter sie trat ihr Mann; sie sprachen kein Wort. Da nahm er sie bei der Hand, und sie gingen vom Grab auf die weite Heide hinaus und über Moorland den Dünen zu. Lange gingen sie schweigend.
»Das war heute eine gute Predigt,« sagte der Mann, »hätten wir Gott nicht, so hätten wir niemand.«
»Ja,« antwortete die Frau, »er schickt Freude und Schmerz; das ist sein Recht. – Morgen wäre unser kleiner Junge fünf Jahre alt, wenn wir ihn behalten hätten.«
»Es ist nicht gut so zu trauern,« sagte der Mann. »Er ist gut daran; er ist ja dort, wohin wir beten einst zu kommen.«
Und sie sprachen nicht mehr darüber und gingen ihrem Hause zu, das in den Dünen lag. Plötzlich erhob es sich von einem der Hügel, wo der Strandhafer den Sand nicht festhalten konnte, wie ein starker Rauch. Es war ein Windstoß, der in den Dünen wühlte und den feinen Sand aufwirbelte. Noch ein Windstoß kam, so daß die an Schnüren aufgehängten und ausgebreiteten Fische gegen die Mauer des Hauses schlugen – und dann war alles wieder still. Die Sonne brannte.
Mann und Frau gingen ins Haus und waren bald aus ihren Sonntagskleidern. Dann eilten sie über die Dünen, die wie ungeheure, plötzlich in ihrer Bewegung erstarrte Sandwellen dastanden. Die rauhen, blaugrünen Halme des Sandgrases und des Strandhafers riefen auf dem weißen Sand den einzigen Farbenwechsel hervor. Einige Nachbarn kamen hinzu: sie halfen sich gegenseitig, die Boote höher auf den Strand zu ziehen. Der Wind wurde stärker; es wurde schneidend kalt, und als sie über die Dünen zurückgingen, flogen ihnen Sand und kleine scharfe Steine ins Gesicht. Die Wellen erhoben sich mit weißen Kämmen, und der Sturm riß ihnen die Spitzen ab, daß der Gischt weit umherspritzte. Es wurde Abend; ein immer stärker werdendes Sausen erfüllte die Luft, es heulte und klagte wie eine Schar verzweifelter Geister; es übertönte das Rollen des Meeres, obgleich das Fischerhaus dicht am Strande lag. Der Sand fegte gegen die Fensterscheiben, und zuweilen kam ein Windstoß, der das Haus in seinen Grundfesten erbeben ließ. Es war finster; doch gegen Mitternacht mußte der Mond aufgehen.
Das Wetter klärte sich auf; allein der Wind fuhr mit aller seiner Kraft hin über das tiefe, schwärzliche Meer. Die Fischersleute hatten sich längst zu Bett gelegt; aber es war in diesem Wetter Gottes nicht daran zu denken, ein Auge zu schließen. Da klopfte es ans Fenster, die Tür öffnete sich und eine Stimme rief:
»Ein großes Schiff sitzt auf dem äußersten Riff fest!« Im Nu waren die Fischersleute aus dem Bett und in ihren Kleidern.
Der Mond war hervorgekommen. Er schien hell genug, um sehen zu können; hätte man nur die Augen wegen des Flugsandes offen halten können. Es war ein Wind, daß man sich gegen ihn stemmen mußte. Nur mit großer Mühe, mit der man in den Windespausen vorwärts kroch, kam man über die Dünen, und hier flogen gleich Schwanenfedern der salzige Gischt und Schaum des Meeres durch die Luft, das sich wie ein kochender, rollender Wasserfall gegen die Küste wälzte. Man mußte wirklich ein geübtes Auge haben, um sofort das Fahrzeug da draußen zu finden. Es war ein prächtiger Zweimaster. Es erhob sich gerade über das Riff, das drei, vier Kabellängen vom gewöhnlichen Meeresstrande entfernt war. Es trieb gegen das Land, stieß auf ein anderes Riff und saß fest. Es war unmöglich, Hilfe zu bringen. Die See ging zu hoch; sie schlug gegen das Schiff und über dasselbe hinweg. Man glaubte das Notgeschrei, die Hilferufe der Todesangst zu hören. Man sah die emsige, vergebliche Tätigkeit. Nun kam eine Sturzsee, die wie ein zerschmetternder Felsblock auf das Bugsprit fiel und es fortriß. Und das Hinterdeck erhob sich hoch über das Wasser. Zwei Menschen sprangen miteinander in das Meer und verschwanden – ein Nu – und eine der stärksten Wogen, die an den Dünen hinaufrollte, warf einen Körper an den Strand. – Es war ein Weib, eine Leiche mußte man glauben. Ein paar der Frauen machten sich bei ihr zu schaffen und glaubten Leben in ihr zu bemerken. Sie wurde über die Dünen in das Fischerhaus getragen. Wie schön und fein sie war, gewiß eine vornehme Dame.
Sie legten sie in das armselige Bett. Kein leinenes Laken war darin, nur eine wollene Decke, um sich einzuhüllen; denn die hält warm. Sie kam ins Leben zurück und lag in heftigem Fieber. Sie wußte nicht, wo sie war, und das war gut, denn alles, was sie geliebt hatte, lag auf dem Grunde des Meeres. Es erging ihr, wie es in dem Heldenlied von dem englischen Königssohn gesungen wird:
»Gar großer Jammer war dort zu sehn.Das Schiff, es mußt' in Trümmer gehn.«
Schiffsteile und Trümmer spülten ans Land; sie allein war von allen am Leben geblieben, und noch immer fuhr der Wind heulend über die Küste dahin. Einen Augenblick hatte die arme Frau Ruhe; aber bald schrie sie vor Schmerzen. Sie schlug ihre schönen Augen auf und sagte einige Worte; aber niemand verstand sie.
Und siehe! für alles, was sie gelitten und gestritten hatte, hielt sie ein neugeborenes Kind in ihren Armen. Es hätte in einem Prachtbett ruhen sollen, hinter seidenen Gardinen, in einem reichen Hause: es hätte mit Jubel begrüßt werden sollen, ein Leben, reich an allen irdischen Gütern führen sollen. Und nun hatte der Herr es in der armseligen Hütte geboren werden lassen; nicht einmal einen Kuß empfing es von seiner Mutter.
Die Fischersfrau legte das Kind an die Brust seiner Mutter, und es lag an einem Herzen, das nicht mehr schlug; sie war tot. Das Kind, welches Reichtum und Glück hätten großziehen sollen, war in die Welt hineingeworfen, vom Meer in die Dünen geworfen, um das Los der Armen und schwere Tage zu ertragen. Und immer kommt uns das alte Lied in den Sinn:
»Dem Königssohn rannen die Tränen herab;Hilf Himmel! hier gähnt meiner Hoffnung Grab;wir treiben hinein gegen Bovbjerg.Doch dienstbar nicht werd' ich Herrn Bugges Geschlechtund wird mir erschlagen auch Ritter und Knecht.«
Etwas südlich vom Nissumfjord auf dem Strand, den Herr Bugge einst sein eigen nannte, war das Schiff gestrandet. Die harten, unmenschlichen Zeiten, als die Bewohner der Westküste übel taten, das Strandrecht übten, wie man sagte, waren langst vorbei. Liebe, freundliche Gesinnung und Aufopferung für die Schiffbrüchigen sind an die Stelle getreten und leuchten als edelste Züge unserer Zeit hervor. Eine sterbende Mutter, ein elendes Kind würden Wartung und Pflege gefunden haben, wohin der Wind sie auch geweht hätte, aber nirgends herzlicher als bei der armen Fischersfrau, welche noch gestern mit schwerem Herzen an dem Grabe ihres kleinen Kindes stand, das heute sein fünftes Jahr erreicht haben würde, wenn Gott ihm länger zu leben vergönnt hätte.
Niemand wußte, wer die fremde, tote Frau war oder woher sie kam. Die Trümmer und Planken des Schiffes erzählten nichts davon.
In Spanien, in dem reichen Hause, traf niemals ein Brief, niemals eine Nachricht von der Tochter oder dem Schwiegersohne ein. Sie waren nicht an ihren Bestimmungsort gekommen; starke Stürme hatten in den letzten Wochen getobt. Man wartete monatelang. »Versunken, ertrunken!« Anders konnte es nicht sein.
Draußen im Fischerhause in den Dünen von Huusby hatte sie nun einen kleinen Jungen.
Wo Gott für zwei Nahrung gibt, wird ein drittes auch wohl satt. Und so nahe am Meere gibt es Fische für den hungrigen Mund. Georg wurde der Kleine genannt.
»Es ist gewiß ein Judenkind: es sieht so schwarz aus,« sagte man, »Es kann auch ein Italiener oder Spanier sein,« sagte der Pfarrer. Der Fischersfrau schien es freilich auf eins hinauszukommen, und sie tröstete sich damit, daß das Kind christlich getauft wäre. Der Knabe gedieh: das adlige Blut erhielt von der dürftigen Kost Kraft und Wärme, und der Knabe wuchs in dem geringen Hause. Die dänische Sprache – wie sie die Westküste spricht – wurde seine Sprache. Der Granatkern aus dem spanischen Erdreich wurde zu einem Sandhalm der jütischen Westküste. Dazu kann es ein Mensch bringen! An dieses Heim klammerte er sich mit allen Wurzeln je länger, je fester. Hunger und Kälte, Not und Sorge des armen Mannes sollte er erfahren, aber auch seine Freude. Für jeden hat die Kindheit Lichtpunkte, die durch das ganze Leben strahlen. Wieviel gab es nicht zu Spiel und Lust! Meilenweit lag der Strand voll Spielzeug: Ein Mosaik von Geröllsteinen, rot wie Korallen, gelb wie Bernstein und rund und weiß wie Vogeleier. Alle Farben gab es, und alle waren von dem Meer geschliffen und geglättet. Selbst das ausgetrocknete Fischskelett, die vom Winde getrockneten Wasserpflanzen, der weißschimmernde Seetang, der lang und schmal wie Bänder zwischen den Steinen flatterte – alles bot Augen und Gedanken Spiel und Lust. Der Knabe war ein aufgewecktes Kind; mannigfaltige Fähigkeiten schlummerten in ihm. Wie gut konnte er sich der Geschichten und Lieder erinnern, die er gehört hatte, und wie fingerfertig war er. Von Steinen und Schalen setzte er ganze Schiffe und Bilder zusammen; man konnte die Stuben damit schmücken. Er verstände sogar seine Gedanken in Holzstückchen zum Ausdruck zu bringen, sagte seine Pflegemutter, und wäre doch noch so klein. Seine Stimme klang schön, und die Melodien strömten ihm leicht vom Munde. Gar manche Saite war in seiner Brust ausgespannt; sie hätten in die Welt hinausklingen können, wenn er an einen andern Ort als in das Fischerhaus an der Nordsee gestellt worden wäre.
Eines Tages strandete hier ein Schiff. Eine Kiste mit seltenen Blumenzwiebeln trieb ans Land. Man nahm einige und warf sie in einen Topf. Man glaubte, daß sie zu essen wären. Andere verfaulten im Sande; sie gelangten nicht zu ihrer Bestimmung, die Farbenpracht, die Herrlichkeit, die in ihnen lag, zu entfalten. Würde es Georg besser ergehen? Mit den Blumenzwiebeln war es bald vorbei; er hatte noch Jahre zu leiden.
Niemals fiel es ihm noch einem andern dort oben ein, wie einsam und einförmig die Tage vergingen. Es gab vollauf zu tun, zu hören und zu sehen. Das Meer selbst war ein großes Lehrbuch; jeden Tag bot es eine neue Seite: Meeresstille, – hohle See, leichter Wind und Sturm; Strandungen waren die Glanzpunkte; der Kirchgang war ein Festtagsbesuch. Doch von den Besuchen war einer im Fischerhause besonders willkommen, und er wiederholte sich zweimal im Jahre. Es war der Besuch des Onkels mütterlicherseits, eines Aalhändlers aus Fjaltrung droben bei Bovbjerg. Er kam mit einem rot angestrichenen Wagen voll Aale. Der Wagen war wie ein Kasten verschlossen, mit blauen und weißen Tulpen bemalt, und wurde von zwei falben Ochsen gezogen. Georg erhielt die Erlaubnis, ihn zu fahren. Der Aalhändler war ein guter Kopf, ein munterer Gast. Er führte stets ein Fäßchen mit Branntwein mit sich herum; jeder erhielt daraus ein Gläschen oder eine Kaffeetasse voll, wenn nichts anderes zur Stelle war. Selbst Georg erhielt, so klein er war, einen guten Fingerhut voll. Das geschähe, um den fetten Aal niederzuhalten, sagte der Aalhändler, und er erzählte dann immer dieselbe Geschichte, und lachte man, so erzählte er sie sofort noch einmal, und da sie für Georgs Jugend und Mannesalter Bedeutung gewann, müssen wir sie wohl hören: »Draußen im Flusse schwammen Aale, und die Aalmutter sagte zu ihren Töchtern, als sie baten, ein kleines Stück die Aue hinaufschwimmen zu dürfen: »Geht nicht so weit, sonst kommt der böse Aalstecher und tötet euch alle zusammen,« Aber sie gingen zu weit, und von den acht Töchtern kamen nur drei wieder zur Aalmutter zurück. Sie jammerten: »Wir waren nur ein wenig vor die Tür gegangen, da kam der böse Aalstecher und stach unsere fünf Schwestern tot.« »Sie kommen noch wieder,« sagte die Aalmutter, »Nein,« sagten die Töchter, »denn er zog ihnen die Haut ab, schnitt sie in Stücke und briet sie.« »Sie kommen noch wieder,« sagte die Aalmutter. »Ja aber er aß sie.« »Sie kommen noch wieder.« »Aber dann trank er Branntwein hintennach,« sagten die Töchter. »O, dann kommen sie niemals wieder,« heulte die Aalmutter, »der Branntwein begräbt den Aal.«
»Und deshalb muß man immer ein Gläschen Branntwein nach dem Essen trinken,« sagte der Aalhändler.
Und diese Geschichte wurde der Flittergoldfaden, der Faden der guten Laune in Georgs Leben. Auch er wollte gern vor die Tür, »den Fluß ein wenig hinauf,« das hieß mit einem Schiffe in die weite Welt hinaus, und die Mutter sagte wie die Aalmutter: »Es gibt viele schlechte Menschen, viele Aalstecher.« Aber ein wenig in die Dünen, ein wenig in die Heide hinaus mußte er doch. Und es sollte geschehen. Er erlebte fröhliche Tage, die durch seine ganze Kinderzeit hindurch leuchteten. Die ganze Schönheit Jütlands, die Freude und der Sonnenschein der Heimat lag in ihnen. Er sollte zu einem Schmaus, freilich nur zu einem Leichenschmaus. Ein wohlhabender Verwandter der Fischerfamilie war gestorben. Sein Hof lag im Lande, »östlich, einen Strich gegen Norden,« wie es hieß. Vater und Mutter wollten hinüber und Georg sollte mit. Von den Dünen ging es über Heide und Moorland zu den grünen Wiesen, wo der Skjärum sich sein Bett gegraben hatte, der Fluß der Aale, wo die Aalmutter mit ihren Töchtern wohnte, die die bösen Menschen fingen und in Stücke schnitten. Doch besser hatten die Menschen oft auch nicht gegen ihre Mitmenschen gehandelt. Der Ritter Bugge, welcher in dem alten Liede vorkommt und von schlechten Menschen ermordet wurde – obgleich man ihn »den Guten« nannte – wollte den Baumeister totschlagen lassen, der ihm das Schloß mit Turm und dicken Mauern an der Stelle erbaut hatte, wo Georg mit seinen Pflegeeltern stand, wo sich der Skjärum in den Nissumfjord ergießt. Die Wälle waren noch zu sehen und rote Mauerreste rings umher. Hier hatte Ritter Bugge, als der Baumeister abgereist war zu seinem Knecht gesagt: »Geh' ihm nach und sage ›Meister, der Turm fällt,‹ dreht er sich um, so schlägst du ihn tot und nimmst ihm das Geld wieder ab, das ich ihm gab; dreht er sich aber nicht um, so laß ihn in Frieden ziehen.« Der Knecht gehorchte, und der Baumeister antwortete: »Der Turm fällt nicht; aber einst wird vom Westen ein Mann in blauem Mantel kommen, der wird ihn zum Stürzen bringen.« Das geschah hundert Jahre später. Da brach die Nordsee herein, der Turm fiel; aber der Besitzer des Hofes Pröbjörn Gyldenstjerne baute sich höher, wo die Wiese endet, ein neues Schloß. Und das steht noch jetzt; das ist Nörre Voßborg. Dort mußte Georg mit seinen Pflegeeltern vorbei. Von jener Stätte dort oben hatte man ihm in langen Winterabenden erzählt. Nun sah er den Hof mit den doppelten Gräben, mit den Bäumen und Büschen. Wälle mit Farnkraut überwachsen erhoben sich stolz; aber am schönsten waren die hohen Lindenbäume, die fast bis zum Dachfirst reichten und die Luft mit süßem Duft erfüllten. Gegen Nordwesten in einer Ecke des Gartens stand ein großer Strauch mit Blüten wie Winterschnee im Sommergrün. Es war ein Fliederstrauch, der erste, den Georg in solcher Pracht blühen sah. Ihn und die Lindenbäume behielt Georg während seines ganzen Lebens in der Erinnerung als Dänemarks Duft und Schönheit, welche seine Kinderseele bis in das Alter bewahrte. Die Reise ging unaufhaltsam weiter. Nun reiste man bequemer; denn gerade in Nörre Voßborg, wo der Fliederbaum in Blüte stand, fanden sie Fahrgelegenheit. Sie trafen andere Gäste, die auch zum Begräbnisfest wollten, und zu diesen stiegen sie in den Wagen. Freilich mußten sie rückwärts sitzen, auf einer kleinen Holzkiste mit eisernen Beschlägen. Aber sie meinten: »Schlecht gefahren, sei besser als gut gegangen.« Die Fahrt ging über die wellige Heide. Die Ochsen, welche zogen, standen manchmal still, wenn sie an einen frischen Grasfleck zwischen dem Heidekraut kamen. Es war seltsam, weit draußen eine Rauchsäule zu sehen, die hin und her wogte und doch blasser als die Luft war. Man sah durch sie hindurch; es war als ob die Sonnenstrahlen über die Heide schwebten und tanzten. »Das ist der Lokemann, der seine Schafherde treibt,« sagten sie, und das war für Georg genug gesagt. Er meinte ins Land der Märchen hinein zu fahren, und doch war es Wirklichkeit. Wie still war es hier! Groß und weit lag die Heide, wie ein kostbarer Teppich; das Heidekraut stand in Blüte, die zypressengrünen Wacholderbüsche und die frischen Eichenschößlinge kamen wie Blumensträuße aus dem Heidekraut hervor. Es war gar zu verlockend, sich darin umherzutummeln, wenn nur nicht die vielen giftigen Schlangen wären. Von ihnen sprach man und von den vielen Wölfen, die es hier gegeben hatte; weshalb auch dieser Landstrich Kreis Wolfsburg genannt wurde. Der Alte, welcher fuhr, erzählte aus seines Vaters Zeit, wie die Pferde hier damals einen harten Kampf mit den jetzt ausgerotteten wilden Tieren gekämpft hätten. Als er eines Morgens hinausgekommen wäre, hätte eins der Pferde auf einem getöteten Wolf gestanden; aber seine Beine wären gänzlich zerfleischt gewesen. Allzu schnell ging es über die rauhe Heide und durch den tiefen Sand. Sie hielten vor dem Trauerhause, das innen und außen voller Fremder war. Ein Wagen stand neben dem andern, Pferde und Ochsen gingen auf der magern Weide. Große Sandhügel erhoben sich, wie daheim; hinter dem Hofe erstreckten sie sich weit und breit. Wie waren die hierhergekommen? Drei Meilen landeinwärts, und ebenso hoch und mächtig wie am Meeresstrand, Der Wind hatte sie aufgetürmt und fortgetrieben; sie hatten auch ihre Geschichte, Trauergesänge wurden gesungen, einige Alte weinten, sonst wäre alles recht vergnügt gewesen, meinte Georg, Essen und Trinken gab es in Fülle, die schönsten fetten Aale, und auf die soll man ein Gläschen Branntwein trinken; dann bleiben die Aale, hatte der Aalhändler gesagt, und dieses Wort wurde hier allerdings zur Tat.
Georg war drinnen und draußen. Am dritten Tage fühlte sich Georg hier so heimisch wie zu Hause in den Dünen, wo er alle seine früheren Tage verlebt hatte. Die Heide hier war an andern Dingen reich; hier wucherten Heidekraut, Erdbeeren und Bickbeeren, Groß und süß quollen sie hervor; man mußte sich in acht nehmen, um sie nicht mit den Füßen zu zerquetschen, daß der rote Saft von dem Heidekraut tröpfelte. Hier lag ein Hünengrab, dort ein anderes; Rauchsäulen stiegen in die stille Luft. Das wäre der Heidebrand, sagte man, der weithin durch den Abend leuchtete.
Nun kam der vierte Tag; der Leichenschmaus war zu Ende, und sie wollten von den Landdünen wieder nach den Stranddünen zurück.
»Unsere sind doch die richtigen,« sagte der Vater; »diese haben keine Macht.«
Und so wurde darüber gesprochen, wie sie hierher gekommen wären; es war allen recht verständlich. Am Strande hatte man eine Leiche gefunden, und die Bauern hatten sie auf den Kirchhof gebracht. Da begannen die Sandwehen, und das Meer brach gewaltsam herein. Ein kluger Mann der Gemeinde riet, das Grab zu öffnen und nachzusehen, ob nicht der Begrabene läge und auf seinem Daumen söge; dann wäre es ein Meermann, den man begraben hätte. Das Meer würde das Grab aufbrechen und ihn holen. Das Grab wurde geöffnet; er lag und sog auf dem Daumen, und deshalb legte man ihn sofort auf eine Karre, spannte zwei Ochsen vor und, wie von der Tarantel gestochen, fuhren sie mit ihm über Heide und Moor zum Meere zurück. Da hörten die Sandwehen auf; aber die Dünen stehen noch jetzt. Alles dies hörte Georg, und er behielt es aus den glücklichsten Tagen seiner Kindheit, aus den Tagen des Leichenschmauses.
Schön ist es hinauszukommen, neue Gegenden und neue Menschen zu sehen, und Georg sollte noch weiter hinauskommen. Er war ein Kind noch, kaum vierzehn Jahre, da ging er zu Schiffe fort, kam hinaus und sah, was die Welt bietet. Er lernte böses Wetter und harte See, bösen Sinn und harte Menschen kennen; er wurde Schiffsjunge. Schlechte Kost und kalte Nächte, Tauende und Faustschläge mußten ertragen werden. Es machte wohl das hochadelige spanische Blut, daß sein Mund von zornigen Worten überschäumte; aber es war am klügsten, sie bei sich zu behalten, und er hatte ein Gefühl, wie die Aale, die gehäutet, zerschnitten und in die Pfanne gelegt werden.
Ich komme wieder, sprach es in ihm. Die spanische Küste, das Vaterland seiner Eltern, die Stadt selbst, wo er in Wohlstand und Glück hätte leben sollen, bekam er zu sehen; aber er wußte nichts von seiner Heimat und seiner Verwandtschaft, und seine Familie wußte noch weniger von ihm. Der arme Schiffsjunge bekam keine Erlaubnis ans Land zu gehen; doch am letzten Tage, den das Schiff hier lag, kam er doch auf das feste Land. Einkäufe sollten gemacht werden, und er sollte sie an Bord schleppen. Da stand nun Georg in seinen jämmerlichen Kleidern, die aussahen, als wären sie im Rinnstein gewaschen und im Schornstein getrocknet. Zum erstenmal sah er, der Dünenbewohner, eine große Stadt. Wie hoch waren doch die Häuser, wie eng die Straßen, wie wimmelte es von Menschen. Einige drängten hierher, einige dorthin; es war wie ein ganzer Mälstrom von Städtern und Bauern, Mönchen und Soldaten. Das war ein Schreien und Rufen, ein Klingeln der Glocken von Eseln und Maultieren, und dazwischen läuteten die Kirchenglocken, ertönte Sang und Klang, Hämmern und Klopfen; denn jeder Beruf hatte seine Wertstatt in der Tür oder auf der Straße. Dabei brannte die Sonne heiß; es war als ob man in einem Backofen wäre voller Mistkäfer und Maikäfer, voller Bienen und Fliegen, die summten und surrten. Georg wußte nicht, wo er ging noch stand. Da sah er gerade vor sich das mächtige Portal des Domes. Die Lichter strahlten aus den halbdunklen Schiffen und Weihrauchduft zog heraus. Selbst der ärmste, zerlumpteste Bettler wagte sich die Treppe hinauf. Der Matrose, dem Georg folgte, nahm seinen Weg quer durch die Kirche, und Georg stand im Heiligtum. Farbenprächtige Bilder strahlten aus goldenem Grunde hervor. Die Mutter Gottes mit dem Jesuskinde stand auf dem Altar zwischen Blumen und Lichtern. Der Priester im Meßgewand sang, und schöne, geputzte Chorknaben schwangen kostbare silberne Rauchgefäße. Das war eine Pracht, eine Herrlichkeit! Es durchströmte Georgs Seele und überwältigte ihn. Die Kirche und der Glaube seiner Eltern umfingen ihn und ließen eine Saite in seiner Seele erklingen, daß sich seine Augen mit Tränen füllten.
Von der Kirche ging es zum Markt; er mußte einen Teil der Küchen- und Eßwaren schleppen. Der Weg war nicht kurz. Er wurde müde und ruhte sich deshalb vor einem großen, prächtigen Hause aus, das Marmorsäulen, Statuen und breite Treppen hatte. Er lehnte seine Last auf die Mauer; aber da kam der Portier im Tressenrock, erhob den silberbeschlagenen Stock gegen ihn und jagte ihn fort, ihn, den Enkel des Hauses; aber das wußte dort niemand, er am allerwenigsten.
Und er kam an Bord, wurde gestoßen und fand harte Worte, wenig Schlaf und viel Arbeit. Das mußte er erfahren, und es soll gut sein, wenn man in der Jugend Böses erduldet, sagt man. Ja, wenn das Alter dann nur besser wird.
Die Zeit seiner Heuer war zu Ende; das Fahrzeug lag wieder in Ringkjöbing-Fjord. Er kam ans Land und wieder heim zu den Huusby-Dünen. Aber die Mutter war gestorben, während er auf der Reise gewesen war.
Es folgte ein strenger Winter; die Schneestürme fuhren über Land und Meer: man konnte kaum vorwärts kommen. Wie verschieden ist es doch in der Welt verteilt. Hier eisige Kälte und wirbelnder Schnee, und in Spanien nur allzu starke brennende Sonnenhitze, Und doch, wenn hier ein ruhiger, frostklarer Tag war und Georg die Schwäne in großen Scharen über das Meer, über den Nissum-Fjord nach Nörre Voßberg fliegen sah, schien es ihm, daß man hier die beste Luft atmete. Und wie schön war hier erst der Sommer, In Gedanken sah er die Heide blühen und mit reifen, saftigen Beeren bedeckt. Die Lindenbäume und Fliedersträucher bei Nörre Voßberg standen dann in Blüte; dahin mußte er doch noch einmal.
Der Frühling stand vor der Tür; die Fischerei begann, Georg half. Er war im letzten Jahre gewachsen, und die Arbeit ging ihm rasch von der Hand. Leben war in ihm; wassertreten konnte er, schwimmen und tauchen wie ein Fisch. Oft wurde er gewarnt, sich vor den Makrelenschwärmen zu hüten. Sie ergreifen den besten Schwimmer, ziehen ihn unter Wasser, fressen ihn, und dann ist es aus mit ihm. Aber das wurde nicht Georgs Los.
Sein Nachbar in den Dünen war ein Bursche namens Morten. Mit ihm stand sich Georg gut, und beide nahmen Heuer auf einem Schiffe nach Norwegen und Holland. Niemals gab es Streitigkeiten zwischen den beiden; aber sie können leicht kommen, und ist man nur ein wenig heftiger Natur, so macht man leicht zu starke Gebärden. Das tat Georg einst, als sie auf dem Schiffe sozusagen über nichts in Streit geraten waren. Sie saßen gerade hinter der Kajütenwand und aßen von einer leeren Tonne, die zwischen ihnen stand. Georg hatte sein Taschenmesser in der Hand. Er zückte es gegen Morten, während er kreideweiß wurde und der Haß ihm aus den Augen sah. Und Morten sagte nur: »So, du bist auch einer von denen, die gleich mit dem Messer zur Hand sind.«
Kaum war es gesagt, so fuhr Georgs Hand wieder zurück. Er sagte kein Wort, aß weiter und ging an seine Arbeit. Als er fertig war, ging er zu Morten und sagte: »Schlage mich nur gleich ins Gesicht; ich habe es verdient. Es war mir, als ob ein Topf in mir überkochen wollte.«
»Laß es gut sein,« sagte Morten, und sie waren danach doppelt so gute Freunde. Als sie dann zu den Dünen heimkamen, ins jütische Land, und erzählten, was sie erlebt hatten, wurde auch davon gesprochen, Georg konnte überkochen; aber der Topf in ihm wäre doch ganz anständig. »Ein Jüte ist er ja nicht; einen Jüten kann man ihn auch nicht nennen,« und das war witzig gesprochen von Morten.
Jung und gesund waren alle beide, gut gewachsen und von starken Gliedern. Aber Georg war der geschmeidigste, Droben in Norwegen ziehen die Bauern auf die Almen und lassen ihr Vieh auf den Bergen werden. An der jütischen Westküste hat man inmitten der Dünen Hütten erbaut, die aus Schiffstrümmern gezimmert und mit Heidetorf und Heideplacken gedeckt sind. Die Schlafstellen liegen ringsum an den Wänden, und hier wohnen und schlafen die Fischer schon frühzeitig im Frühling. Jeder hat seine Magd, seinen »Lastesel,« wie er sie nennt, und ihre Arbeit ist es, die Köder an die Angelhaken zu legen, die Fischer am Landungsplätze mit Warmbier zu empfangen und Essen aufzutragen, wenn sie müde nach Hause kommen. Die Lastesel schleppen die Fische aus den Booten und schneiden sie auf. Sie haben gar viel zu tun.
Georg, sein Vater, ein paar andere Fischer und ihre Mägde hatten zusammen eine Hütte. Morten wohnte in der nächsten. Eine der Mägde, Else, hatte Georg von klein auf an gekannt. Sie vertrugen sich gut miteinander und paßten in vielen Dingen gut zueinander; aber äußerlich waren sie durchaus ungleich. Er war braun von Farbe, und sie weiß mit flachsgelbem Haar. Ihre Augen waren so blau wie das Meer im Sonnenschein.
Eines Tages, als sie beisammen gingen und Georg sie herzlich und fest bei der Hand hielt, sagte sie zu ihm: »Georg, ich habe etwas auf dem Herzen, laß mich deine Magd sein; denn du bist mir wie ein Bruder, aber Morten und ich sind Brautleute. Doch lohnt es sich nicht, mit anderen darüber zu sprechen.«
Es war Georg, als ob sich der Dünensand unter ihm bewegte; er sagte kein Wort, er nickte mit dem Kopfe, und das bedeutet dasselbe wie »ja«. Mehr bedurfte es nicht. Aber er fühlte plötzlich in seinem Herzen, daß er Morten nicht leiden könnte, und je länger er darüber nachdachte, – und vorher hatte er niemals so an Else gedacht – desto klarer wurde es ihm, daß Morten ihm das Einzige gestohlen hatte, das er liebte. Und das war Else. Jetzt erst war es ihm klar geworden.
Ist die See bewegt und die Fischer kehren in ihren Booten zurück, dann sieh, wie sie über die Riffe setzen. Einer der Männer steht vorn aufrecht, die andern achten auf ihn und halten die Ruder still, welche sie vor dem Riffe seitwärts auslegen, bis er ihnen das Zeichen gibt, daß die große Welle kommt, die das Boot hinüberheben soll. Und sie hebt es, daß man vom Lande aus den Kiel zu sehen glaubt. Im nächsten Augenblick ist es ganz von der See bedeckt, weder Boot noch Fischer noch Mast ist zu sehen; man sollte glauben, das Meer hätte sie verschluckt; aber im nächsten Augenblick kommt es wie ein mächtiges Seeungeheuer hervor, das die Wogen hinaufklimmt. Die Ruder bewegen sich wie seine gelenkigen Beine. Beim zweiten und dritten Riff geht es wie beim ersten, und nun springen die Fischer ins Wasser, ziehen das Boot ans Land, und jeder Wellenschlag hilft ihnen und gibt dem Boote einen tüchtigen Stoß, bis sie es auf dem Strande haben. Ein falscher Befehl vor dem Riff – ein Zögern – und sie leiden Schiffbruch.
»Dann wäre es mit mir und mit Morten vorbei.« Dieser Gedanke kam Georg draußen auf dem Meere, wo sein Pflegevater ernstlich krank geworden war. Das Fieber schüttelte ihn. Es war ein wenig vor dem äußersten Riff, als Georg aufsprang:
»Vater, laß mich,« sagte er, und sein Blick glitt über Morten und über die Brandung hin. Aber während sich jedes Ruder in den starken Händen bewegte und die größte Woge kam, sah er in das bleiche Gesicht seines Vaters, und er vermochte der bösen Eingebung nicht nachzugeben. Das Boot kam heil über die Riffe und ans Land. Aber der böse Gedanke lag ihm im Blute: es kochte und schäumte in ihm. Jede kleine Faser, die in der Zeit ihrer Kameradschaft infolge Zwistigkeiten aus ihrem Freundschaftsbande ausgerauht war, kam ihm in die Erinnerung; doch konnte er sie nicht zu einem Tau zusammenspleißen, und deshalb ließ er es sein, Morten hatte ihn beraubt, das fühlte er, und das war genug, um ihn zu Haffen, Einige der Fischer bemerkten es, aber Morten nicht. Er war immer noch wie vorher, hilfsbereit und gesprächig, und dieses ein wenig zu viel. Georgs Pflegevater mußte sich zu Bett legen, und es wurde sein Sterbebett; er starb eine Woche später. Und so erbte Georg das Haus in den Dünen, zwar nur ein geringes Haus; aber es war doch immer etwas. So viel hatte Morten nicht.
»Nun nimmst du wohl keine Heuer mehr, sondern bleibst immer bei uns, Georg,« sagte ein alter Fischer. Diesen Gedanken hatte Georg nicht; er dachte gerade daran, sich ein wenig in der Welt umzusehen. Der Aalhändler aus Fjaltering hatte einen Onkel oben in Skagen; er war Fischer, aber zugleich wohlhabender Kaufmann, der ein Schiff besaß. Es sollte ein lieber, alter Mann sein, bei dem gut zu dienen wäre. Gammelhagen liegt an der Nordspitze Jütlands, so weit von Huusbys Dünen entfernt, wie man hierzulande nur kommen, konnte, und das war es gerade, was Georg am meisten gefiel. Er wollte nicht einmal bis zur Hochzeit Elses und Mortens bleiben, die in einigen Wochen sein sollte.
Es wäre unklug fortzugehen, meinte der Fischer. Nun, da Georg das Haus hätte, würde Else ihn sicherlich lieber nehmen.
Georg gab darauf so kurze Antwort, daß es nicht leicht war, den Sinn zu erfassen. Aber der Alte führte Else zu ihm, Sie sagte nicht viel, aber sie sagte:
»Du hast das Haus, das muß man bedenken.«
Und Georg bedachte gar viel.
Das Meer schlägt hohe Wogen, das menschliche Herz oft höhere. Manche Gedanken, starke und schwache, gingen Georg durch Kopf und Herz. Und er fragte Else:
»Wenn Morten ebenfalls ein Haus hätte, wen von uns beiden würdest du dann nehmen?«
»Aber Morten hat keins und bekommt keins.«
»Aber denke dir, daß er eins hätte.«
»Ja, dann würde ich wohl Morten nehmen, denn ihn liebe ich. Aber davon kann man nicht leben.«
Und Georg dachte die ganze Nacht an die Antwort. Es war etwas in ihm, worüber er sich aber keine Rechenschaft geben konnte. Aber er hatte einen Gedanken, und der war stärker als seine Liebe zu Else, Deshalb ging er zu Morten, und was er ihm sagte und tat, hatte er wohl überlegt. Er überließ ihm zu den billigsten Bedingungen das Haus. Er selbst wollte eine Heuer nehmen; dazu trieb es ihn. Und Else küßte ihn auf den Mund, als sie es hörte; denn sie liebte ja Morten am meisten.
Am frühen Morgen wollte Georg fort. Am Abend vorher – es war schon spät – bekam er Lust, noch einmal Morten zu besuchen. Er ging fort, und in den Dünen traf er den alten Fischer, der nicht an seine Abreise glaubte. Morten hätte sich sicherlich einen Zauber in die Hose genäht, sagte er, da die Mädchen so sehr verliebt in ihn wären. Georg schlug die Rede in den Wind, sagte Lebewohl und ging nach dem Hause, wo Morten wohnte. Er hörte drinnen laut reden. Morten war nicht allein. Georg wurde wankelmütig, mit Else wollte er nicht wieder zusammentreffen, und wenn er sich recht bedächte, sollte er lieber vermeiden, daß Morten ihm noch einmal Dank sagte, und deshalb kehrte er wieder um.. Am nächsten Morgen, ehe es Tag ward, schnürte er sein Bündel, nahm seinen Mundvorrat und ging die Dünen hinunter an den Meeresstrand, wo leichter als in den tiefen, sandigen Wegen fortzukommen und deshalb der kürzere Weg war. Er wollte zunächst nach Fjaltering bei Bovbjerg, wo der Aalhändler wohnte, dem er einen Besuch versprochen hatte.