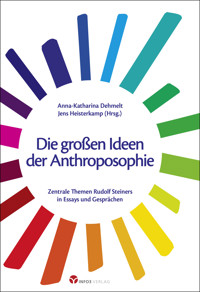
Die großen Ideen der Anthroposophie E-Book
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Info 3
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die großen Ideen der Anthroposophie: Sie wirken weiter – auch ein Jahrhundert nach dem Tod ihres Begründers Rudolf Steiner. Sie geben Denkanstöße für ein bewusstes und sinnvolles Leben. Ausgewiesene Fachleute haben sie individualisiert, aktualisiert und stellen sie gut verständlich vor: von Evolution bis Reinkarnation, von Meditation bis zum Mysterium von Golgatha, von Menschenkunde bis zu Anthroposophischer Medizin und Waldorfpädagogik. /// Zum Kennenlernen und zum Wieder-Entdecken. /// Mit Beiträgen von Anna-Katharina Dehmelt, Ruth Ewertowski, Philippp Gelitz, Christian Grauer, Gerald Häfner, Jens Heisterkamp, Wolf-Ulrich Klünker, Martin von Mackensen, Frank Meyer, Karin Michael, Bernd Rosslenbroich, Christian Schikarski und Johannes Wirz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anna-Katharina Dehmelt Jens Heisterkamp (Hrsg.)
Die großen Ideen der Anthroposophie
Zentrale Themen Rudolf Steiners in Essays und Gesprächen
Impressum
Anna-Katharina Dehmelt, Jens Heisterkamp (Hrsg.)
Die großen Ideen der Anthroposophie
Zentrale Themen Rudolf Steiners in Essays und Gesprächen
ISBN E-Book 978-3-95779-222-8
ISBN gedruckte Version 978-3-95779-221-1
Diesem E-Book liegt die erste Auflage 2025 der gedruckten Ausgabe zugrunde.
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage 2025
© Info3Verlagsgesellschaft Brüll & Heisterkamp KG
Frankfurt am Main, 2025
Satz: Frank Schubert, Frankfurt am Main
Covergestaltung: Frank Schubert, Frankfurt am Main
Info3Verlag
Kirchgartenstraße 1, 60439 Frankfurt am Main
Tel. 069 58 46 47, E-Mail: [email protected]
www.info3.de
Über dieses Buch
Die großen Ideen der Anthroposophie
Sie wirken weiter – auch ein Jahrhundert nach dem Tod ihres Begründers Rudolf Steiner. Sie geben Denkanstöße für ein bewusstes und sinnvolles Leben. Ausgewiesene Fachleute haben sie individualisiert, aktualisiert und stellen sie gut verständlich vor: von Evolution bis Reinkarnation, von Meditation bis zum Mysterium von Golgatha, von Menschenkunde bis zu Anthroposophischer Medizin und Waldorfpädagogik.
Zum Kennenlernen und zum Wieder-Entdecken.
Mit Beiträgen von Anna-Katharina Dehmelt, Ruth Ewertowski, Philippp Gelitz, Christian Grauer, Gerald Häfner, Jens Heisterkamp, Wolf-Ulrich Klünker, Martin von Mackensen, Frank Meyer, Karin Michael, Bernd Rosslenbroich, Christian Schikarski und Johannes Wirz.
Inhalt
Anna-Katharina Dehmelt und Jens HeisterkampEinleitung
Bernd RosslenbroichIn aller Evolution liegt eine Spur der Menschwerdung
Johannes WirzDas Lebendige entdecken
Frank MeyerDer Mensch – die umgekehrte Pflanze
Karin MichaelAnthroposophische Menschenkunde
Christian SchikarskiDie Dreigliederung des menschlichen Organismus
Gerald HäfnerDie Dreigliederung des Sozialen
Jens HeisterkampDie Welt erkennen
Christian GrauerSteiners Idee der Freiheit
Anna-Katharina DehmeltReinkarnation und Karma
Wolf-Ulrich KlünkerKarma und Freiheit
Anna-Katharina DehmeltAnthroposophische Schulung
Ruth EwertowskiDie drei Gesichter des Bösen
Jens HeisterkampDas Mysterium von Golgatha
Philipp GelitzDie Waldorfpädagogik
Frank MeyerDie Anthroposophische Medizin
Martin von MackensenDer biologisch-dynamische Landbau
Anna-Katharina DehmeltAuf die freien Geister kommt es an
Die Autorinnen und Autoren
Einleitung
Von Anna-Katharina Dehmelt und Jens Heisterkamp
Der Impuls zu diesem Buch hing zunächst mit Angriffen zusammen, die es gegen Rudolf Steiner und die Anthroposophie in den Medien gab. Sie waren in der Corona-Zeit besonders heftig, kommen aber in Wellen auch immer wieder. In der Zeitschrift info3 haben wir versucht aufzuklären, dagegenzuhalten und Dinge richtigzustellen. Unsere Idee war es dann darüber hinaus, nicht nur aus der Defensive heraus über Anthroposophie zu sprechen, sondern den Fokus vor allem auf das Konstruktive, auf die Fruchtbarkeit der großen Ideen Rudolf Steiners zu richten.
Daraus entstand eine Serie in unserer Zeitschrift info3. Sie begann im Oktober 2023 und ging bis Januar 2025. Es gab fast in jedem Heft einen Artikel oder ein Gespräch zu einer großen Idee, zusätzlich haben wir noch einige passende Texte aus anderen Heften hinzugefügt.
Bei den großen Ideen wollten wir einmal nicht die relativ bekannten Praxisfelder – Waldorfpädagogik, Anthroposophische Medizin, biologisch-dynamische Landwirtschaft – in den Vordergrund stellen. Sie kommen zwar auch in diesem Buch vor, aber hier soll das Augenmerk vor allem auf dem ideellen Kernbestand der Anthroposophie liegen. Dafür haben wir die wirklich großen Ideen ausgewählt, nicht die vielen kleinen, die es auch im Werk Rudolf Steiners gibt, sondern die, von denen man sagen kann, dass sie das gesamte Schaffen von Rudolf Steiner von Anfang bis zum Ende durchziehen.
Zum Beispiel das Menschenbild: Wie ist der Mensch aufgebaut, wie ist er gegliedert, wie hängt er in seinen verschiedenen Schichten mit den unterschiedlichen Schichten der Wirklichkeit zusammen? Wenn man so eine Idee, wie der Mensch vielschichtig mit der Welt zusammenhängt, in sich belebt, entsteht ein anderer Bezug zur Welt und man fängt an, anders über die Welt und sich selbst nachzudenken. Man entdeckt andere Dinge, als wenn man den Menschen nur als komplizierte Materieansammlung auffasst.
Ein anderes Thema: Was ist eigentlich Erkennen? Dass ein Erkennen der Welt grundlegend möglich ist, war ebenfalls eine der großen Ideen Rudolf Steiners. Er hat auch das Gebiet, auf dem Erkenntnis möglich ist, enorm erweitert!
Oder die Frage nach der Freiheit, ein zentrales Motiv bei Rudolf Steiner von seiner philosophischen Frühzeit bis ins Spätwerk.
Und die Idee von Reinkarnation und Karma, die das Prinzip der Freiheit in Steiners Blickwinkel gerade nicht einschränkt, sondern es erweitert. Wo kommt der Mensch her, wo geht er hin? Diese Frage umfasst letzten Endes auch den ganzen Zusammenhang der Evolution, in dem wir stehen – eine weitere große Idee.
Wenn man diese großen Ideen zusammen sieht, passt das zu dem, was Peter Sloterdijk einmal über Steiner gesagt hat: dass er derjenige Denker im 20.Jahrhundert gewesen ist, der den Menschen wieder an die Vertikalität angeschlossen hat. Das bringt es auf den Punkt: Er hat das Irdische an das Himmlische angeschlossen, das Materielle an das Geistige, den Menschen an etwas Höheres, und er hat ihn auch aus einer höheren Perspektive betrachtet.
Steiners große Ideen stehen oft konträr zum intellektuellen Mainstream unserer Zeit, aber unsere Beiträge zeigen, dass sie trotzdem verständlich und auf einer Ideenbasis aufgebaut sind. Auf die Verständlichkeit haben wir großen Wert gelegt und haben Spezialisten als Autor:innen und Gesprächspartner:innen gewinnen können, die sich jeweils sehr gut auf ihrem Feld auskennen und die Ideen aus eigener Kraft erzeugen können. Sie hätten sie selber vielleicht nicht erfinden können, aber sie können sie völlig eigenständig vertreten.
Die großen Ideen, wie sie hier vorgestellt werden, sind durchlebt von Menschen der Gegenwart. Dadurch werden sie nicht zu einer Art Lehre, sondern laden zur Diskussion ein. Sie beziehen sich auf große Fragen, und so ermöglichen die großen Ideen Sichtweisen, die das Dasein sinnvoll machen. Deswegen sind vielleicht die Anthroposophen auch so unermüdlich in ihren Praktiken und in ihren Tätigkeiten in den verschiedenen Lebensfeldern, weil sie wirklich davon überzeugt sind, dass die großen Ideen der Anthroposophie Sinn machen. Und wir hoffen natürlich, dass sich davon auch viele Menschen anregen lassen, die nicht schon in diesen Lebensfeldern tätig sind, sondern sich einfach nur einmal umsehen wollen. Insofern wünschen wir allen eine sinnstiftende Lektüre mit den Aufsätzen und Gesprächen von und mit 13 verschiedenen Menschen.
In aller Evolution liegt eine Spur der Menschwerdung
Sein Werk mit dem Titel On the Origin of Autonomy erschien im renommierten Springer Verlag New York und sein Buch über die Eigenschaften des Lebens findet sich im Verlagsprogramm des berühmten MIT in den USA. Der Evolutionsbiologe Bernd Rosslenbroich bringt seine Idee, dass Autonomie den roten Faden der Evolution bildet, auch in die internationale Forschung ein. Ein Gespräch an seinem Arbeitsort, dem Institut für Evolutionsbiologie an der Universität Witten/Herdecke.
Herr Rosslenbroich, in Ihrer langjährigen Forschung zum Thema Evolution haben Sie ein hoch interessantes Motiv herausgearbeitet: Als roten Faden der Evolution beschreiben Sie einen allmählichen Zuwachs an Autonomie. Wie sind Sie das Thema angegangen?
Als ich mit der Arbeit begann habe ich zunächst die Fachliteratur durchgekämmt, um zu sehen, ob es Vorläufer dieser Idee der Autonomie gibt. Bei manchen Autoren war es fast selbstverständlich, dass sie im Hintergrund annahmen, in der Evolution finde eine allmähliche Emanzipation von den Umweltbedingungen statt. Andere sprachen davon, dass bei den Organismen gewisse Freiheitsgrade entstehen, aber es gab keine Hauptarbeit zu diesem Thema der Autonomie. Und auch da, wo es Anklänge an ein Autonomie-Prinzip gibt, geht man schnell wieder über zu der üblichen Sicht, die Evolution durch Anpassung und Überlebensvorteile erklären will. Deshalb habe ich mich an die Detailarbeit gemacht und gesucht, ob es in der Evolution Übergänge gibt, wo ein Zuwachs an Autonomie tatsächlich wahrnehmbar und naturwissenschaftlich beschreibbar ist. In diesem Zusammenhang habe ich dann zunächst die Entstehung der Mehrzelligkeit angeschaut und das Auftreten der ersten Landwirbeltiere. An diesen Groß-Übergängen zeigte sich dann schnell, dass man dieses Prinzip eines Mehr an Autonomie bei allen großen Übergängen in der Evolution bestätigt finden kann. Mit einer physiologischen Stabilisierung eines Organismus entsteht ein Zuwachs von Flexibilität im Verhalten, das ist bei den Tieren zu beobachten und wir sehen es auch in den fossilen Zeugnissen der Menschwerdung.
Worin sehen Sie den größten methodischen Unterschied Ihres Ansatzes zur üblichen Naturwissenschaft?
Gerade die moderne Evolutionsforschung ist enorm theorielastig, insbesondere die Selektionstheorie dominiert da sehr. Für uns ist dagegen der Goetheanismus ein Leitfaden, immer wieder neu auf die Phänomene zu sehen. Selbstverständlich gibt es in der Evolution auch Selektion, aber es gibt eben noch sehr viel mehr, was bisher kaum berücksichtigt wurde. Es ist etwas sehr Schönes, dass in jüngerer Zeit in manchen Kreisen dieser Mangel auffällt und es gibt seit Beginn der 2000er Jahre international eine breite Bewegung von Forschern, die ganz neue Evolutionsansätze entwickeln. Da ist etwa von einem Third Way of Evolution die Rede, der neben den Extremen des Kreationismus, der offenkundig falsch ist, und dem Neo-Darwinismus, der alles als Folge von Anpassung und Selektion erklären will, auch andere Ideen verfolgt. Das Netzwerk hat auch eine Website, an der ich beteiligt bin.
Der Begriff der Autonomie wirkt auf Anhieb ja zunächst wie ein ur-menschlicher Begriff, den wir mit unserer eigenen Lebenserfahrung sättigen. Wie passt das in die Natur?
Es liegt wohl in der Natur der Sache, dass man in diesem Begriff das Menschliche von vornherein enthalten hat, und gleichzeitig erfährt man dadurch, wieviel Menschliches schon in der Evolution auch vor dem Auftauchen des Menschen vorhanden ist. Wir sind eben aus einer gemeinsamen Evolution hervorgegangen. Und so ist vieles, was man beim Menschen vorfindet, schon bei den Tieren vorhanden, und auf der anderen Seite ist bei den Tieren vieles da, was beim Menschen weiterentwickelt und gesteigert wird. Was bei vielen Tieren zum Beispiel in Form des Spiels schon vorhanden ist, das steigert sich dann beim Menschen zu organisierten Wettbewerben wie den Olympischen Spielen, oder auch zu Kunst! Man kann aber auch umgekehrt sagen, dass bei den Tieren, die spielen, schon so viel Anklang an Menschliches da ist, dass wir davon berührt werden – denken wir an spielende Katzen oder Hunde. Wir wissen heute, dass alle Säugetiere spielen, auch viele Vögel spielen. Und daran erleben wir etwas menschlich Verwandtes. Wenn das also so verschränkt ist in der Evolution, warum sollten wir das nicht ernstnehmen?
Wo Sie gerade die Vögel erwähnen: ein weiteres Beispiel für einen Zugewinn an Autonomie und für das, was nicht nur als Selektionsvorteil erklärbar scheint, könnte der Gesang der Vögel sein.
Tatsächlich hat mein Kollege Walther Streffer in seinem Buch Klangsphären die Autonomie-Möglichkeiten im Gesang der Vögel herausgearbeitet – meiner Ansicht nach ein Meisterwerk. Wie da eine ganz eigene Welt von Möglichkeiten hörbar wird, ein ganzer Möglichkeitsraum voller Flexibilität, der bei manchen Vogelarten schon etwas regelrecht Künstlerisches hat, eine ganz eigene Wunderwelt, die ziemlich wenig mit den Stichworten Überlebensvorteil und Selektion zu tun hat. Da entsteht in der Evolution etwas aus der Eigenaktivität der Organismen heraus.
Dieses evolutionäre Agieren aus den Organismen selbst heraus ist eine neue Kategorie in der Biologie, oder?
Ja, und da läuft derzeit international eine sehr aktive Diskussion unter dem Stichwort Agency, übersetzt etwa als „Eigenaktivität“. Dazu gibt es inzwischen ein paar sehr schöne wissenschaftliche Arbeiten. Organismen sind bisher immer als passive Größen betrachtet worden, angetrieben durch Moleküle und Gene, oder von einer Umwelt, die Forderungen an den Organismus stellt. Aber es ist immer der lebendige Organismus in seiner Ganzheit, der selbst eine Aktivität haben kann, im Unterschied zu einem bloßen Mechanismus. Im vergangenen Jahr war ich in den USA zu einer Tagung zu diesen Fragen eingeladen und man sah, es tut sich etwas. Die Idee, dass Organismen Evolution eigenaktiv vorantreiben können, wird diskutiert. Denis Noble ist etwa so ein Forscher, der sagt: Organismen sind nicht getrieben von Genen, auch nicht von angeblich egoistischen Genen, Organismen sind „Agencies“ der Evolution.
Wie ist das denn im Blick auf die Menschwerdung – gab es im Menschen selbst eine Aktivität, die uns vorangebracht hat? Dass zum Beispiel die Weiterentwicklung des Gehirns durch die angewendete Intelligenz möglich wurde?
Da muss man immer die Interdependenz sehen, die Gleichzeitigkeit verschiedener Ebenen: So, wie die Tätigkeit des Menschen seine Organisation verwandelt, so bestimmt die Organisation dann wieder die Möglichkeiten des Tätig-Werdens. Das sieht man ja auch in der jeweiligen Entwicklung eines Kindes: Seine Tätigkeiten formen die Feinstrukturen im Gehirn, und diese Feinstrukturen formen das, was möglich wird. Wenn wir diese Wechselwirkungs-Prozesse ernst nehmen, entkommen wir den engen Ursache-Wirkung-Kausalitäten des Mechanischen und sind im Organischen drinnen. Wir wirken tatsächlich aktiv mit in der Evolution.
Sie meinen also, dass wir als Menschen in frühen Vorformen bereits aktiv an der Menschwerdung mitgewirkt haben? Passt das vielleicht zu Gedanken Rudolf Steiners, wonach der Mensch – als Urbild – eigentlich das erste Wesen der Evolution gewesen ist, sich aber erst nach und nach manifestiert hat?
Es ist nicht ganz einfach, den naturwissenschaftlichen Evolutionsbegriff in Zusammenhang zu bringen mit den Evolutionsdarstellungen Rudolf Steiners, aber es gibt eine ganze Reihe von Berührungspunkten. Denn wenn tatsächlich eine Spur von Autonomieentwicklung durch die Evolution hindurchgeht, haben wir dann nicht in allem letzten Endes auch eine Spur der Menschwerdung?
Müsste mit dieser Idee der Autonomie dann nicht auch etwas Intentionales verbunden sein, etwas, das sich immer weiter entwickeln will?
Im Prinzip ja, obwohl ich es rein naturwissenschaftlich nicht begründen kann. Aber wenn es – wie man paläontologisch durchaus sagen kann – einen Trend zur Autonomie gibt, dann muss dem etwas zugrunde liegen, was den Trend hervorbringt, was ihn will. Das ist durchaus ein Forschungsfeld für mich. Mir scheint es in der Evolution so etwas wie eine Aufgabenstellung zu geben, einen möglichst plastischen Organismus zu entwickeln, der ein freiheitsfähiges Wesen ermöglicht – den Menschen. Diese Aufgabenstellung ist aber auf den verschiedenen Stufen und Ebenen der Evolution nicht festgelegt in der Art, wie sie stattfinden kann. Auf jeder Stufe wird auch experimentiert. Die Vor-Formen des Menschen mussten sich ja mit der Welt erst auseinandersetzen und nicht alle haben überlebt. Das war dann durchaus Selektion – hier hat der Darwinismus recht.
Es gibt eine Vortragsreihe Rudolf Steiners, wo er sehr konkret auf die Evolution des Menschen zu sprechen kommt, Menschengeschichte im Licht der Geistesforschung ist der Titel, wo er das Verhältnis beschreibt des geistig sich entwickelnden Menschen und der physischen Evolution. Und da heißt es, der Mensch bereitet in der Evolution seine eigene Inkarnation vor. Er arbeitet aus der geistigen Evolution heraus an der physischen Evolution, um diese so umzubilden, dass daraus ein Mensch werden kann, dass dieser Organismus eine Form erhält, die diese vielfältigen Freiheitsmöglichkeiten dann bereithält.
Was zählt denn beim Menschen zu den organischen Voraussetzungen der Freiheit?
Zunächst einmal sind das viele Merkmale, die wir mit den Säugetieren gemeinsam haben: dazu gehört unsere Physiologie mit einem stabilisierten Kreislauf und das leistungsfähige Herz mit der Herzscheidewand, das die beiden Blutkreisläufe von arteriellem und venösem Blut ermöglicht.
Inwiefern gehört das zur Autonomie?
Weil dadurch die Möglichkeit eines Blutdrucksystems entsteht, das sehr viel Energie liefern kann sowohl für unsere Eigenwärme als auch für unsere Bewegungsmöglichkeiten und nicht zuletzt für die Versorgung unseres Gehirns mit ausreichend Sauerstoff – wir wissen ja, dass schon eine kurzzeitige Unterversorgung mit Sauerstoff für das Gehirn schlimme Folgen hat. Ich will auch betonen, dass es im Grunde sehr riskant ist in der Evolution, wenn so ein komplexes und vulnerables Gebilde wie der Mensch hervorgebracht wird. All das setzt eine hohe Stoffwechselrate voraus und ein sehr leistungsfähiges Herz – wir haben etwa im Unterschied zu den Reptilien einen etwa zehnfach höheren Stoffwechsel.
Eine weitere Voraussetzung liegt in der Beweglichkeit unserer Gliedmaßen, insbesondere der Hände. Der Mensch befreit seine vorderen Gliedmaßen von der Funktion der Fortbewegung und hat zwei Hände zur Verfügung, was eine Fülle an neuen Möglichkeiten eröffnet, vor allem elementare Kulturleistungen. Das gibt es ansatzweise auch bei den Affen, aber erst beim Menschen werden die Hände wirklich frei.
Dann ist natürlich das Gehirn entscheidend. Schon in der Evolution der Primaten ist ein immer leistungsfähigeres Gehirn entstanden, das immer größer und größer wurde. Es war lange Zeit ein Rätsel, was eigentlich noch das Besondere mit dem menschlichen Gehirn ist. Wir haben zwar beim Menschen nochmals eine gewaltige Zunahme des Gehirnvolumens, besonders des Großhirns. Aber trotzdem ist die Größe allein nicht entscheidend, denn von der absoluten Größe her gibt es viel größere Gehirne bei einigen Säugetieren, man denke nur an Elefanten oder an Wale. Man hat dann versucht, die Größe des Gehirns beim Menschen mit der Körpergröße zu korrelieren, aber das ging nie ganz auf. Jetzt aber hat eine Gehirnforscherin aus Südamerika mit neuen Techniken herausgefunden, wie man die Anzahl der Neuronen je Volumeneinheit im Gehirn zählen kann. Und sie findet klar heraus, dass bei Primaten die Dichte der Neuronen viel höher ist als bei allen anderen Säugetieren. Und dieses dicht gepackte Gehirn wird beim Menschen nochmal gegenüber allen anderen Primaten wesentlich vergrößert. Damit hat das Gehirn des Menschen eine ganz einmalige Gesamtzahl von Neuronen. Und diese Neurologin hat auch eine überraschende Erklärung dafür: Sie meint, diese Verdichtung der Neuronen bei der entstandenen Gehirngröße sei durch die menschliche Fertigkeit des Kochens ermöglicht worden.
Also erst die Veredelung der Nahrungsaufnahme hat ein leistungsfähigeres Gehirn ermöglicht?
Ja, unser Gehirn braucht dermaßen viel Energie, dass es sich mit Rohkost allein nicht hätte entwickeln können.
Dieses Ergebnis wird aber manchen überzeugten Rohköstlern nicht schmecken!
Und doch trifft es zu: Wären wir Rohköstler geblieben, wären wir keine Menschen geworden. Wobei natürlich vieles Menschliche bereits, wie wir schon gesagt haben, bei den Primaten angelegt ist. Wir erleben ja auch unmittelbar, wenn wir ihnen bei ihrem Verhalten zusehen, was sie alles können. Aber diese präzise Verwendung der menschlichen Hände, das kann kein Affe. Denken wir daran, wie das gesteigert werden kann, beim Chirurgen, bei der Pianistin, was da möglich ist.
Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund Versuche, den Primaten Personenstatus und Menschenrechte zuzusprechen?
Da halte ich gar nichts von. Einen Personenstatus haben Menschen. Ich finde, man müsste vielmehr lernen, die Tiere in ihrer Eigenständigkeit schätzen zu lernen und wertzuschätzen, was für eine Wunderwelt schon das Tier darstellt. Wenn man Tiere mit dem Blick für eine wachsende Autonomie anschaut oder wenn man zu sehen lernt, was für Fähigkeiten an Sensibilität und Selbsterleben bei Tieren bereits vorhanden ist, dann müsste man eher von Tierrechten sprechen und muss sie nicht zu Menschen machen. Ich gehe selbst viel mit Tieren um und bin beispielsweise viel geritten in meinem Leben. Wenn man sich dann in so ein Pferd hineindenkt und hineinfühlt und die ganze Sensibilität dieser Tiere erlebt, dann begegnet man einer Wunderwelt an eigenem Seelischem bei diesen Tieren. Man kann sozusagen pferdisch denken und empfinden lernen! Viele Landwirte können das auch mit ihren Kühen. Und dann merkt man, es geht eigentlich gar nicht um Rechte für die Tiere, sondern man erkennt, welche Notwendigkeiten aus dem Wesen eines Tieres heraus für sein Leben zu berücksichtigen sind. Das Gute ist, dass die neuere Verhaltensforschung, vor allem in der noch jungen Wissenschaftsrichtung der Kognitiven Ethologie, allmählich beginnt, das zu verstehen.
Wenn ich Ihre Ausführungen zusammenfasse, haben wir also vielfache Formen von Autonomie bei unseren Mit-Lebewesen, aber beim Menschen noch einmal auf einer anderen Stufe, wo die Autonomie gleichsam zu sich selbst kommt?
Unser Körper gibt uns ein großes Potenzial an Autonomiefähigkeit, das dann seelisch-geistig ergriffen und weiterentwickelt werden kann. Das menschliche Selbsterleben und die Ich-Fähigkeit können das fortführen. Damit wird ein hoch autonomisierter Organismus eine wunderbare Grundlage für die Eigenständigkeit und Autonomie eines Ichs, eines sich selbst erlebenden Individuums. Und da hört für mich auch der Gegensatz von Natur und Kultur auf, es ist eine wechselseitige Interdependenz. Wieviel ist darüber diskutiert worden, dass der Mensch die Natur verlässt oder sie überwindet – so wie ich Autonomie verstehe, ist sie kein Gegensatz zur Natur. Wir brauchen unsere ganze menschliche Natur, indem wir uns autonom äußern, und dadurch wirken wir auch zurück auf unsere natürliche Organisation. So hat es im Grundsatz auch Steiner beschrieben.
Steiner war ja überzeugt, seine Freiheitsphilosophie, der ethische Individualismus, sei die Krönung des Gebäudes, das Darwin und Haeckel für die Naturwissenschaft erstrebt hatten.
Ja, das ist aus Steiners Philosophie der Freiheit. Da finden Freiheitsphilosophie und Naturwissenschaft zusammen. Und weil wir diese gemeinsame Evolution mit der Natur haben, sind wir eben auch so verantwortlich für sie. Dann verbietet sich einfach so etwas wie Massentierhaltung. Wir haben eine evolutionäre Verantwortung für die Kreatur.
Das Gespräch mit Bernd Rosslenbroich führte Jens Heisterkamp.
Das Lebendige entdecken
Bei seinen Charakterisierungen des Lebendigen – in anthroposophischer Terminologie: des Ätherischen – hat Steiner stark an Goethes Wissenschaft des Organischen angeknüpft. Wir zeichnen die Entwicklungslinien nach und zeigen die Konsequenzen eines solchen Verständnisses von Leben in verschiedenen Praxisfeldern auf.
Von Johannes Wirz
So selbstverständlich wir alle im Alltag Lebendiges vom Unbelebten unterscheiden und „ich lebe“ eine selbstverständliche Selbsterfahrung ist, ja unser Menschsein ausmacht, so schwer fällt diese Unterscheidung vielen Biologen und Medizinern – kein Wunder in einer Wissenschaftswelt, die fast nur Physik und Chemie anerkennt. Man kann diese Reduktion als unzeitgemäßen „Materialismus“ brandmarken. Doch so einfach ist die Sache nicht.
Selbst Goethe, der große Wissenschaftler des Lebendigen, hatte sich viel von der Chemie versprochen. So schrieb er in einem Brief an Wackenroder, einen pharmazeutischen Chemiker: „Es interessiert mich höchlich, inwiefern es möglich sei, der organisch-chemischen Operation des Lebens beizukommen, durch welche die Metamorphose der Pflanze bewirkt wird.“ Ihn deshalb als Vorläufer der modernen (Molekular-)Biologie zu sehen, wäre verfehlt. Vielmehr konnte er diese Hoffnung vor dem Hintergrund äußern, dass er Leben als sinnlich-geistige Erscheinungsform verstand, die sich auf jeder Beobachtungsebene zeigt, von der einzelnen belebten Gestalt bis in die Feinheit der Biochemie. Seine fundamentale Forschungsmethode beschrieb er einmal mit den Worten: „Ich suche die Idee in der Erfahrung, weil die Natur nach Ideen verfährt.“ Dieses methodische Vorgehen kann auch in der aktuellen Biologie fruchtbar gemacht werden.
Obwohl die Mehrheit der heutigen Wissenschaftler-Gemeinde Gedanken als subjektives Konstrukt betrachtet und „Geistiges“ im Allgemeinen als Hirngespinst in den Köpfen von Unaufgeklärten gilt, gibt es eine ganze Reihe von Denkern und Denkerinnen, die mehr oder weniger explizit Lebewesen im Sinne Goethes als Ganzheit erkennen. Im Lebendigen bilden Materie und Geist, Stoff und Gedanke eine ungeteilte Einheit.
Organismen müssen anders gedacht werden
Gut 100Jahre nach Goethe bemerkte Kurt Goldstein (1878–1965), ein deutsch-jüdischer Neurologe und Psychiater, der wegen des Nazi-Terrors in die USA emigrieren musste, dass die moderne Naturwissenschaft zwar ohne analytische Methoden nicht bestehen kann, dass dieselben jedoch nur einen Sinn haben, wenn ihnen ein „Gespür für den Organismus“ als Ganzes unterlegt wird. Durch die Analyse kann diese Empfindung verstärkt, doch leider auch zerstört werden.
Ein weiterer Denker, der sich mit dem Problem des Organismus beschäftigte, war der Physikochemiker Michael Polanyi (1891–





























