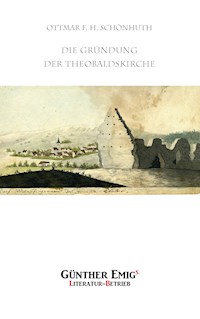
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emig, Günther
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ottmar F[riedrich] H[einrich] Schönhuth (* 1806 Sindelfingen, † 6. Februar 1864 Edelfingen, heute Bad Mergentheim) war evangelischer Pfarrer, Schriftsteller und Heimatforscher. Nach Vikariat und einer Pfarrstelle in Hohentwiel wurde er 1837 Pfarrer in Dörzbach, wechselte 1842 ins benachbarte Wachbach und 1854 nach Edelfingen. Sein Grab befindet sich in Wachbach. Bis zu seinem Tod veröffentlichte Schönhuth (Pseudonyme: Ottmar Heimlieb oder F. H. Ottmar) über 200 damals vielgelesene Bücher und Schriften, die sich vielfach mit der südwestdeutschen Geschichte (Württemberg, Baden, Bodenseeraum) mit Schwerpunkt hohenlohische Region beschäftigen. 1847 war Schönhuth Mitgründer des Historischen Vereins für Württembergisch Franken, dem er ab 1851 vorstand. Zu seinem Bekanntenkreis zählten Ludwig Uhland, Justinus Kerner, Gustav Schwab und Joseph von Laßberg, engere Freundschaft pflegte er seit 1837 mit Eduard Mörike. In seinen Erzählungen, so auch in der vorliegenden, mischt er historische Fakten mit Sagenhaftem. »Die Gründung der Theobaldskirche« erschien zusammen mit drei weiteren historischen Erzählungen 1857 und wird für die vorliegende Ausgabe ungekürzt, aber sprachlich modernisiert, neu herausgegeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ottmar Schönhuth
Die Gründung der Theobaldskirche
I. Wie Gottfried von Hohenlohe die Heineburg verläßt und in das heilige Land zieht
So malerisch und romantisch auch der Taubergrund sein mag – er ermangelt eines Reizes, an dem andere Täler des Frankentales so reich sind; nur wenige Burgen schmücken die mit Reben bekränzten Höhen zu beiden Seiten des Flusses – und wo diese fehlen, da mangelt es auch an Sagen, die sich wie der wuchernde Efeu an die Mauern der Denkmale einer kräftigen Vorzeit ranken. Doch ein Fleck des schönen Grundes ermangelt auch dieses Reizes nicht: das ist der mittlere Taubergrund von Weikersheim an, wo die Wiege des erlauchtesten, jetzt fürstlichen Geschlechts derer von Hohenlohe zu suchen ist – über die Stadt Mergentheim hin, die drei Jahrhunderte in der Geschichte des ritterlichen Deutschen Ordens eine so wichtige Rolle spielt – von da den Höhberg hinauf, wo jäh auf weichem Kalkfelsen ein niedliches Häuschen erbaut ist, das in heißen Sommertagen in seinem Grund eine Quelle des labenden Gerstensaftes birgt und von seinen Fenstern aus die wohl schönste Aussicht im ganzen Taubergrund darbietet, denn von hier aus überblickt man in lieblichster Gruppierung die Dörfer und Städtchen des Grundes bis hinunter nach Bischofsheim und zu den Höhen, hinter welchen sich die Stadt Wertheim zwischen Tauber und Main lagert.
Im nächsten Umkreis dieses freundlichen Bellevues standen in alter Zeit mehrere Burgen: von der südlichen Höhe des Kötterbergs ragte die stattliche Kätterburg (Catharine-Burg), von welcher kein Stein mehr übrig ist; ihr gegenüber prangte die stattliche Burg Neuenhaus, die einem Geschlechtszweig von Hohenlohe den Namen gab; aus dem Wachbacher Tal, das im Süden der Stadt Mergentheim sich öffnet, schaute die Ganerbenburg Wachbach hervor, deren frühere Stätte nun von zwölf Eichen überwachsen ist, welche einen lieblichen Hain bilden.
Aus der Nachbarschaft, vom linken Ufer der Tauber, wo die Ruinen der alten Theobaldskirche stehen, winkte eine vierte stattliche Burg, genannt Heineburg oder Heuneberg, deren Ursprung verschieden gedeutet wird. Die einen sagen, sie sei auf den Grundmauern einer uralten heidnischen Burg, einer Hünenburg, erbaut gewesen, andere leiten ihren Namen von dem ihres Erbauers, Heine oder Heinrich, ab, und sie hätte so viel wie Heinrichsburg geheißen.
Dieser Heinrich war der Edelherr von Weikersheim, genannt von Hohenlohe, der erste dieses erlauchten Geschlechts, welcher in der Mitte des XII. Jahrhunderts hier oben, im Angesicht des Dorfes Öttelfingen, wo er Leute und Güter besaß, sich eine Burg baute, von der herab man den Taubergrund so weit hinabsieht wie auf dem Höhberg.
Um 200 Jahre später saß auf dieser Burg ein Urenkel Heinrichs, Herr Gottfried von Hohenlohe, mit seinem Eheweib, Frau Cunegund, einer geborenen Gräfin von Wertheim. Die beiden Eheleute hatten alles, was zu einem frohen und glücklichen Leben gehört, Land und Leute, Gülten und Zinse, und standen bei jedermann im Tal, bei Hoch und Nieder, in großem Ansehen, – nur eins fehlte ihnen, ein männlicher Erbe, dem Herr Gottfried von Hohenlohe nach seinem Ableben all sein Gut hätte hinterlassen können. Beide Ehegatten fühlten sich umso mehr unglücklich bei all ihrem Reichtum und ihrer Herrlichkeit, als sie bereits das hohe Glück genossen hatten, ein liebes Söhnlein zu besitzen, welches ihres Lebens höchste Freude und Hoffnung gewesen war. Das hatte Theobald geheißen und hatte diesen Namen von Herrn Theobald, Abt zu Bronnbach, erhalten, der seiner Mutter Cunegunde Pate gewesen war und auch den Knaben getauft und über die Taufe gehoben hatte.
Bis zum sechsten Jahr blühte der Knabe Theobald lieblich und wundersam heran, da befiel ihn eine böse Krankheit, von welcher er nicht mehr genesen ist, obgleich alle Bader tauberaufwärts und -abwärts ihre Kunst an ihm versuchten. Er welkte sichtbar dahin, und nach kurzer Zeit war das blühendste Bild des Lebens in das Bild des Todes verwandelt. Vater und Mutter sanken trostlos am Sarg des geliebten Kindes nieder und wichen nicht mehr von demselben, bis man seine irdischen Reste in der kleinen Kapelle der Burg in die Tiefe senkte.
Seitdem sah man Herrn Gottfried von Hohenlohe nicht mehr fröhlich. Er, der einer der freudigsten und geselligsten Ritter im ganzen Taubergrund gewesen war, führte seit dem Tod seines Söhnleins ein einsames und verschlossenes Leben mit seiner ebenso tieftrauernden Hausfrau, die seitdem nicht mehr das Trauergewand ablegte. Weder bei einer Jagd noch bei einem Zechgelage fand sich der Edelherr mehr ein, der in sonstigen Zeiten nie gefehlt hatte. Sonst hatte er einen Tag über den anderen seine Vettern auf dem nahen Neuenhaus heimgesucht; jetzt trug ihn sein Roß nicht mehr den Berg hinab und hing im Stall traurig den Kopf, den es früher bei so manchem Ritter talauf- oder -abwärts so stolz getragen hatte. Früher war auf der Heineburg ein Ab- und Zureiten von Gästen, die kamen oder gingen, und nie war der Rittersaal leer von Rittern und Edlen, die den gastfreundlichen geselligen Edelherrn von Hohenlohe heimsuchten. Bald kamen die edlen Vettern von Neuenhaus, bald von der benachbarten Burg Wachbach die edlen Riche von Mergentheim oder stellte sich der Deutschordenskomtur mit etlichen Brüdern ein, ja selbst der Deutschmeister verschmähte es nicht, seinen edlen Nachbarn auf Heineburg heimzusuchen, wenn er ein Stündchen frei von Ordensgeschäften und in heiterer Geselligkeit zubringen wollte. Aber seit dem traurigen Verlust, den der Edelherr erlitten hatte, blieben alle Gäste aus, denn sie sahen bald, daß sie im Haus der Trauer nicht mehr gern gesehen waren; auch war es kein großer Gewinn mehr, um den Edelherrn von Hohenlohe auf Heineburg zu sein, denn er blickte ja nur düster und griesgrämig, der zuvor mit seiner heiteren Laune Ritter und Herren, geistliche wie weltliche, bestens unterhalten hatte. Bald war die Heineburg nicht nur eine verschlossene, sondern auch von jedermann gemiedene Burg, und die Ritter und Herren im Tal, wenn sie von Herrn Gottfried von Hohenlohe redeten, nannten ihn nur den Klausner oder Betbruder auf Heineburg.
War das eine nicht falsch, so war auch das andere wahr. Seit dem Tod seines lieben Söhnleins hatte sich Herr Gottfried nicht nur von dem Getümmel und der Lust dieser Welt zurückgezogen, sondern sich auch vom Irdischen Gott zugewendet. Wie gleichgültig war er in früheren Tagen gegen Kirche und Gotteswort gewesen – seit sein Herz so voll Leids war, suchte er Trost da, wo er ihn sonst nie gesucht hatte, im Gebet und in der Andacht, und man sah ihn tagtäglich neben seiner frommen Gemahlin in der Burgkapelle in Andacht knien; aber er tröstete und stärkte sich nicht nur mit ihr im Gebet, sondern sie sprachen auch im Gebet und heißem Flehen einen Wunsch aus, der ihr beider Herz erfüllte: es möge der liebe Gott ihnen wieder seine Gnade zuwenden und ihren schweren Verlust wieder ersetzen, indem er ihnen einen neuen Erben schenke. Aber Herrn Gottfrieds wie seiner Ehefrau inniger Wunsch und ihr heißes Flehen wurden nicht erhört, denn Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Es verging ein Jahr über das andere, und ihre Sehnsucht wurde nicht erfüllt.
Da dachte Herr Gottfried bei sich, er müßte es vor Gott verschuldet haben, einmal, daß ihm dieser sein hoffnungsvolles Söhnlein in seiner schönsten Jugendblüte entrissen hatte, und dann, daß er sein und seiner Ehefrau heißes Gebet nicht erhörte und ihnen keinen Erben mehr schenke, der sie für ihren herben Verlusts entschädige und ihnen wieder des Lebens Trost und Hoffnung würde. Darum dachte er, den lieben Gott, welchen er durch seine Sünde beleidigt hatte, durch ein gutes Werk zu versöhnen und sich wieder seine Gnade und Huld zu verdienen.
So wurde der Gedanke in ihm rege, eine Fahrt ins heilige Land zu machen und am Grab des Heilandes um Verzeihung seiner Schuld und Wiedererlangung der sittlichen Gnade und Barmherzigkeit zu bitten. Der Gedanke wurde im Herzen des Edelherrn bald zum Gelübde, dessen Erfüllung er nicht lange hinausschieben wollte.
Eines Morgens, nachdem er die Nacht hindurch in schweren und trübseligen Gedanken zugebracht hatte, trat er vor seine Ehefrau und sprach wie einst der edle Moringer: »Mich verlangt es, nach dem heiligen Land zu ziehen, mein liebes Eheweib, denn nur auf solche Weise mag ich den zu versöhnen, der seine Gnade von uns gewendet hat und unseres Herzens Wunsch unerhört läßt; wohl mag er mir wieder ein gnädiger Gott sein, wenn ich meine Sünde büße auf dieser Fahrt, die ich längst gelobt habe; ich will mich aufmachen, denn Tag und Nacht mahnt mich mein Gelübde und läßt mir keinen Frieden, bis ich ihm Genüge getan habe.«
Mit trauriger Miene vernahm Frau Cunegunde, was ihr Gemahl sprach, doch sie widersprach nicht, so schmerzlich auch der Gedanke für sie war, daß ihr Gemahl sie verlassen würde und sie dann einsam und allein auf der Burg ihre Tage verleben sollte; sie sprach nur ganz demütig: »Wenn Ihr von dannen zieht, mein lieber Gemahl, wer ist es dann, dem Ihr Eure Burg sowie Land und Leute anvertrauen wollt? Und wenn auch das alles wohl geborgen und gut verwaltet wäre, wer soll mein Pfleger sein und mich in seine Obhut nehmen, bis Ihr wiederkehrt von Eurer Fahrt?«
»Wer meine Burg, Land und Leute in seine Obhut nehmen soll?« entgegnete der Edelherr. »Darum bin ich nicht verlegen. Habe ich nicht manchen Ritter und Dienstmann, der von uns Gut und Ehre hat? Die werden sich meiner Güter und Leute wohl annehmen. Und sind nicht ganz nahe meine Vettern auf Neuenhaus, die sich gern der Obhut meines Eigentums unterziehen? Vor allem aber möchte es mein Nachbar und Lehensmann sein, der uns gerade gegenüber dort unten an der Tauber sitzt, Herr Weiprecht Martin von Mergentheim, gesessen zu Balbach, der uns in Treue zugetan ist; der wird meine Güter in seine Obhut nehmen und auch Euch, mein liebes Weib, ein Pfleger sein, der Euch in ganzer Treue zugetan ist.«
»Und das glaubt Ihr, mein Herr und Gemahl?« sprach Frau Cunegunde mit einem fragenden Blick. »Ihr glaubt, daß Herr Weiprecht Martin drüben zu Balbach Euer treuer Nachbar und Lehensmann sei? Ich will Euch in diesem Glauben lassen, und Ihr könnt Eure Burg, auch Land und Leute in seine Obhut geben, aber wenn Ihr beharrt auf Eurem Entschluß und mich allein lassen wollt, so sorgt dafür, daß er in Eurer Abwesenheit nie unsere Burg betritt! Sein Tritt über die Schwelle des Hauses wäre nur Unheil und Unsegen, denn er ist ein Mann voll Neid und Habsucht, der es nimmermehr redlich mit uns meint.«
»So soll mein Burgvogt über mein Gut allein schalten und walten an meiner Statt«, entgegnete der Edelherr. »Euch aber will ich in die Obhut der geistlichen Frauen drunten in unserem Dorf geben, wenn Ihr damit einverstanden seid. Die Frauen werden Euch pflegen in Treue und Euch trösten in der Einsamkeit, wenn ich fern von Euch bin.«
»Euer Wille ist auch mein Wille«, sprach die Edelfrau. »Handelt, wie Ihr es für richtig haltet, aber um eins bitte ich Euch, mein lieber Gemahl, kehrt recht bald zurück, auf daß nicht das Leid und der Gram um Euch mich verzehre, denn ohne Euch wird mir das Leben ein freudloses und leidiges sein, selbst wenn ich auch in einem Kaiser- oder Königspalast lebte.«
Über solche Liebe seiner Gemahlin war Herr Gottfried von Hohenlohe bis ins Innere gerührt, so daß ihm die Tränen aus den Augen flossen, und gern hätte er sein Vorhaben aufgegeben, aber er hatte vor Gott das Gelübde getan, die Fahrt ins heilige Land zu vollbringen. Er schlang die Arme um seine Gemahlin, drückte sie brünstig an sein Herz und küßte sie mit weinenden Augen, indem er sagte: »Ja, ich will wiederkommen, meine teure Gemahlin, in kürzester Frist, wenn ich das Land gesehen habe, wo unser Herr und Heiland gelebt und gelitten hat, wenn ich gekniet habe an heiliger Stätte, wo er im Grab lag, wenn ich da um das gefleht habe, was seither der Gegenstand unseres Gebets und Flehens gewesen war, aber der liebe Gott hat uns unerhört gelassen. Dann, wenn ich das vollbracht habe, will ich auf Flügeln der Sehnsucht wieder in Eure Arme eilen, und nichts im Leben soll mich mehr von Euch trennen.«
Er drückte seine Gemahlin noch einmal an sein Herz, küßte sie innig und herzlich und weinte noch mehr als zuvor, so daß Frau Cunegunde wohl fühlte, wie schmerzlich ihm der Abschied würde.
Noch am selben Tag bestellte er sein Haus, übergab alles, was er hatte, seinem treuen Burgwart und führte seine Gemahlin noch hinunter ins Dorf Öttelfingen zu den geistlichen Frauen, die da lebten, empfahl sie angelegentlich in ihre Obhut und verhieß ihnen hoch und heilig, wenn sie in Treue sich seiner herzgeliebten Gemahlin mit Rat und Tat annehmen würden, wollte er ihrer, sobald er vom heiligen Lande wiederkehrte, in Dankbarkeit gedenken und ihr Kloster mehren an Gülten und Gütern, daß keines am Ufer der Tauber dem ihrigen gleich käme an Reichtum und Ansehen.
Als ihm die Meisterin des Klosters, Frau Apollonia, eine geborene Sützelin von Mergentheim, samt ihren Schwestern alles Liebe und Gute versprochen hatte, wie sie die edle Burgfrau in seiner Abwesenheit pflegen und trösten wollte in trübseligen Stunden, übergab er ihr schon im voraus als Beweis seiner Erkenntlichkeit ein schweres Beutelchen mit Goldgülden, auch damit sie mit ihren frommen Schwestern im Gebet seiner gedächte, wenn er übers Meer führe. Dann führte er seine Gemahlin mit eigener Hand in die Zelle, welche ihr von der Meisterin als künftige Wohnung bestimmt war, und hier sagte er der Vielgeliebten ein schmerzliches Lebewohl, auf das sie schon seit dem frühen Morgen vorbereitet war.
Das war ein schweres Scheiden, wie es noch selten geschehen ist zwischen zwei liebenden Eheleuten. Vor Schluchzen und Weinen konnte die Vielgetreue kein Wort hervorbringen, sie zitterte und bebte in den Armen des Gemahls, und lange ruhte ihr totenblasses Antlitz an seinem von Jammer und Leid gepreßten Herzen – dann schlang sie krampfhaft ihre beiden Arme um ihn und wollte ihn nicht von sich lassen. Erst als er das Wort rief: »Gott will es so!« und seinen Mund zum letzten Mal auf ihre bebenden Lippen preßte, ließ sie ihn aus ihrer Umarmung, aber sie sank ohnmächtig zu Boden, so daß er die geistlichen Frauen herbeirufen mußte, um ihr Hilfe zu leisten.
Als sie mit deren Untrstützung wieder zu sich kam, war ihr Gemahl schon aus der Zelle verschwunden, war wieder auf der Heineburg angekommen, nahm dort Pilgergewand und Stab, und in kurzer Zeit wandelte er mit bloßen Füßen aufwärts die Tauber und trat seine Pilgerfahrt an.
II. Von Klosterpraktiken
Das Kloster, in welches Herr Gottfried von Hohenlohe seine Gemahlin während seiner Pilgerfahrt in Obhut gab, lag in der Nähe der uralten Ortskirche und war eine Klausur geistlicher Frauen des Benediktinerordens wie die Klausuren zu Neunkirchen und Wachbach. Die Martine von Mergentheim, seßhaft zu Nieder-Balbach, hatten schon vor mehr als 100 Jahren dieses Kloster gestiftet und sich deswegen die Vogtei über dasselbe seit ewigen Zeiten vorbehalten, ebenso wie auch das Recht, daß immer eine Meisterin aus dem Geschlecht der Martine, Sätzel oder Riche von Mergentheim gewählt werden mußte. Also stand das Kloster immer in gewissen Beziehungen zu den Herren dieses Geschlechts. Besonders stand Frau Apollonia, die damalige Meisterin, mit Herrn Weiprecht Martin, ihrem Vetter und Vogtherrn, auf freundlichem Fuß, was aber weder die Schwestern der Klausur noch sonst die Bewohner des Dorfes mißdeuteten.
Es wußte ja jedermann, daß Herr Weiprecht ein Sohn Herrn Rüdegers war, dieser Rüdeger aber war ein Bruder Herrn Bernigers von Mergentheim, der ein Vater der Frau Apollonia gewesen war; also waren beide leibliche Geschwisterkinder. Darum achtete man nicht darauf, wenn Herr Weiprecht, der in den letzten Jahren sein Eheweib durch den Tod verloren hatte, manchmal von Balbach herauf kam und im Kloster vorsprach. Ihm als seinem Vogtherrn durfte ohnedies die Pforte nicht verschlossen bleiben; die Meisterin hatte auch nicht nötig, ihn durchs Sprachgitter zu sprechen, sondern sie durfte mit ihm jederzeit unter vier Augen Zwiesprache halten.
Noch keine zwei Tage war die Burgfrau von Heineburg in der Mitte der geistlichen Frauen, so fand sich schon Herr Weiprecht Martin im Kloster ein und hielt geheime Zwiesprache mit der Meisterin, denn er hatte gehört, daß Herr Gottfried von Hohenlohe seine Burg verlassen hatte. Wie es um diese Sache stehe, wohin dieser seine Fahrt mache, warum er sie unternehme und wie lange er ausbleibe, auch wem die Obhut der Burg übergeben worden sei, darüber wollte er nun von seiner Base Bescheid erhalten – und wo konnte er dies besser als bei ihr?
Überhaupt waren in jener Zeit solche geistliche Sammlungen in Städten und Flecken die Orte, wo alle Neuigkeiten, die sich in der Nähe und Ferne begaben, trotz der Klausur Eingang fanden und besprochen wurden, denn es wäre von Frauen zuviel verlangt, wenn sie bei ihrem sonstigen Abschluß von der Welt so ganz und gar die angeborene Neugierde bemeistern müßten und sich gar nicht mehr um die Angelegenheiten der Welt bekümmern dürften.





























