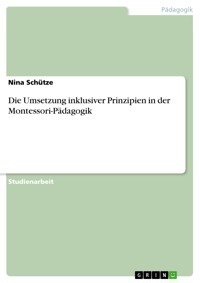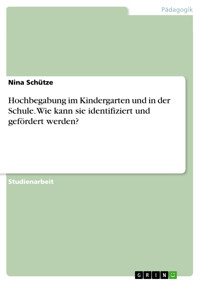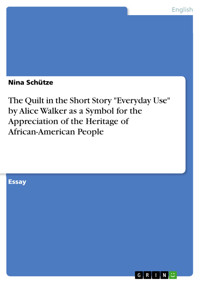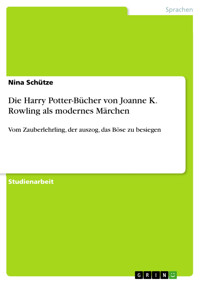
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Literaturwissenschaft - Moderne Literatur, Note: 1,0, Universität Bielefeld (Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft), Veranstaltung: Phantastische Kinderliteratur, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Hausarbeit wird die Romanreihe daraufhin untersucht, ob sie dem Genre der Märchen zugeordnet werden kann. Dazu werden Merkmale von Volks- und Kunstmärchen erläutert und es wird untersucht, inwieweit diese Merkmale in den "Harry Potter"-Büchern vorzufinden sind. Dies führt dann zu einem abschließenden Fazit, in dem die Frage beantwortet wird, inwieweit die Romanreihe Ähnlichkeiten mit dem Genre der Märchen aufweist und wie andere Autoren die Bücher einordnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Abgrenzung und Definition von Volksmärchen und Kunstmärchen
2.1 Das Volksmärchen
2.2 Das Kunstmärchen
3. Die Harry Potter-Reihe als Märchenbuchreihe
3.1 Analyse der Harry Potter-Reihe in Hinblick auf allgemeine Merkmale von Volks- und Kunstmärchen
3.2 Märchenmotive in der Harry Potter-Reihe
4. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Es war einmal ein Junge, dessen Eltern waren gestorben. Deshalb lebte er bei seiner Tante und seinem Onkel. Der Junge wurde von den beiden schlecht behandelt und er wohnte in einem Schrank. Seine Tante und sein Onkel hatten auch einen eigenen Sohn und auch der behandelte den Jungen schlecht und verfolgte ihn zusammen mit seiner Bande. Eines Tages jedoch kam ein Halbriese zu dem Jungen und verkündete ihm, dass er ein Zauberer sei…
Dies klingt wie der Anfang eines Märchens, ist jedoch der Anfang der Harry Potter–Reihe von Joanne K. Rowling nacherzählt im Stile eines Märchens. Im Rahmen dieser Hausarbeit möchte ich untersuchen, ob und inwieweit die Bücher dieser Reihe der Gattung der Märchen zugeordnet werden können. Zudem werde ich genauer betrachten, was unter dem Ausdruck „im Stile eines Märchens“ zu verstehen ist und warum diese Nacherzählung an ein Märchen erinnert.
Dazu möchte ich zunächst den Begriff „Märchen“ näher untersuchen. Für diesen Zweck werde ich eine Definition der Märchenformen Volksmärchen und Kunstmärchen vornehmen, die als Grundlage für die Untersuchung der Harry Potter–Reihe dienen wird. Im Folgenden werde ich dann die Buchreihe Rowlings auf Merkmale von Volks- und Kunstmärchen untersuchen und anschließend daraufhin analysieren, ob diese bekannte Motive aus Märchen enthält. Hierzu werde ich als Vergleichsmaterial die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm hinzuziehen. Abschließend werde ich ein Fazit ziehen, in dem ich versuche, die Frage zu klären, ob die Bücher zu der Gattung der Märchen gehören.
Zunächst möchte ich aber zwei Anmerkungen zu der Hausarbeit machen. Ich beziehe mich im Rahmen dieser Hausarbeit auf die deutsche Übersetzung der Harry Potter
2. Abgrenzung und Definition von Volksmärchen und Kunstmärchen
Im Rahmen dieser Hausarbeit werde ich die Harry Potter-Reihe daraufhin zu untersuchen, ob diese der Gattung der Märchen zuzuordnen ist. Dies definiere ich so, dass sie Merkmale von Volksmärchen oder Kunstmärchen aufweisen muss, um zu dieser Gattung zu gehören. Dazu möchte ich im Folgenden die beiden genannten Märchenformen und ihre Merkmale zunächst definieren.
2.1 Das Volksmärchen
Das Volksmärchen weist verschiedene typische Merkmale auf, die vor allem die Handlung, die Figuren und die Sprache des Märchens betreffen. Ein Merkmal ist die einsträngige Handlung, in der es keine Nebenhandlungen gibt (vgl. Lüthi 1968, S. 74) und die schnell voranschreitet (vgl. Lüthi 2004, S. 29). Das Geschehen im Märchen ist sowohl ortlos als auch zeitlos, es werden also keine Ort- oder Zeitangaben gemacht (vgl. Neuhaus 2005, S. 5), und das Volksmärchen hat typischerweise ein Happy End (vgl. Lüthi 2004, S. 25). Im Allgemeinen geht es um die Bewältigung von Schwierigkeiten (ebd.). Dabei wird meist der Held zu Beginn des Märchens mit einem Problem oder einer Mangelsituation konfrontiert, die er im Verlauf des Märchens bewältigen muss (vgl. Neuhaus 2005, S. 5). Der Held des Märchens und seine Gegner sind dabei die hauptsächlichen Handlungsträger (vgl. Lüthi 2004, S. 27). Häufig treten Figuren wie Könige oder Prinzessinnen auf, die eine bestimmte gesellschaftliche Position repräsentieren, aber auch Figuren wie Vater und Mutter, die die familiären Verhältnisse darstellen sollen (ebd.).
Zusätzlich zeichnet sich das Volksmärchen laut Max Lüthi (2004) dadurch aus, dass es über längere Zeit mündlich weitergegeben und dadurch verändert wurde und deshalb keinen Verfasser habe (vgl. S. 5). Stefan Neuhaus (2005) sieht diese Definition dagegen als nicht richtig an, da jedes Werk einen Autor habe, auch wenn dieser nicht mehr bekannt sei (vgl. Neuhaus 2005, S. 3). Im Rahmen dieser Hausarbeit bleibe ich in diesem Punkt bei der Definition Lüthis. Die Sprache im Volksmärchen ist einfach gehalten. Es werden vor allem Hauptsätze benutzt, das Vokabular beinhaltet keine schwierigen Wörter und auch die Symbolik ist sehr einprägsam (vgl. Neuhaus 2005, S. 5). Als Beispiel hierfür können die Symbolzahlen 3, 4, 7, 12 und 13 genannt werden, die oft im Volksmärchen auftauchen (ebd.).