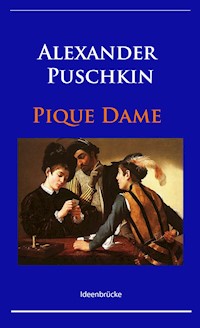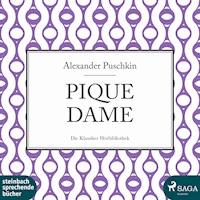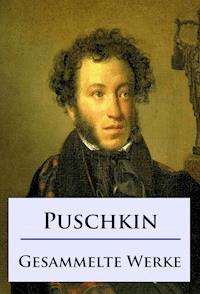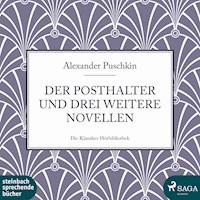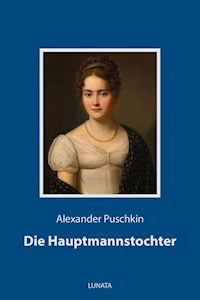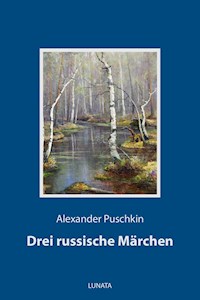9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Russland im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Bauernaufstände. Der junge Adlige Grinjow versieht seinen Dienst als Offizier in der tiefsten Provinz – und verliebt sich in Mala, die Tochter des örtlichen Kommandanten. Als er in einem heftigen Schneesturm einem Mann das Leben rettet, ahnt er nicht, dass es sich um Pugatschow, den Anführer der Aufständischen, handelt und dass schon bald sein eigenes Schicksal und das seiner großen Liebe in dessen Händen liegen werden. Die Hauptmannstochter (1836) ist Puschkins berühmtestes Prosawerk und gilt als wichtigster Vorläufer für Tolstojs Krieg und Frieden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Rußland im 18. Jahrhundert zur Zeit der Bauernaufstände. Der junge Adlige Grinjow versieht seinen Dienst als Offizier in der tiefsten Provinz – und verliebt sich in Mala, die Tochter des örtlichen Kommandanten. Als er in einem heftigen Schneesturm einem Mann das Leben rettet, ahnt er nicht, daß es sich um Pugatschow, den Anführer der Aufständischen, handelt und daß schon bald sein eigenes Schicksal und das seiner großen Liebe in dessen Händen liegen werden.
Die Hauptmannstochter (1836) ist Puschkins berühmtestes Prosawerk und gilt als wichtigster Vorläufer für Tolstois Krieg und Frieden.
Alexander Sergejewitsch Puschkin wurde 1799 in Moskau als Sohn eines adligen Gardeoffiziers geboren und starb 1837 in Sankt Petersburg an den Folgen einer Schußverletzung nach einem Duell. Als Lyriker und Schriftsteller war er zeitlebens provokant, seine Werke unterlagen der Zensur. Er ist einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller, zu seinen bekanntesten Werken zählen u. a. Eugen Onegin, Boris Godunow und Die Hauptmannstochter.
Alexander PuschkinDie Hauptmannstochter
RomanAus dem Russischenvon Arthur Luther
Umschlagabbildung: Karl Brüllow, Bildnis U. M. Smirnova(Ausschnitt), 1837-1840Russisches Museum, Sankt Petersburg
eBook Insel Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4318
© Insel Verlag Frankfurt am Main 1973
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Hinweise zu dieser Ausgabe am Schluß des Bandes
Umschlaggestaltung: Anke Rosenlöcher, Berlin
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Die Hauptmannstochter
Hüte deine Ehre von Jugend auf.
Sprichwort
Erstes Kapitel
Der Sergeant der Garde
»Als Hauptmann stell ich ihn gleich in die Garde ein.«»Ach was! Bei der Armee soll er sich erst bewähren!«»Sehr wahr! Da wird man ihn den richt'gen Dienst schon lehren …«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»Wer ist sein Vater gleich?«
Knjashnin
Mein Vater, Andrej Petrowitsch Grinjow, hatte in seiner Jugend unter dem Grafen Münnich gedient und 17. . als Premiermajor seinen Abschied genommen. Seitdem lebte er auf seinem Gut im Simbirskischen, wo er auch die Jungfrau Awdotja Wassiljewna Ju., die Tochter eines dortigen armen Edelmannes, heiratete. Wir waren neun Kinder. Alle meine Brüder und Schwestern starben im Säuglingsalter.
Meine Mutter ging noch mit mir schwanger, als ich dank der Güte des Gardemajors Fürst B., eines nahen Verwandten von uns, bereits beim Semjonowskij-Regiment als Sergeant eingeschrieben wurde. Hätte meine Mutter wider alles Erwarten eine Tochter geboren, so hätte mein Vater gehörigen Ortes den Tod des nicht erschienenen Sergeanten gemeldet und die Sache wäre damit erledigt gewesen. Ich galt als beurlaubt bis zum Abschluß meiner Studien. Dazumal wurden wir nicht so erzogen wie heutzutage. Von meinem fünften Jahre an ward ich der Obhut unseres Reitknechts Saweljitsch anvertraut, der für sein gutes Betragen – er trank nicht – zu meinem Erzieher ernannt worden war. Unter seiner Aufsicht lernte ich als Zwölfjähriger Russisch lesen und schreiben und konnte sehr sachverständig über die Eigenschaften eines Windhundes reden. Um diese Zeit engagierte mein Vater einen Franzosen für mich, Monsieur Beauprès, den er mit dem Jahresvorrat an Wein und Olivenöl aus Moskau kommen ließ. Seine Ankunft war Saweljitsch höchst unerwünscht. »Das Kind ist, scheint's, doch gewaschen, gekämmt und satt«, brummte er vor sich hin. »Wozu noch unnötig Geld hinauswerfen und einen Musjö halten, als hätte man nicht genug eigene Leute.«
Beauprès war in seiner Heimat Friseur gewesen, später in Preußen Soldat; endlich kam er nach Rußland pour être outchitel, ohne sich über den Sinn dieses Wortes recht klar zu sein. Er war ein guter Kerl, aber leichtsinnig und liederlich bis zum äußersten. Seine Hauptschwäche war die Leidenschaft für das schöne Geschlecht; für seine Zärtlichkeiten erhielt er öfters Püffe, über die er tagelang stöhnte. Außerdem war er (wie er sich auszudrücken liebte) kein Feind der Flasche, das heißt (um es gut russisch zu sagen), er trank gern eins über den Durst. Da Wein bei uns aber nur zu Mittag serviert wurde und auch da nur ein kleines Gläschen für jeden, wobei man den Herrn Lehrer meist noch überging, so gewöhnte sich mein Beauprès sehr bald an den russischen Fruchtschnaps und zog ihn sogar den Weinen seines Vaterlandes vor, da er für den Magen ungleich bekömmlicher wäre. Wir wurden bald einig, und obgleich er laut Vertrag verpflichtet war, mich im Französischen, Deutschen und allen Wissenschaften zu unterrichten, zog er es vor, von mir in aller Eile etwas Russisch schwatzen zu lernen, und danach beschäftigte sich jeder von uns nur noch mit seinen eigenen Angelegenheiten. Wir waren ein Herz und eine Seele. Einen anderen Mentor wünschte ich mir gar nicht. Aber bald trennte uns das Geschick, und das kam so:
Die Wäscherin Palaschka, ein dickes, pockennarbiges Mädchen, und die einäugige Kuhmagd Akulka waren eines Tages übereingekommen, gleichzeitig meiner Mutter zu Füßen zu fallen, sich selbst verbrecherischer Schwäche zu zeihen und sich mit Tränen über den Musjö zu beklagen, der ihre Unwissenheit verführt hätte. Meine Mutter verstand in diesen Dingen keinen Spaß und beklagte sich beim Vater. Der machte kurzen Prozeß. Er ließ die Kanaille von einem Franzosen sofort holen. Ihm wurde gemeldet, Musjö erteile mir gerade Unterricht. Der Vater begab sich in mein Zimmer. Zu der Zeit schlief Beauprès auf seinem Bette den Schlaf der Unschuld. Ich aber war ernsthaft beschäftigt. Es muß gesagt werden, daß man für mich aus Moskau eine Landkarte verschrieben hatte. Sie hing völlig ungenützt an der Wand und lockte mich schon längst durch ihre Größe und die gute Qualität des Papieres. Ich beschloß, einen Drachen aus ihr anzufertigen, und machte mich, da Beauprès so schön schlief, an die Arbeit. Mein Vater kam gerade in dem Augenblick herein, als ich einen Bastschwanz an das Kap der Guten Hoffnung befestigte. Als er mich bei diesen geographischen Übungen überraschte, zupfte der Vater mich kräftig am Ohr, lief dann zu Beauprès, weckte ihn höchst unsanft und überschüttete ihn mit Vorwürfen. Beauprès, in größter Verlegenheit, wollte sich aufrichten und konnte es nicht: Der unglückselige Franzose war sternhagelvoll. Nun wurde mit allem Unglück auf einmal aufgeräumt. Vater packte ihn am Kragen, riß ihn vom Bett herunter, warf ihn zur Tür hinaus und jagte ihn noch am selben Tage aus dem Hause zur unbeschreiblichen Freude des guten Saweljitsch. Damit war meine Erziehung abgeschlossen.
Ich lebte nun als junger Tunichtgut weiter, stellte den Tauben nach und übte mich mit den Hofjungen im Bockspringen. So wurde ich sechzehn Jahre alt. Da trat eine Wendung in meinem Schicksal ein.
Einmal im Herbst kochte meine Mutter im Gästezimmer Honigsirup, ich guckte auf den wallenden Schaum und leckte die Lippen. Vater saß am Fenster und las im »Hofkalender«, den er sich alljährlich kommen ließ. Dieses Buch wirkte immer sehr stark auf ihn: Er las es nie ohne besondere seelische Anteilnahme, und die Lektüre brachte stets seine Galle in erstaunliche Erregung. Die Mutter, die alle seine Neigungen und Gewohnheiten genau kannte, suchte das unselige Buch immer möglichst weit zu verstecken, und so kam der »Hofkalender« ihm oft monatelang nicht zu Gesicht. Wenn er ihn aber zufällig einmal fand, so ließ er ihn dafür auch stundenlang nicht mehr aus den Händen. Also mein Vater las im »Hofkalender«, zuckte ab und zu die Achseln und brummte vor sich hin: »Generalleutnant! … Er war in meiner Kompanie Sergeant! – Ritter beider russischer Orden! … Und wie lang ist's her, daß wir …« Endlich warf Vater den Kalender auf das Sofa und versank in tiefes Sinnen, das nichts Gutes erwarten ließ.
Plötzlich wandte er sich an die Mutter: »Awdotja Wassiljewna, wie alt ist eigentlich Petruscha?«
»Er ist im siebzehnten Jahre«, antwortete Mutter. »Er ist in dem Jahre geboren, wie Tante Nastasja Gerassimowna ihr Auge verlor und wie …«
»Schon recht«, unterbrach sie der Vater. »Es ist Zeit, daß er in den Dienst kommt. Er hat sich lange genug in den Mägdekammern herumgetrieben und ist in den Taubenschlag geklettert.« Der Gedanke der baldigen Trennung von mir überraschte die Mutter so, daß sie den Löffel in den Kessel fallen ließ und Tränen über ihre Wangen flossen. Dagegen läßt sich mein Entzücken schwer beschreiben. Der Gedanke an den Dienst verschmolz mir mit dem Gedanken an vollkommene Freiheit, an die Vergnügungen des Petersburger Lebens. Ich sah mich als Gardeoffizier, was nach meiner Meinung den Höhepunkt menschlicher Seligkeit bedeutete.
Vater mochte weder seine Absichten ändern noch ihre Ausführung hinausschieben. Der Tag meiner Abreise wurde festgesetzt. Am Abend vorher erklärte Vater, er werde mir einen Brief an meinen künftigen Vorgesetzten mitgeben, und verlangte Feder und Papier.
»Vergiß nicht, Andrej Petrowitsch«, sagte Mutter, »den Fürsten B. auch von mir zu grüßen. Sag ihm, ich hoffe, daß er sich Petruschas freundlich annehmen wird.«
»Was für ein Unsinn!« sagte mein Vater und runzelte die Stirn. »Weshalb sollte ich an den Fürsten B. schreiben?«
»Du hast doch gesagt, du wolltest an Petruschas Vorgesetzten schreiben.«
»Nun ja, und was weiter?«
»Petruschas Vorgesetzter ist doch der Fürst B. Petruscha ist doch beim Semjonowskij-Regiment eingeschrieben.«
»Eingeschrieben! Was geht's mich an, wo er eingeschrieben ist? Petruscha kommt nicht nach Petersburg. Was soll er in Petersburg im Dienst lernen? Geld ausgeben und Streiche verüben? Nein, in der Armee soll er dienen, von der Pike auf, und Pulver riechen und ein Soldat werden, kein Tagedieb. Bei der Garde eingeschrieben! Wo ist sein Paß! Zeig ihn her!«
Mutter holte meinen Paß, den sie in ihrer Schatulle mit meinem Taufhemdchen aufbewahrte, und reichte ihn mit zitternder Hand dem Vater. Der Vater las ihn aufmerksam durch, legte ihn vor sich auf den Tisch und fing an, seinen Brief zu schreiben.
Die Neugierde plagte mich. Wohin sollte ich denn kommen, wenn nicht nach Petersburg? Ich wandte die Augen nicht von Vaters Feder, die sich recht langsam vorwärts bewegte. Endlich war er fertig, versiegelte den Brief, steckte ihn zusammen mit dem Paß in einen Umschlag, nahm die Brille ab, winkte mich zu sich heran und sagte: »Da hast du einen Brief an Andrej Karlowitsch R., meinen alten Regimentskameraden und Freund. Du gehst nach Orenburg, um unter ihm zu dienen.«
So waren alle meine glänzenden Hoffnungen zusammengebrochen! Statt des lustigen Petersburger Lebens harrte meiner öde Langeweile in einem abgelegenen, weltverlassenen Winkel. Der Dienst, an den ich eben noch mit solcher Begeisterung gedacht hatte, schien mir nun ein schweres Unglück. Aber an Widerspruch war nicht zu denken. Am nächsten Morgen stand die Reisekibitka schon vor der Tür; man bepackte sie mit einem Koffer, einer Schatulle mit dem Teeservice, Bündeln mit Weißbroten und Pasteten, den letzten Zeichen des häuslichen Wohllebens. Meine Eltern segneten mich. Der Vater sagte zu mir: »Leb wohl, Pjotr. Diene treu, wem du geschworen; gehorche deinen Vorgesetzten; lauf ihrer Güte nicht nach, dräng dich nicht zum Dienst, aber weise auch keinen Dienst zurück; und denk an das Sprichwort: Hüte dein Kleid, wenn es neu ist, und deine Ehre von Jugend auf.« Die Mutter bat mich mit Tränen in den Augen, an meine Gesundheit zu denken, und schärfte Saweljitsch ein, gut für das Kind zu sorgen. Man steckte mich in meinen Pelz aus Hasenfell und zog mir noch einen Fuchspelz drüber. Ich setzte mich mit Saweljitsch in die Kibitka, und bitterlich weinend trat ich meine Reise an.
In der Nacht kamen wir in Simbirsk an, wo wir uns einen ganzen Tag aufhalten mußten, um verschiedene notwendige Dinge einzukaufen, womit Saweljitsch betraut wurde. Ich war in einem Gasthaus abgestiegen. Saweljitsch machte sich in aller Frühe nach den Kaufläden auf. Es wurde mir langweilig, aus dem Fenster auf die schmutzige Quergasse zu gucken, und ich begann eine Wanderung durch sämtliche Räume des Hauses. Als ich ins Billardzimmer trat, sah ich einen hochgewachsenen Herrn von etwa fünfunddreißig Jahren mit langem schwarzem Schnurrbart, im Schlafrock, einen Queue in der Hand und die Tabakspfeife zwischen den Zähnen. Er spielte mit dem Markör, der, wenn er gewann, ein Glas Branntwein leerte, wenn er aber verlor, auf allen vieren unter dem Billardtische durchkriechen mußte. Ich blieb stehen und sah dem Spiel zu. Je länger es dauerte, desto häufiger wurden die Spaziergänge auf allen vieren, bis der Markör endlich unter dem Tisch liegenblieb. Der Herr widmete ihm ein paar kräftige Worte als Leichenpredigt und schlug mir eine Partie vor. Ich lehnte ab, weil ich nicht zu spielen verstand. Das kam ihm anscheinend sonderbar vor. Er sah mich mit einem gewissen Mitleid an; aber wir kamen doch ins Gespräch. Ich erfuhr, daß er Iwan Iwanowitsch Surin hieß, Rittmeister des *** Husarenregiments war und zur Rekrutenmusterung nach Simbirsk gekommen war; er wohnte im selben Gasthause. Surin forderte mich auf, mit ihm zu Mittag zu essen, ganz einfach, nach Soldatenart. Ich willigte gern ein. Wir setzten uns zu Tisch. Surin trank viel und schenkte auch mir fortwährend ein, wobei er sagte, ich müsse mich an den Dienst gewöhnen; er erzählte mir Anekdoten aus der Armee, über die ich so lachte, daß ich fast vom Stuhl gefallen wäre; als wir vom Tisch aufstanden, waren wir die besten Freunde. Nun erbot er sich, mich das Billardspiel zu lehren. »Das ist für uns vom Militär unentbehrlich«, sagte er. »Kommst du auf dem Feldzug in irgendein Nest – was fängst du da an? Man kann doch nicht immer nur die Juden hauen. Nolens volens gehst du ins Wirtshaus und spielst Billard. Aber dazu muß man spielen können.« Ich war ganz überzeugt und machte mich mit großem Eifer ans Studium. Surin lobte mich laut, wunderte sich über meine raschen Fortschritte und bot mir nach ein paar Lektionen an, um Geld zu spielen – nur um einen Groschen, nicht des Gewinstes wegen, bloß so, damit man nicht ganz umsonst spiele, denn das wäre die allerschlimmste Gewohnheit. Ich willigte auch darin ein, Surin ließ Punsch bringen und überredete mich, davon zu versuchen: Er wiederholte, daß man sich an den Dienst gewöhnen müsse, ohne Punsch aber wäre der Dienst nichts wert! Ich gehorchte. Inzwischen ging das Spiel weiter. Je häufiger ich mein Glas an die Lippen führte, desto kühner wurde ich. Die Kugeln sausten bei mir jeden Augenblick über die Bande; ich ärgerte mich, schalt den Markör, der Gott weiß wie rechnete, erhöhte den Einsatz bei jedem Spiel – kurz, ich benahm mich wie ein dummer Junge, der zum erstenmal seine Freiheit genießen kann. Inzwischen ging die Zeit unmerklich hin. Surin sah auf die Uhr, legte das Queue fort und sagte mir, ich hätte hundert Rubel verloren. Das verwirrte mich etwas. Mein ganzes Geld hatte Saweljitsch. Ich stammelte Entschuldigungen. Surin fiel mir ins Wort: »Ich bitte dich! Du brauchst dich gar nicht zu beunruhigen. Ich kann noch warten. Und vorläufig fahren wir mal zur Arinuschka.«
Was soll ich noch sagen? Der Tag endete ebenso toll, wie er begonnen hatte. Wir soupierten bei der Arinuschka. Surin schenkte mir jeden Augenblick ein und wiederholte dabei immer von neuem, man müsse sich an den Dienst gewöhnen. Als ich mich vom Tisch erhob, konnte ich kaum auf den Füßen stehen; um Mitternacht brachte Surin mich ins Gasthaus zurück.
Saweljitsch empfing uns vor der Tür. Er schrie auf, als er die untrüglichen Beweise meines militärischen Diensteifers sah. »Was ist mit dir geschehen, Herr?« fragte er mit kläglicher Stimme. »Wo hast du dich so vollgeladen? O Gott! Nie ist dir sonst so was vorgekommen!« – »Halt 's Maul, alter Knasterbart!« erwiderte ich mit stockender Stimme. »Du bist wohl betrunken! Geh schlafen … und bring mich zu Bett.«
Am nächsten Morgen erwachte ich mit heftigem Kopfweh und konnte mich der gestrigen Ereignisse nur dunkel entsinnen. Meine Betrachtungen wurden durch Saweljitsch unterbrochen, der mit einer Tasse Tee bei mir eintrat. »Früh fängst du an, Pjotr Andrejitsch«, sagte er kopfschüttelnd, »früh fängst du zu bummeln an. Nach wem bist du bloß geraten? Weder der Vater noch der Großvater waren Trinker – von der Mutter gar nicht zu reden; die hat ihr Lebtag außer Kwaß nichts in den Mund genommen. Und wer ist an allem schuld? Der verdammte Musjö. Alle fingerlang kam er zur Antipjewna gerannt: ›Madam, shö wu pri, wodkü!‹ Da haben wir nun das Shöwupri! Schöne Dinge hat er dich gelehrt, der Hundesohn! Sehr nötig war's, den fremden Kerl ins Haus zu nehmen! Als ob der gnädige Herr nicht genug eigene Leute hatte!«
Ich schämte mich. Ich wandte mich ab und sagte: »Geh hinaus, Saweljitsch, ich mag keinen Tee.« Aber Saweljitsch war nicht so leicht zum Schweigen zu bringen, wenn er einmal ins Predigen geraten war. »Nun siehst du, Pjotr Andrejitsch, wohin das Bummeln führt. Der Kopf tut dir weh, und genießen magst du auch nichts. Ein Trinker ist zu nichts zu gebrauchen … Trink mal Gurkenlake mit Honig; das beste aber wäre, du nähmst ein halbes Gläschen Branntwein. Soll ich es bringen?«
In diesem Augenblick kam ein Junge herein und reichte mir einen Brief von I. I. Surin. Ich entfaltete ihn und las folgendes:
Lieber Pjotr Andrejitsch, schicke mir bitte mit meinem Jungen die hundert Rubel, die Du gestern an mich verloren hast. Ich habe das Geld sehr nötig.
Ergebenst Iwan Surin
Es blieb mir nichts übrig. Ich machte ein gleichgültiges Gesicht und wandte mich an Saweljitsch, der für mein Wohl und Geld und Wäsche Sorge trug, mit dem Befehl, dem Jungen hundert Rubel einzuhändigen. »Wie? Wozu?« fragte Saweljitsch erstaunt. »Ich schulde sie ihm«, sagte ich möglichst kühl. »Schulden!« erwiderte Saweljitsch, dessen Staunen immer größer wurde. »Wann hast du denn Zeit gehabt, bei ihm Schulden zu machen, Herr? Hier stimmt etwas nicht. Wie du willst, Herr, aber das Geld gebe ich nicht.«
Ich dachte, daß, wenn ich in diesem entscheidenden Augenblick den eigensinnigen Alten nicht unter meinen Willen zwinge, es mir später erst recht schwerfallen würde, mich von seiner Vormundschaft zu befreien; darum sah ich ihn stolz an und sagte: »Ich bin dein Herr, und du bist mein Diener. Das Geld gehört mir. Ich hab es verspielt, weil es mir so gefiel. Dir aber rat ich, deine weisen Reden zu lassen und das zu tun, was dir befohlen wird.«
Saweljitsch war von meinen Worten so überrascht, daß er die Hände über dem Kopf zusammenschlug und mich starr ansah. »Was stehst du da?« schrie ich ihn wütend an. Saweljitsch fing an zu weinen. »Väterchen, Pjotr Andrejitsch«, sagte er mit bebender Stimme, »du bringst mich um. Mein Liebling, hör auf mich Alten: Schreib diesem Räuber, du hättest gescherzt, wir hätten gar nicht soviel Geld! Hundert Rubel! Gott steh mir bei! Sag ihm, deine Eltern hätten dir streng verboten zu spielen, es sei denn um Nüsse …« – »Laß das Geschwätz«, unterbrach ich ihn streng, »gib das Geld her, oder ich schmeiße dich zur Tür hinaus!«
Saweljitsch sah mich tief betrübt an und ging das Geld holen. Der arme Alte tat mir leid; aber ich wollte mich frei machen und ihm beweisen, daß ich kein Kind mehr wäre. Das Geld wurde Surin geschickt. Saweljitsch beeilte sich, mit mir das verdammte Wirtshaus zu verlassen. Er kam und meldete, daß die Pferde bereitständen. Mit unruhigem Gewissen und stummer Reue fuhr ich aus Simbirsk fort, ohne von meinem Lehrmeister Abschied genommen zu haben und ohne zu glauben, daß wir uns jemals wiedersehen könnten.
Zweites Kapitel
Der Führer
O du Land, mein Land,O du fremdes Land!Nicht von selbst bin ich zu dir gekommen.Nicht mein wackres Rößlein trug mich her.Hergebracht hat mich, den kühnen Burschen,Wohl der jugendliche ÜbermutUnd der Rausch, den ich beim Gastwirt mir geholt
Altes Lied
Die Betrachtungen, denen ich mich unterwegs hingab, waren nicht sehr erfreulich. Mein Geldverlust war bei den damaligen Preisen keineswegs unbedeutend. Ich mußte mir selber eingestehen, daß mein Betragen im Simbirsker Gasthaus sehr dumm gewesen war, und ich fühlte mich Saweljitsch gegenüber schuldig. Alles das quälte mich. Der Alte saß finster auf dem Bock, hatte sich von mir abgewandt und schwieg; ab und zu nur räusperte er sich laut. Ich wollte durchaus mit ihm Frieden schließen, wußte aber nicht, wie ich anfangen sollte. Endlich sagte ich zu ihm: »Nun, nun, Saweljitsch, laß gut sein! Wollen wir uns wieder versöhnen! Ich habe nicht recht getan; ich seh es selber ein, daß es nicht recht war. Ich habe gestern dumme Streiche verübt und dich unnütz gekränkt. Ich verspreche dir, mich hinfort vernünftiger zu betragen und dir zu gehorchen. Nun, ärgere dich nicht, wir wollen Frieden machen.«
»Ach, Väterchen, Pjotr Andrejitsch«, erwiderte er mit einem tiefen Seufzer. »Ich ärgere mich über mich selbst – denn ich bin an allem schuld. Wie konnte ich dich allein im Wirtshaus lassen! Aber was hilft das jetzt? Der Böse hatte mich verlockt, ich mußte die Diakonsfrau aufsuchen, meine alte Gevatterin wiedersehen. Und da ist es nun so gekommen: Kehrst du bei der Gevatterin ein, stellt der Satan dir ein Bein. Es ist ein Jammer! … Wie soll ich nun den Herrschaften vor die Augen treten? Was werden sie sagen, wenn sie hören, daß das Kind trinkt und spielt?«
Um den armen Saweljitsch zu trösten, gab ich ihm mein Wort, in Zukunft ohne seine Einwilligung keine Kopeke auszugeben. Er beruhigte sich nach und nach, obgleich er hin und wieder noch kopfschüttelnd vor sich hin brummte: »Hundert Rubel! Das ist keine Kleinigkeit!«
Ich näherte mich meinem Ziele. Rundherum dehnten sich traurige Wüsten, durchschnitten von Hügeln und Schluchten. Alles war mit Schnee bedeckt. Die Sonne sank. Die Kibitka fuhr einen schmalen Weg entlang – richtiger, sie folgte der von Bauernschlitten hinterlassenen Spur. Plötzlich begann der Kutscher nach den Seiten zu schauen; endlich nahm er die Mütze ab, drehte sich nach mir um und sagte: »Herr, sollen wir nicht umkehren?«
»Warum?«
»Das Wetter ist unzuverlässig; es erhebt sich ein leichter Wind; sieh mal, wie er den Neuschnee vor sich hertreibt!«
»Was macht denn das?«
»Und das da – siehst du?« Der Kutscher wies mit der Peitsche nach Osten.
»Ich sehe nichts als weiße Steppe und blauen Himmel.«
»Aber dort! Dort das Wölkchen!«
Tatsächlich sah ich nun am Himmelsrande ein weißes Wölkchen, das ich zuerst für einen fernen Hügel gehalten hatte. Der Kutscher erklärte mir, daß dieses Wölkchen einen Schneesturm ankündige.
Ich hatte wohl von den dortigen Schneestürmen gehört und wußte, daß mitunter ganze Karawanen verweht wurden. Saweljitsch stimmte dem Kutscher bei und riet zur Umkehr. Aber der Wind schien mir nicht stark; ich hoffte, rechtzeitig die nächste Station erreichen zu können, und befahl, schneller zu fahren.
Der Kutscher trieb die Pferde an, sah aber immer nach Osten. Die Pferde trabten munter vorwärts. Der Wind aber wurde von Stunde zu Stunde stärker. Das Wölkchen wurde zu einer großen weißen Masse, die langsam emporstieg, wuchs und sich nach und nach über den ganzen Himmel ausbreitete. Es fing an zu schneien, erst ganz fein, dann plötzlich in mächtigen Flocken. Der Wind heulte; nun war der Schneesturm da. In einem Augenblick floß der dunkle Himmel mit dem Schneemeere in eins zusammen. Alles verschwand.
»Nun, Herr!« schrie der Kutscher. »Es wird schlimm! Das Unwetter …«
Ich sah aus der Kibitka hinaus: Ringsum Finsternis und Schneewirbel. Der Wind heulte mit so ausdrucksvoller Wut, daß man ihn für ein beseeltes Wesen hätte halten können; der Schnee hüllte mich und Saweljitsch ganz ein; die Pferde bewegten sich nur noch im Schritt vorwärts und blieben bald ganz stehen. »Warum fährst du denn nicht weiter?« fragte ich den Kutscher ungeduldig. »Wohin soll ich denn?« antwortete er und stieg vom Bock. »Wir wissen ja gar nicht, wo wir hingeraten sind. Vom Weg ist nichts zu sehen und rundum ist's finster.« Ich fing an zu schelten. Saweljitsch trat für den Kutscher ein. »Warum hast du nicht auf ihn gehört?« sagte er ärgerlich. »Du wärst in die Herberge zurückgekommen, hättest Tee getrunken, bis zum Morgen gut geschlafen, der Sturm hätte sich mittlerweile gelegt, und wir wären weitergefahren. Was haben wir für Eile? Führen wir noch zur Hochzeit!« Saweljitsch hatte recht. Aber es war nichts mehr zu machen. Der Schnee fiel immer dichter. Neben der Kibitka türmte sich ein ganzer Berg auf. Die Pferde standen mit gesenkten Köpfen da, ab und zu zuckten sie leise zusammen. Der Kutscher ging um sie herum und brachte aus Langerweile das Geschirr in Ordnung. Saweljitsch brummte. Ich sah mich nach allen Seiten um, in der Hoffnung, auch nur irgendein Anzeichen eines Wohnhauses oder Weges zu erblicken, aber ich konnte nichts erkennen außer den trüben wirbelnden Schneemassen … Plötzlich bemerkte ich etwas Schwarzes. »He, Kutscher!« schrie ich. »Sieh mal – was ist das Schwarze da?« Der Kutscher blickte nach der angegebenen Richtung. »Gott weiß, was das ist, gnädiger Herr«, sagte er, sich auf seinen Platz setzend. »Ein Wagen scheint's nicht, ein Baum auch nicht, aber es sieht doch so aus, als ob sich's bewegte. Es ist wohl ein Wolf oder ein Mensch.«
Ich befahl ihm, dem unbekannten Ding entgegenzufahren, das sich alsbald auf uns zu bewegte. Nach zwei Minuten hatten wir einen Menschen erreicht.
»He, guter Mann!« rief ihm der Kutscher zu, »sag mal, weißt du nicht, wo hier die Straße läuft?«
»Die Straße ist hier; ich stehe auf festem Boden«, antwortete der Wanderer. »Aber was nutzt es?«
»Höre, Freund«, fragte ich ihn, »kennst du diese Gegend? Kannst du mich zu einer Unterkunftsstelle bringen?«