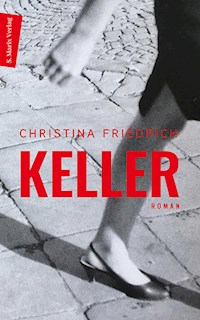Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Herrlichkeit der Fischerinnen erzählt von einer Reise der Ich-Erzählerin durch Israel. Unter einer Palme am Roten Meer begegnet sie Yoash und eine leidenschaftliche, zarte, doch auch von Schatten durchzogene Liebesgeschichte beginnt. In der Erzählung verbinden sich Gegenwart und Vergangenheit, überlagern sich Bilder und Geschichten von Menschen, Orten und inneren Landschaften. In einer poetisch dichten, sinnlichen Sprache erzählt Christina Friedrich von der Reise durch ein fremdes Land, mit dessen Geschichte wir so eng verbunden sind. Sie lässt Erinnerungen auferstehen, die Geschichte mit neuem Leben füllen und zeigt die politische Zerrissenheit und die kulturelle Vielfalt des heutigen Israel. Christina Friedrichs Arbeit verdichtete sich zu der Performance KEEP ME IN MIND, in der die Lebensgeschichten von Benjamin Ginzburg, Miriam Kremin, Josef Künstlich, Ester Liber, Leakadia Szlak, Siegfried Teller und Sara Zamir, sieben Shoa-Überlebenden, von denen sie in ihrem Roman berichtet, weitererzählt werden. Durch die Vermittlung und Weitergabe von Zeichnungen, Fotografien und Habseligkeiten werden die Lebenszeugnisse dieser Menschen berühr- und erlebbar gemacht und gehen somit in den Erzählkanon des kollektiven Bewusstseins ein. Zudem entstand der Film KEEP ME IN MIND. Weiterführende Informationen sind unter www.keepmeinmind.net zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTINA FRIEDRICH
Die Herrlichkeit der Fischerinnen
ROMAN
Nimm eine Zitrone. Schneide sie in zwei Hälften, presse sie aus, zerkau die Kerne, und iss die Schale. Wirf die Frucht im weiten Bogen über das Meer, und du bist in Israel.
Der Himmel ist schwarz. Die Sterne müssen verschwunden sein. Wo ist ihr Licht hingegangen. Vor mir das Meer und hinter mir die Wüste. Tamar sagt, es gibt hier Schlangen und wir sollen den Boden nicht betreten. Wenn es hier Schlangen gibt, töte ich sie, mit beiden Händen. Ich versuche auf einem Stein zu ruhen. Ich weiß, dort hinten sind die Berge von Jordanien. Am Ende der Straße liegt Ägypten, die Stadt Taba. Ein einziger Stern am Himmel. Der muss für mich sein, ich wünsche mir seinen Namen und sein Licht. Der Stern des Südens. Die Dunkelheit ist so unermesslich. Ich weiß nicht, ob Gott das Licht je wieder entzündet. So muss es am ersten Tag der Schöpfung ausgesehen haben. Ich habe Angst, dass die Sonne nicht mehr aufgeht. Die Welt entscheidet, dass dieser Tag der letzte ist und sie ihr Licht von nun an für sich selbst behält. Die Gestirne haben eine Verabredung getroffen, uns zu verlassen. Sie hätten Grund genug. Ich bin mir sicher, heute wird es sein. Die Zeiger der Uhr wandern weiter. Der Himmel schweigt. Es gibt kein Morgen und kein Abend mehr. Die Schlangen werden die Welt bevölkern, und die Sonne ist gegangen.
Hinter uns liegt die Schranke des Reservates in Eilat, wir haben ein Zimmer reserviert. In der Nacht sind Tamar und ich mit dem Bus von Tel Aviv hierher gefahren, um das Naturreservat am Rande des Roten Meeres zu besuchen. Aber der russische Pförtner nimmt seinen Nachtdienst sehr ernst und lässt uns nicht auf das Gelände. Er sitzt wie eine Hexe in seinem Bretterverschlag und schaut Kriegsfilme. Der Lärm der Waffen dringt durch die geschlossenen Fensterscheiben. Er lässt sich nicht überreden. Er hat Anweisungen, niemanden hereinzulassen.
Ich habe mit der Dunkelheit eine Übereinkunft gefunden, ich werde keine Angst haben und warten, bis die dunklen Wolken von Jordanien, Ägypten und Israel über mich ziehen und ihre Dunkelheit wie ein Grabtuch auf mich legen. Irgendwann reißt hinter den jordanischen Bergen der Himmel. Schwach scheint das Licht. Ich kann das Meer schon sehen, und die Häupter der Schlangen waren nur die Silhouette einer Fantasie. Hinter den Bergen taucht langsam die Sonne auf. Ich bin ihr so dankbar, dass sie sich entschieden hat, heute noch einmal aufzugehen. Ich möchte singen und beten und finde keinen Gott, zu dem ich beten kann.
Der Pförtner ist eingeschlafen, wir betreten das Gelände. Katzen streunen durch das Gras. Seltene Vögel mit farbigen Federn wohnen hier. Sie singen fremde Lieder. Wir lehnen uns an den Rücken einer Palme. Der Nachthimmel verschwindet im Meer, und die Sonne geht nun auf. Ich kann ihre Wärme auf meinen geschlossenen Lidern spüren. Ich bin am südlichsten Ende eines fernen Landes. Ich kann hier gerne für immer verloren gehen. Den Rückweg vergessen und schlafen, bis es wieder Morgen wird.
Ein Auto hält auf dem Parkplatz. Drei Taucher steigen aus. Sie gehen tropfnass an uns vorbei. Wir sagen ihnen Boker Tov. In diesem Land geht man nicht grußlos aneinander vorbei. Das Wasser tropft den Meermännern von Händen und Füßen. Sie verschwinden hinter den Blütensträuchern. Ich werde einen Spaziergang machen und mir einmal das Gelände anschauen. Weiße Häuser, Palmen, Blüten und Wege. Alles wie auf einer Zeichnung von Else Lasker-Schüler. Die Berge leuchten rot. Dieser Ort erinnert mich an ein Kinderferienlager in Litauen. Vor dem Speisesaal hängen Schautafeln mit den hier lebenden Pflanzen und Tieren. Sie sind so rar, dass ein jedes Tier und eine jede Pflanze eine eigene Wandzeitung benötigt. Die Stühle im Speisesaal stehen auf den Tischen.
Ich kehre zu unserer Palme zurück. Neben meiner Freundin Tamar sitzt ein Fremder. Der Fremde trägt leuchtende Farben. So wie die Federn der fremden Vögel. Orange und Rot. Ich setze mich neben meine Freundin und bin viel zu müde, um ein Gespräch zu beginnen. Mein Kopf ruht an der Palmenrinde. Durch Tamars Schultern kann ich die Schultern des Fremden spüren. Ich sehe seine Augen. Sie sind dunkel, so wie der Himmel heute Nacht. Er fragt mich etwas, ich antworte. Die Palme buchstabiert die Sprache meiner Haut durch die Rinde in die Haut des Unbekannten. Ich sehe seine Augen und seinen Mund. Etwas ist mir vertraut. Ich weiß nicht, was, weil ich zu müde bin, um einen Unterschied zwischen Palme, Mann und dem Gefieder eines Vogels zu machen. Ich überlege noch, ob die These von den drei Sekunden wirklich wahr ist und ob es länger als einen Lidschlag braucht, um einen anderen Menschen zu erfassen. Wir stellen uns vor, der Fremde heißt Yoash, nun kenne ich seinen Namen. Er fragt mich, ob ich einen Kaffee wünsche und ihn begleiten möchte. Wir lassen die Palme zurück und gehen. Ich folge Yoash durch den Garten. Er könnte mich so nach Jordanien und nach Feuerland bringen. Ich bin müde und wach zugleich. Im Zimmer schlafen die Taucher. Madonna singt auf MTV. Er bereitet den Kaffee zu, als wäre die Zubereitung Teil einer unbekannten Zeremonie. Ich sitze vor dem Haus auf einer Bank. Ich wünsche mir Sand, Wasser und Ruhe. Der Fremde fragt, ob er mich küssen darf. Ich weiß nicht, ob es die Vögel, die Sonne und die schutzlose Müdigkeit sind. Ich finde seinen Kuss auf meinen Lippen. Wir gehen zurück. Die Gläser mit dem heißen, schwarzen Kaffee in den Händen. Süßen Zucker in den Taschen. Später wird Tamar sagen, es seien zwei andere Menschen zurückgekehrt.
Tamar hat leuchtend graublaue Augen, die ihr Gegenüber gefangen halten. Vermutlich hat sie die Augen ihrer Großmutter, die aus der russischen Steppe stammt, und nicht nur ihre Augen, sondern auch ihren Hang zur Melancholie, zur Dramatik und einen grenzenlosen Freiheitsdrang. Darum kann sie es in einem Land wie Israel, mit so vielen bewachten Grenzen, Zäunen, Patrouillen und Konflikten, auch nicht aushalten und ist nach Berlin gekommen. Sie liebt Kuchen und Menschen. Sie sucht für sich das Glück und findet und verliert es, bis sie wieder von neuem aufbricht. Sie kann fluchen und streiten, mit ihrem Vater oder ihrer Mutter kann sie so ausführlich streiten, dass am Ende alle gleichzeitig schreien, weinen und sich wieder versöhnen. Immer hat sie Sehnsucht nach etwas, nach Kuchen, einem Kind, einem Mann. Tamar ist großzügig und teilt alles, was sie hat, das Zusammensein mit ihr birgt immer eine Überraschung, eine neue Perspektive, einen anderen Blickwinkel. Tamar muss viele Stunden weinen, wenn in einem Gericht versehentlich Chili ist. Dieses Weinen scheint ein Teil ihres Daseins zu sein. Vermutlich trägt sie noch die Tränen ihrer Großmutter in ihrem Herzen, die geweinten und die ungeweinten. Sie sucht, so fernab von ihrem Land Israel, immer eine Arbeit.
Sie hat Grafik in Tel Aviv studiert und in Berlin eine Bühnenbildklasse besucht, die ich unterrichtet habe, so lernten wir uns kennen. Nun besuchen wir Eilat, waren schon für drei Tage und drei Nächte bei ihren Eltern, die in Galiläa in einem Haus mit Garten leben, später wird mich Tamar als Übersetzerin nach Tel Aviv an die Universität begleiten. Dort werde ich mit Studenten zu Kafkas Verwandlung arbeiten. Über ihr Gesicht mit den dunklen Augenringen fällt manchmal ein Schatten. Tamar ist eine Glückssucherin, ich freue mich auf die Reise an ihrer Seite und all das Unbekannte, das vor uns liegt. Tamar will mich mit ihrem Land bekanntmachen.
Im Garten wachsen Zucchini, Tomaten, Pfefferminze und Hibiskusblüten. Im Haus von Tamars Eltern sehe ich das erste Mal einen Panic Room, ein fensterloser Raum für den Fall einer Bedrohung durch einen Attentäter, der Raum hat verstärkte Wände, eine gepanzerte Tür, eine separate Lüftung sowie eine Notbeleuchtung. Die besondere Ausstattung erinnert an eine besondere Verletzbarkeit. Die Eltern von Tamar decken den Frühstückstisch mit Oliven, Zucchini-Tarte, Honig, Brot und Hummus im Garten. Nach dem Frühstück brechen wir auf.
In ihrer Güte fahren mich Tamars Eltern an christliche Orte und ich versuche, eine Korrespondenz zu finden und mit den biblischen Kommentaren und Ausführungen von Tamars Vater Oved mitzuhalten. Auf dem Berg der Bergpredigt ist ein Garten, durch den polnische Gläubige spazieren. Frauen mit hohen Schuhen und roten Lippen, die Gebetsbücher unter dem Arm. In der Kapelle sind Japanerinnen, unter den Bäumen ist eine Gruppe, die eine italienische Messe unter freiem Himmel feiert. Ich sitze benommen auf einem Stein und sehe Jesus im Geäst der alten Bäume. Er schaut nach unten und schüttelt den Kopf.
Am See Genezareth steht die Kirche der Brotvermehrung. Hier also hat Jesus die Fische und das Brot vermehrt. Die Sonne scheint heiß auf mich herab. In den Bäumen wohnen Tiere, die ich noch nie gesehen habe. Es sollen biblische Tiere sein. Ein Schild in italienischer Sprache weist auf sie hin. Ich möchte die fremden Tiere gerne sehen, sie erscheinen mir wie eine Kreuzung aus einem Erdmännchen und einem Eichhörnchen. Nun stehe ich hier in dieser schmucklosen Kirche, in der ein riesiger schwarzer Stein wie ein Wal liegt. Hier hat er also mit seinen Jüngern gesessen. Eine Gruppe von Amerikanern zieht ein, warum müssen sie immer so laut sein und Fahnen schwenken. Jedes Wort fällt euphorisch aus, da fallen ja die heiligen Tiere vom Baum. Ich versuche, ein religiöses Gefühl zu finden. Ganz tief verborgen kann ich eine Empfindung bergen. Der Dom zum Heiligen Kreuz, in dem ich aus den Briefen der Jünger vorgelesen habe, ist mit dieser Brotvermehrungskirche verwandt. Jemand hat herzförmige Steine am Flussufer gesammelt. Die Jünger sind unterwegs, die Kirche ist leer. Ich muss mich sehr anstrengen, ich suche nach einem Echo. Einem Wort, einem Gebet. Mein Kopf ist leergefegt. Die christlichen Pilger haben mich bestohlen, sie haben alles mitgenommen, mit ihrem Eifer und ihrem Murmeln. Schon im Transitraum im Flughafen Tegel habe ich sie erkannt, mit den violetten Bändern am Handgelenk und ihrer missionarischen Aufbruchsstimmung. Ich war mir sicher, dass sie in das Heilige Land fahren. Der Reiseleiter hatte ein blutiges Stück Papier auf der Wange, wahrscheinlich hatte er sich beim Rasieren geschnitten. Das Papier, das er in Tegel auf der Wange trug, trägt er jetzt immer noch auf dem heiligen Berg der Bergpredigt. Vielleicht möchte der Reiseleiter ein Verwandter Christi im Leid bleiben.
Wir besuchen eine griechische Kapelle. Es ist so still wie an einem Frühlingstag in Korfu. Unter einem Baum sitzt ein Mönch, ein anderer sammelt Unkraut in einer Schubkarre. Auf der Wiese wächst ein Kraut, das man essen kann. Ich habe den Namen des Krautes vergessen. Man kann Speisen im Frühling, Sommer, Herbst und Winter daraus zubereiten. Ich koste von dem Kraut und falle in einen tiefen Schlaf. Auf einer schmalen Bank mitten in Galiläa. Schlafend kann ich durch die Landschaften reisen. Ich höre die hebräische Sprache und sehe die griechischen Mönche, die Ikonen, die silbernen Amulette, die Pilger singen ihre Lieder. Jeder gräbt in diesem Land mit den bloßen Händen nach den religiösen Relikten und errichtet sich ein eigenes Reich. Jesus geht über das gesunkene Wasser, in den Armen reichlich Fisch und Brot für die Hungrigen, die satt sind.
Am Abend sitze ich mit Tamars Eltern im Wohnzimmer. Sie wollen einen Film mit der Witwe von Heath Ledger sehen, einen ziemlich verzweifelten Liebesfilm. Ich liege in Decken gewickelt auf dem Sofa, und es ist mir ein wenig unangenehm, diese Bilder mit mir unbekannten Menschen zu sehen. Der Mann küsst die Brüste des Mädchens, sie trinken Whisky und rauchen Zigaretten. Einmal tanzt sie in einem roten Kleid für ihn auf der Straße. Ich schaue mir die Bilder an, als sähe ich eine Dokumentation über eine lang verschollene Gattung von Menschen, deren Handlungen mir ganz entfallen sind. Ich beobachte aus meinem dunklen Sofaversteck heraus die Küsse und Berührungen der Liebenden und habe eine große Sehnsucht, es ihnen gleichzutun. Es erscheint mir unendlich fern, auch nur in die Nähe einer solchen Szene zu geraten. Lichtjahre entfernt. Nach dem Abspann stürzen sich alle in eine Diskussion darüber, warum sich die beiden getrennt haben. Ich muss vor lauter Trauer über die Abwesenheit der Liebe ins Bett gehen. Tamars Mutter Sonja macht mir noch die Heizdecke an. Ich bin mir sicher, alles, was mir bis zum Ende des Lebens bleibt, ist eine elektrische Heizdecke auf Stufe zwei.
Im Garten vor dem Haus in Galiläa finde ich eine wilde Orange. Ich zerpflücke sie, werfe die Schalen auf den Boden und zerteile die Orange. Der Saft ist süß, die Kerne spucke ich in hohem Bogen der untergehenden Sonne entgegen, bis zu den Türmen von Haifa, bis zu den Berghöhen. Den Rest der Schalen holen die biblischen Tiere und pflanzen daraus einen Orangenhain, der bis zu meinen Füßen wächst. Die Blüten teile ich mit beiden Händen aus. Den Orangennektar streiche ich mir auf das Haar und die Haut, dass die schönen Tiere kommen und den Honig von mir essen werden.
Die Kerne der Orangen habe ich mit nach Eilat genommen, vielleicht pflanze ich sie dort ein und lege mich in den Schatten des Baumes.
Am Morgen nach unserer Ankunft im Naturreservat gehe ich mit Tamar zum Meer. Der Weg, den wir gehen, ist von Zäunen umsäumt. Ein Metallzaun, der den Zugang zum Meer versperrt, ein Zaun, der jedes Hotel, jedes Gebäude umschließt. Diese versiegelte Architektur erinnert mich an mein verschwundenes Land, das Aufwachsen zwischen Mauern und Zäunen. Am Strand hat eine Gruppe gestikulierender Israelis ihre Plastikstühle direkt neben uns aufgestellt. Sie streiten lautstark über Wasser und Datteln. Tamar steigt aus dem Meer, sie kann nicht barfuß über die Steine gehen. Ich bringe ihr meine Schuhe. Sie balanciert vom Meeresrand bis zum Strand. Wir legen unsere Handtücher dicht nebeneinander und bestellen ein Bier. Die Sonne wärmt unsere Haut. In meinem Kopf wachsen Phantasien wie Korallenriffe, ich kann ihnen beim Wachsen zusehen. Die Phantasien sind verbunden mit dem Mann von der Palme. Er hat meine Lippen geküsst, ganz sanft, und ich habe das nicht vergessen. Nun liege ich hier zwischen Steinen und Sand, und eine unbekannte Vorfreude wächst mir zu.
Ich tauche tief unter das Wasser. Da sind die rot-weiß gesprenkelten und die schwarz-türkis gestreiften Fische. Die weisen Tiere sind schon sehr lange hier unter Wasser. Ich muss mich tief zu ihnen hinunterlassen und darf sie nicht erschrecken. Die Farben der Korallen sind verschwunden. Auf dem Boden des Korallenriffes liegen zerborstene Dinge. Ein silberner Fisch schießt an mir wie ein Pfeil vorbei. Ich tauche nach oben. Die Sonne steht schon hoch am Himmel. Unter Wasser ist es so still, ich muss zurückkehren. Der Fisch schwimmt mit mir bis zu dem sandigen Palast. Dort wohnen Meermänner mit Algen im Haar, und es wohnen dort die Frauen mit Muscheln in den Händen. Sie zerbrechen die Schalen und essen die Perlen. Unter Wasser betrachte ich meinen Körper, meine Beine, Füße und Hände können sich jederzeit verwandeln, in einen goldenen Fisch oder in eine Frau.
Unter der Palme sitzt immer noch Yoash. Ich erzähle ihm von Kafkas Gregor Samsa, der eine schreckliche Veränderung feststellen muss, ausgehend von dem Körperpanzer, der ihm wuchs, und der Gewalt des Vaters. Ich hole das Buch aus der Tasche und sage, du kannst es einmal berühren. Yoash legt die Hände mit den Halbmondnägeln auf das Buch. Jeder Augenblick ist kostbar. Er kann vergehen.
Ich fragte ihn am Morgen nach Salz und Zucker, und er reichte mir das Brot und das Messer. Er sprach meinen Namen so aus, wie ihn noch niemand ausgesprochen hat. Ein wenig wie eine raue Musik. Ich saß in dem Frühstückssaal des Ferienlagers und legte meinen Kopf auf den Tisch. Bis in alle Ewigkeit.
Direkt von der Palme fällt ein Band, geflochten aus Palmenblättern und den Federn eines apfelsinenfarbenen Vogels. Und dieses Band legt sich unsichtbar um unsere Körper. In einem der Palmenherzen wohnt noch ein Vogel. Er ist wenige Tage alt und kann die Augen kaum öffnen. Seine Federn wärmen ihn noch nicht. Sein Herz schlägt unter der Haut. Er ist zart orange. Nimmt man ihn in die Hände, fühlt man seinen Atem. Von den südlichen hohen Himmeln fallen die Vögel. Ich öffne die Hände und sammle sie ein. Um die blühenden Hecken streunen die Katzen. Man muss aufpassen, dass sie die Vögel nicht fressen.
Ich steige über die spitzen Steine am Strand des Roten Meeres. Von der Strandbar hört man Musik. Die weißen Plastikstühle, die in der ganzen Welt gleichmäßig verteilt sind, werden von den afrikanischen Jungen nach einem unbekannten System hin und her geschoben. In der Holzhütte am Strand brät ein Koch Pommes Frites und Steaks. Die Kellnerin geht mit dem Bier und den Tellern über den heißen Sand. Neben dem Zaun ist ein maritimes Institut. Zäune sind hier überall, ich wundere mich, dass auf dem Meeresboden keine Zäune stehen. Ich muss noch einmal zu den Fischen gehen. Ich hoffe, die Taucher schwimmen in anderen Meerestiefen und ich bin mit den Fischen allein. Ich habe viele Fragen an ihre stummen Münder und ihre silbernen Augen.
Vor vielen Jahren ließ ich meinen Körper tief unter dem Meeresboden liegen. Mein Geliebter hatte unsere Liebe im Gehen mitgenommen, meine Haut, mein Haar, mein Herz, unsere gemeinsamen Wünsche hatte er sich in die Taschen gesteckt und war gegangen. So bin ich auf den Grund hinabgesunken. Die Fische konnten durch meine Augenhöhlen schwimmen, die Krebse über meine Füße und Beckenknochen spazieren. Meine weißen, ausgewaschenen Knochen lagen direkt neben den Scherben und Splittern der untergegangenen Dinge. Unter Wasser erscheint mein Körper vollständig und kann sich bewegen. Darum fällt es mir leicht, mit den Fischen zu schwimmen. Ich ahme ihre Bewegungen nach. Über der Meeresoberfläche existiere ich auch, aber mein Körper ist dann nicht in seinem Element. Bei Tageslicht klappert er ein wenig, und in der Nacht lege ich meine Knochen um mich herum, so wie andere Menschen ihre Kleider.
Ich muss zu der weisen Hirnkoralle tauchen, sie kann mir bestimmt Auskunft geben. Ich habe gesehen, dass die Augen von Yoash dunkel sind und schwer. Sein Blick fiel in mich. Wenn man von einem bösen Blick gebannt wird, kann man dann auch von einem guten Blick tief getroffen sein. Liebe Koralle, gib mir ein Zeichen, sprich eine Prophezeiung aus. Ich taste mit den Fingerspitzen über den Stein, er ist mit meinen Knochen verwandt. Die Steinkoralle lebt in einer symbiotischen Beziehung mit kleinen Algen, die sie mit Nährstoffen versorgen. Viele Arten wachsen in großen Kolonien und erreichen Durchmesser von mehreren Metern. Wegen des massiven Skelettaufbaus ist ihr Wachstum sehr langsam. Die Muster der großen Polypen erinnern an die Windungen eines Gehirns. Auf Deutsch heißen sie deshalb Hirnkorallen. Sie sind auf Licht angewiesen. Ich verweile bei der Hirnkoralle. Im Hebräischen klingt es schöner. Almog moach. Der knöcherne Stein spricht. Ich kann ihn hören. Seine Worte sind nur für mich bestimmt. Ich darf dem Blick folgen, ich darf hinabtauchen, ich darf mich versenken. Hier gelten die Gesetze des Meeres, hier gelten die Gesetze der Meeresbewohner, und die sind unendlich.
In den Jahreszeiten ohne Liebe sind die Nächte ohne die Wärme eines anderen Körpers, ohne Berührung und eine warme Hand auf meinem Bauch seltsam lang. Es wird Frühling, Winter, Herbst, Sommer. Der Vogel aus dem Tapetenmuseum an der Wand schaut mich fragend an. Ich bin umgeben von Büchern, Zeitungen und Wassergläsern. Die Orangenbäume auf dem Fensterbrett scheinen eine seltsame Krankheit zu haben, so oft ich sie auch gieße, die Blüten bleiben aus. In der Lampe sammeln sich die Flügel toter Insekten, und die Geräusche der Mülltonnen und Fahrräder klingen so laut, als wären sie, wie zum Hohn, verstärkt. Die Katzen werfen sich gegen die Tür und bitten um Einlass. Die Nachbarin, die eine Dichterin ist, dichtet bis in die frühen Morgenstunden, manchmal höre ich die Stimme ihres Geliebten und bin neidisch auf ihre Nächte. Ich lege beide Hände auf die Scham und versuche zu schlafen und mir meine Träume zu merken.
Nun wohne ich mit den Hirnkorallen unter dem Meer. Der Blick von Yoash fällt mit der Sonne direkt auf den Meeresboden. Ich kann ihn spüren. Mein Herz kann das spüren, tief innen gibt es einen Raum, in dem schlägt eine Glocke. Ich habe Yoashs Zimmernummer vergessen, war es eine 3 oder eine 9. Ich muss die Nummer wiederfinden, ich bin nämlich gläubig. Ich glaube an Zahlen und Wunder.
Tamar und ich pflücken die Orangenblüten im Garten und kochen uns einen Tee. Wir fallen in einen tiefen Schlaf. Ich liege oben in dem Doppelstockbett und zeichne in mein Buch noch ein Wort und einen Fisch, Berge, Sonne, Himmel und Wasser. Tamar schläft wie ein Kind. Ich möchte sie nicht wecken. Manchmal wohnt in ihr eine tiefe Trauer. Dann sieht sie aus wie eine griechische Göttin, die tief gestürzt ist. Ich liege wach, die Vögel singen um Mitternacht. Tamar schläft in dem unteren Bett. Manchmal steht sie in der Nacht auf und isst etwas Süßes, dann raschelt sie wie eine Maus. Ich soll ihr alles erzählen, was ich über die Liebe weiß. Ich muss ihr alle Fragen beantworten. Sie wünscht sich einen Mann, ich habe mir überhaupt nichts gewünscht, und plötzlich ist ein unbekannter Mensch da. Sitzt unter einer Palme, wie ein aus dem Nest gefallener Vogel, und ich pflücke mir eine Feder aus seinem Haar.
In diesen Nächten, in denen Tamar und ich wach liegen, im Doppelstockbett eines israelischen Naturreservates, zieht mein Liebesleben an mir vorbei. Schattentiere an den Wänden. Schwarze Tiere, verletzte, verwundete, von Anschlägen gestreifte. Mit jeder Frage, die Tamar aus dem unteren Bett stellt, weckt sie eines der schlafenden Tiere. Ich habe sie alle betäubt, gebunden, gefesselt und tief in den Brunnen verbannt. Da liegen die Liebestiere übereinander gestapelt, ineinander gewachsen, die Klauen, das Fell, die Ohren und die Augen. Ein ganzer Turm von Körpern, die ein schwankendes Gebilde ergeben. Um eine Antwort für Tamar zu finden, muss ich sie alle einzeln herausziehen und von Staub und Vergessen freiklopfen. Ich finde Geliebte, denen ich ausschließlich meinen Körper gewidmet habe. Geliebte, denen ich die Augenlider und Achselhöhlen geküsst habe, Geliebte, mit denen ich Whisky getrunken habe, ich finde Körper, die traurig, verbogen und verzweifelt waren. Ich ziehe die Schönen und die Vergessenen hervor, ich bringe meiner Freundin bei, dass man die Körper einfach genießen kann, dass es nicht immer Liebe sein muss. Tamar raschelt mit ihren Süßigkeiten. Jetzt, wo ich all die Tiere hier in unserem Ferienzimmer hervorgeholt habe, können sie auch gleich bleiben. Nachdem ich jedem Einzelnen das Fell gestreichelt, die Wunden verbunden, die Augen wieder eingesetzt und einen Zettel mit Namen und Geburtsdatum an die Zehe gebunden habe, öffne ich Fenster und Türen. Sie drängen sich alle dicht an der Tür zusammen. Ich muss sie ins Freie entlassen, in die Freiheit. Sie drehen sich noch einmal um. Ich klatsche in die Hände und treibe sie hinaus. Ich sehe sie davonstürmen, mit großen Sprüngen. Vorbei an den Palmen, den blühenden Pflanzen, vorbei an dem russischen Pförtner, der vor Schreck die Schranke aufreißt. Sie springen über die Straße, springen über den Zaun und direkt ins Meer. Sie können zu meiner Überraschung schwimmen und tauchen. Ich sehe sie weit hinausschwimmen. Sie werden in Jordanien an Land gehen und dort ein neues Leben beginnen. Tamar ist eingeschlafen, ich decke ihre Schultern zu und nehme ihr das Bonbonpapier aus der Hand.
Vor dem Fenster singen seltene Vögel. Sie rufen mich, sie singen ihre fremden Lieder für mich. Ich weiß, dass in diesem Garten ein Mann sitzt, dessen Blick mich berührt hat.
Ich wage es nicht hinauszugehen. Wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, werde ich nicht mehr zurückkehren. Mein Herz schlägt. Ein Dschungel von Möglichkeiten. Panther, Antilopen, Jaguare, Säbelzahntiger und Löwen stehen vor der Tür. Ich brauche sie nur zu öffnen. Ich schaue in den Spiegel, ich sollte mich mal wieder in die Welt hinaustragen. Mein Haar und meine Hände. Ich öffne leise die Tür. Eine weiße Katze hat auf mich gewartet. Sie geht voran und zeigt mir den Weg. Sie bringt mich zu Yoash.
Er sitzt an einem Tisch und liest eine Zeitung. Konzentriert schlägt er Seite um Seite um. Er blickt auf und lädt mich ein, Platz zu nehmen. Etwas Ruhiges und Gefasstes geht von ihm aus. Wenn die Katze nicht gewesen wäre, hätte ich den Weg gar nicht bewältigen können. Nun stehe ich hier und bin befangen. Mutig und befangen zugleich. Er erhebt sich. Es ist ein altes Muster. Eine Sprache, die ich lange nicht mehr gesprochen habe.
Ich muss in die Stadt gehen, er begleitet mich. Er geht neben mir. In Sandalen. Ich schaue auf seine Füße. Wir gehen nebeneinander. Die Straße entlang, die in die Wüste führt. Er hält ein Taxi an. Ich steige ein. Ich sitze auf der Rückbank. Das Taxi könnte weit fahren, bis nach Jordanien und zurück. Ich würde einfach sitzen bleiben. Die Palmenhaine ziehen an uns vorbei. Wir gehen zum Meer. Das Wasser zu unseren Füßen. Hinter uns Musik, Menschen und eine Stadt, die wie Las Vegas leuchtet. Die Silhouette der Berge umschließt das Meer. Der Nordstern steht am Himmel. Wir sprechen über die Musik von Johann Sebastian Bach. Wir küssen einander. Das Meer ist unser Zeuge, die Berge und der Himmel. Seine Fingerspitzen tragen Halbmonde. Wir rauchen eine Zigarette und schauen in die Dunkelheit. Ich benenne die Berge um. Die Zeit ist ein eigenwilliger Begleiter. Manchmal sind alle Ingredienzen in einem einzigen Augenblick vereint. Die Lichter und die stummen Berge sehen und hören alles. Ich schaue aus der Perspektive der Sterne auf mich selbst. Ich glaube an Wunder.
Far out at sea the water is as blue as the bluest cornflower, and as clear as the clearest crystal; but it is very deep, too deep for any cable to fathom, and if many steeples were piled on the top of another they would not reach from the bed of the sea to the surface of the water. It is down there that the Mermen live.
Ich erreiche den Garten der Aale nördlich des Korallenriffs. Ich schwimme durch den dichten Wald aufrecht stehender Aale, die sich in der Meeresströmung hin und her bewegen. Ihre silbernen Häute umgeben und beschützen mich. Die Aale haben ein einziges metallisches Auge, mit dem sie mich betrachten. In ihrer Gesellschaft verliere ich meine Scheu. Die Aale geben mir eine Lehrstunde in der Freiheit der Bewegung. Sie können ihre glitzernden Körper in jede Richtung drehen, sich horizontal und vertikal bewegen, außerhalb jeder Schwerkraft. Sie sind sehr gnädig mit mir und nehmen mich in ihre Mitte. Ich lerne durch Nachahmung. Ich verliere meine Furcht. Es hat sich in den Jahren der Stille eine Angst eingeschlichen, vermutlich die Angst vor der Berührung. Ich habe Angst vor einer jeden neuen Begegnung und die Befürchtung, dass mit jeder Nähe und der möglichen Liebe auch ihre Entflechtung droht. All die gemeinsamen Wahrnehmungen, die gesprochenen Worte, die auf der Haut gespeicherten Berührungen werden an einem noch unbekannten Tag wieder verschwinden und sich auflösen. Wie Wind, der durch Zuckerwatte fährt und alles sorgfältig Gesponnene mit sich reißt. All die Informationen, die Träume und Geständnisse, die Geheimnisse, die einander offenbart werden. Die Vornamen der Großmütter und ihre Herkunft, die Flussufer der Kindheit, die Narbe am Rücken, die in das Ohr geflüsterten Worte, die in den Schrank gehängten Hemden, die gebratenen Rosmarinkartoffeln, die Gläser, aus denen man Whisky trinkt, die Landschaften und Plätze, die gepflanzten Gladiolen und die Erwartungen der Eltern, der Geschwister, der Freunde, die Muster und Rituale, die Mängel und die Fehler, die entstehen, der wütende Blick, der vereiste Kühlschrank, das unscharfe Messer, die nicht ausgeräumte Waschmaschine, die versäumten Stunden, der abgewandte Kopf, die abgelehnte Berührung, all die Augenblicke und Momente, die sich verdichten zu einer Art Liebesleben, all die werden an dem Tag, an dem der andere geht und sich das Element der Liebe plötzlich zurückzieht, verschwinden. Ich fürchte mich vor dem Hohlraum, der bleibt, in dem dann nur noch das eigene Echo zu hören ist, ich fürchte mich vor den Nächten, die auf die geflohene Liebe folgen, in denen man die Knie zur Brust zieht, das Fenster öffnet, damit der Regen und der Wind, die Trauer hinaustreiben. Ich fürchte mich vor der Stille, nach all den geteilten, kostbaren Worten, und vor der Abwesenheit des Körpers, in dem man sich wiederfand.
Nun will ich mich aber nicht mehr fürchten, sondern hoffen, dass mir hier am Ufer des Roten Meeres ein neuer Mut zuwächst. Darum kommt nur her, ihr Aale, und bringt mir etwas von eurer Geschwindigkeit und Furchtlosigkeit bei. Die Aale sind mir die liebsten Lehrmeister. Ich habe alles verlernt, ich muss noch einmal ganz von vorn beginnen. Das Alphabet des Körpers noch einmal buchstabieren. Die vergessene Sprache noch einmal erlernen. Ich bin froh, dass ich hier weit entfernt von den Menschen, tief unter dem Wasser bin und meine verlorenen, vergessenen Knöchelchen wieder versammeln kann.
Der Nordstern leuchtet über uns. Wie vieles muss man über einen Menschen wissen, bevor man ihn küsst. Das Meer zu unseren Füßen verbrüdert sich mit uns. Bach spielt am Golf von Akaba die Brandenburgischen Konzerte. Hinter der ägyptischen Grenze beginnt die Revolution. Ich küsse deinen Mund und nehme deine Hand. Die Lichter von Akaba sind zu sehen. Sie sind für uns angesteckt.
Und nun sitzen wir am Roten Meer, und du fragst mich, ob du mich küssen darfst. Höre nicht auf. Küsse mich, bis sich die Berge verschieben und die silbernen Aale den Garten verlassen und dich begrüßen. Küsse mich mit deiner Zunge, nimm von meinem Mund jedes Wort und jedes Verlangen und küsse mich, bis ich unter den Meeresboden sinke. Die Sterne über Akaba fallen auf mein und dein Haar. Jetzt kann ich deine Wimpern in der Wüste sehen. Ich küsse dich bis in alle Ewigkeit, und wenn sie eine Nacht dauert.
In den schlaflosen und traumverlorenen Nächten treffe ich Oma Mitzi aus Böhmen unter einem Walnussbaum. Man sagt, ich hätte die blauen Augen meines Vaters und von Oma Mitzi. Die böhmische Linie. Ich liebe das Blau der Madonnen, die mit ihren Gewändern goldbekränzt in der Mitte eines Bildes sitzen, auf ihrem Schoß ein Kind und einen Apfel. Ich sammle Heiligen- und Madonnenbilder, die ich in Schubladen verstecke und auf Fensterbrettern verteile, als Schutzheilige und Reliquien gegen die Zumutungen der Welt.
Auf ihrem Schoß hat Mitzi einen Korb mit Nüssen. Ich setze mich neben sie mit all meinen Fragen, Rätseln und Nöten. So sitzen wir nebeneinander, öffnen die Nüsse und lösen das weiße Walnussfleisch aus den Schalen. Oma Mitzi weiß um meine immer währenden Traumbilder. Ich bin verbrannt, erdolcht, ertrunken, enthauptet, erstickt und auf der Flucht erschossen. Durch meine Träume ziehen Wölfe, vereiste Wälder, Baumruinen, Diktaturen, Kopfschüsse, Mütter und Söhne ohne Gliedmaßen, Schuttflächen, Explosionen, vom Himmel stürzende Flugzeuge, Ascheberge, Keller, Tote in jeglicher Gestalt, Meereswellen, verlorene Kinder und Katastrophen.
Ich kaufe mir eine Eintrittskarte für den Besuch der Nationalgalerie. Um mich mit den Grausamkeiten der täglichen und der vergangenen Welt vertraut zu machen, gehe ich am Tag in die Säle und betrachte die Bilder des Todes. Das Martyrium des heiligen Sebastian, der weiße Körper des Gepeinigten mit den Pfeilen in der Haut, der abgeschlagene Kopf von Holofernes auf dem Tablett, sein offener Mund, die auf das Rad Geflochtenen, die Gevierteilten, Geköpften, die brennenden Städte, die durchbohrten Söhne. Stürzende Pferde, schwarze Himmel. Ich trete nah an die Bilder heran. Ich betrachte ein jedes Detail, ich möchte vorbereitet sein.
Geboren bin ich in einer Stadt am Harz. Der Dom zum Heiligen Kreuz, die Salzaquelle und das Lager Mittelbau Dora gehören zu den Orten, die sich zu einer Landkarte verwoben haben. Zwischen diesen Orten lag undurchdringliches Schweigen, wie eine durch die Geschichte gewachsene Hecke. Ich gehe die alten Wege noch einmal nach. Ich nehme mein Wandergepäck. Es ist noch niemand unterwegs. Am Wasserfall schaue ich den Forellen zu, die über die Fischtreppe springen. Es sind besondere Fische. Glänzende Fische. Sie kommen aus dem Westen geschwommen. Ihre inneren Organe, Herz, Leber und Lunge. leuchten. Sie sind aus Gold. Die grenzenlosen Fische schwimmen in der Zorge. Ich fange einen von ihnen und esse ihn auf. Nun habe ich auch Spuren von Gold in meinem Bauch. Gestärkt kann ich weitergehen. Hinter dem Wasserfall sehe ich das Kinderheim Frohe Zukunft.
Ich gehe am Schotterbett der Harzquerbahn entlang. Ich nehme einen kleinen Umweg über die Salzaquelle. Ich folge der Salza. Ein eiskalter Fluss, auf dessen Grund grasgrüne Gewächse blühen, die sich langsam am Boden entlangschlängeln. Das grundlose Loch ist so tief, dass es die Körper der Kinder verschlingt. Steht man am Rand dieses Wassertrichters, kann man in den Tod sehen. Die einst ertrunkenen Kinder schwimmen, in Algenhaar verwandelt, die Salzaquelle hoch und runter. Tag und Nacht.
Ich gehe am Totenfluss entlang, bis ich zu einem Berg komme, der Kohnstein heißt. Gelegen zwischen dem Hirschenteich, den Sattelköpfen, dem Himmelsberg und dem Mühlberg. Ein Karstgebirge im Harzvorland. Das Gestein besteht aus Gips, Anhydrit, Alabaster und Marienglas. Später entstand im Berg durch den Gesteinsabbau ein Stollensystem, im zweiten Weltkrieg mussten Häftlinge unter Tage Flugbomben und Raketen bauen. Die Gefangenen wurden in die unterirdischen Stollensysteme gesperrt, ohne Tageslicht, Schlaf und Versorgung, sie wurden ihres Lebens beraubt. Viele sind vor Erschöpfung gestorben, Tausende wurden ermordet. Sie bekamen nichts zu essen und zu trinken, und wenn sie zu schwach zum Arbeiten waren, wurden sie mit einem Spaten erschlagen, erschossen oder von Schäferhunden angefallen. Der weiße Berg steht noch, im Bauch des Berges liegen die Knochen der Toten. Sie konnten ihren Kindern keinen Brief aus dem Berg schreiben, kein Lebenszeichen geben. Mit den Fingernägeln haben die Männer und Frauen aus Polen, Belgien, Ungarn, Russland, Rumänien, Frankreich und anderen Ländern die Namen ihrer Töchter und Söhne in den Stein geritzt. Jetzt sind die Gips- und Anhydrit-Werke mit dem Abbau des weißen Leichenberges beschäftigt. Der Berg wird immer weniger. Die Sirene des Sprengmeisters klingt bis in die Stadt. Der Sprengmeister lässt den Berg in Stücke explodieren. Eine weiße Staubwolke liegt über der Fabrik. Nun liegen die Steinbrocken und die zerstäubten Knochen in einem Güterwagen. Knochenmehl der Toten und Gips. Ich kann keine Güterwagen sehen, ich habe Angst, dass da noch Menschen herausschauen, mich anschauen. Wie ich lebend an der rotweißen Schranke stehe, Gras und Löwenzahn unter meinen Füßen. Während die Toten durch das Land fahren. Ich kann nicht aufhören, die Güterwagen zu zählen. Die Menschen, mit denen ich aufwachse, sagen, sie hätten nichts bemerkt. Wenn die Güterwagen durch das Land fuhren, durch mehr als vier Jahreszeiten. Das muss doch geschrien, geweint, geklagt, gerufen, gerungen, geklopft haben. Aber die Menschen in der Stadt haben das Klopfen der Bewohner des Berges nicht gehört. Niemand ist gekommen, um die Eingeschlossenen zu befreien.
Der einzige Überlebende eines mir unerklärlichen Mordes saß auf dem Küchentisch in der Kohnsteiner Straße. Es war der jüdische Schneider, der meine erste Mustang-Jeans aus einer Männerhose nähte. Alle anderen waren weg, so die Auskünfte der Erwachsenen. Aber wo waren sie, sie konnten ja nicht alle in dem Ofen verbrannt sein, den der Museumsführer in meinem siebenten Lebensjahr bei einer Führung durch das Lager Dora öffnete. Ich wuchs auf in einem Land, das von Schäferhunden und Zäunen umgeben war. Ein ausgeschnittener Himmel, eine begrenzte Welt. An einem Fluss unter Trauerweiden saß ich und wünschte, Priesterin, Archäologin, Optikerin, Bildhauerin und Forscherin zu werden. Später wurde ich Regisseurin, um die verstummten, finsteren, tödlichen und wirklichen Geschichten zu erzählen. Ich bin für immer verbunden mit den Erdbeerbeeten im Garten meiner Eltern, dem dunklen Wasser der Zorge und der Salzaquelle, der alten Schäferei am Lindenhof, den Höhen und Hohlwegen, den versunkenen Klosterteichen in den Wäldern und den Buschwindröschen im Frühling in den Auen und der unheimlichen Landschaft am Kohnstein. Es gab einen Stollen, ein Krematorium, eine Aschegrube, eine Waschbaracke und einen Schornstein. In dieser Landschaft mit ihren Leerstellen, ihrem Tod, ihren Zumutungen, ihren Taten und ihrem Schweigen bin ich geboren.
Viel später las ich von Miriam Kremin, geboren in Dubno, von dem Tag, an dem ihr Vater ihr vor den Toren des Ghettos einen Stoß in den Rücken gab, verbunden mit den Worten: Lauf, Kind, lauf. Das Kind ist gelaufen. Drei Jahre und dreitausend Kilometer, bis es Palästina erreichte. Nun ist Miriam dreiundneunzig Jahre alt und hat Angst, dass die Menschen sagen werden, es hat deine Geschichte nicht gegeben. Sie hat Angst, dass all das, was ihr auf diesem Weg zugestoßen ist, vergessen ist. Sie hat Angst, dass es Menschen geben wird, die den geplanten Mord an ihr und ihren Eltern und all den anderen leugnen werden.
Die Angst von Miriam berührt mich. So weit ist sie gerannt, um einen Ort zu suchen, an dem sie Ankunft findet, Vater und Mutter ermordet. Und nun fürchtet sie sich vor dem Vergessen und der Lüge. Ich muss Miriam suchen. Ich möchte ihre Geschichte bergen. Ich weiß, dass sie in Haifa, in einem Heim für Überlebende der Shoa wohnt. Ich werde an Miriams Tür klopfen, mich ihr vorstellen und ihr so lange zuhören, wie sie es wünscht.
Ich schlage die Landkarte auf, betrachte das Meer, die Grenzen und die Umrisse der Wüste in Eilat. Ich muss auf den Berg Zeforot gehen, um mir einmal einen Überblick zu verschaffen. Ich habe den großen Wunsch, allein zu sein. Tamar sagt, es gibt Schlangen und ich soll aufpassen und um sechs Uhr vor Anbruch der Dunkelheit wieder zu Hause sein. Ich möchte gerne den Berg finden, von dem aus ich über die Länder Ägypten, Jordanien und Israel schauen kann. Die Berge haben keine Grenzen, sie stehen majestätisch und stumm in ihrem schweren Rot in der Welt. Ich kann ihr Alter spüren. Ich gehe einen staubigen Pfad nach oben, die Wasserflasche in der Hand. Ich muss umkehren, das ist nur eine Baustelle. Ich finde ein Tal und ein ausgetrocknetes Flussbett, in dem Kinderwagen und Stühle liegen. Ich gehe weiter, bis es ganz still ist. Irgendwann sind nur noch die Berge und ich da. Das Tal endet hier. Ich klettere eine steile Wand nach oben. Steine rutschen unter meinen Stiefeln nach. Ich kann den Pfad nur ahnen. Ich halte mich an Felsvorsprüngen fest. Wenn ich hier verlorengehe, findet mich niemand. Ich kann das Meer sehen. Den Golf von Akaba. Ich versuche mir den Pfad, die Anordnung des Gerölls, kleine Zeichen zu merken, so dass ich den Rückweg finde. Hier kann ich keine weißen Kiesel werfen, da findet mich kein Vater, keine Mutter. Einen Gipfel will ich noch erwandern. Ich muss an den Rückweg denken. Beginnt man einmal, in diese stille Welt hineinzulaufen, entsteht ein Sog, dem man nicht mehr entkommen möchte. Nur noch Wolken und Steingeklüft. Ich liege auf der Erde und suche mir Splitter für die Hosentasche aus. Ich bin so müde, dass ich mich mit dem Staub bedecke und einschlafe. Hier oben, in dem Wüstenwind, könnte ich für immer verloren gehen. Die Sonne geht auf und unter, bis nur noch meine weißen Knochen hierbleiben. Schulkinder bringen meine Knochenreste dann in den botanischen Forschungsraum des Reservats.
Eingegraben in den Sandstaub, mit dem Kopf auf der Erde und dem Blick über das Heilige Land, streife ich über die Verluste, Verirrungen, Wunder und Vergeblichkeiten. Die Wolken sind so mächtig, dass mir die Fragen unter den Händen zerfallen. Gibt es im Leben eines Menschen einen still gefegten Platz, an dem er noch einmal beginnen kann. Haben die drei Worte Glaube, Liebe, Hoffnung Bestand. Einst habe ich geglaubt, gehofft und geliebt und gedacht, es wäre für immer. Und dann ist der andere mit unserer Liebe davon gegangen, hat sie wie eine Decke über die Schulter geworfen, die er mir vom Körper gerissen hat, und ist damit den Berg hinaufgegangen. Und in seinem Gehen hat er alles mitgenommen, alles, was uns gemeinsam möglich schien. Das Fleisch, das wir mit den Händen und Zähnen aßen, das Laken, die Kirschen, die wir uns in das Haar und