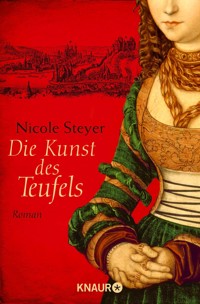9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein verzweifelter Kampf gegen Aberglauben und Verfolgung.
Idstein, 1676: Katharina und ihre Mutter leben ein bescheidenes Leben in der Grafschaft Nassau in der Nähe der Stadt Idstein. Als Graf Johannes mit einer Hexenverfolgung beginnt, geraten die beiden in höchste Gefahr. Katharina muss miterleben, wie ihre Mutter grausam hingerichtet wird, und gerät danach selbst in das Visier des Henkers Leonhard Busch, der sie um jeden Preis in seine Gewalt bringen will ...
»Geschickt verwebt die Autorin historisch belegte Szenen mit fiktivem Stoff.« Wiesbadener Tagblatt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 801
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Idstein, 1676: Das Leben von Katharina ist einfach und beschaulich. Gemeinsam mit ihrer Mutter verdient sie sich ihr Auskommen mit Näharbeiten. Als Dorfkinder Gerüchte über dunkle Machenschaften der beiden Frauen in die Welt setzen, geraten die beiden Frauen in höchste Gefahr, denn Graf Johannes, der den Anschuldigungen Glauben schenkt, beginnt eine grausame Hexenverfolgung, der schon bald Katharinas Mutter zum Opfer fällt. Nun ist Katharina auf sich allein gestellt, während in der Grafschaft Nassau der Hexenwahn immer weiter um sich greift …
Über Nicole Steyer
Nicole Steyer ist in Rosenheim aufgewachsen und begann schon früh, sich die ersten Geschichten auszudenken und aufzuschreiben. Im Jahr 2001 zog sie der Liebe wegen in das Taunusstädtchen Idstein, beschäftigte sich mit der Geschichte ihrer neuen Heimat und verfasste »Die Hexe von Nassau«, ihren ersten Roman, der sich mit den Hexenverfolgungen in Idstein und Umgebung befasst.
Im Aufbau Taschenbuch und bei Rütten & Loening sind unter ihrem Pseudonym Linda Winterberg zahlreiche historische Romane und Sagas erschienen: »Das Haus der verlorenen Kinder«, »Solange die Hoffnung uns gehört«, »Unsere Tage am Ende des Sees«, »Die verlorene Schwester«, »Für immer Weihnachten«, »Die Kinder des Nordlichts« sowie die große Hebammen-Saga: »Aufbruch in ein neues Leben«, »Jahre der Veränderung«, »Schicksalhafte Zeiten«, »Ein neuer Anfang« und die dreiteilige Winzerhof-Saga: »Das Prickeln einer neuen Zeit«, »Tage des perlenden Glücks«, »Die goldenen Jahre«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Nicole Steyer
Die Hexe von Nassau
Historischer Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Epilog
Nachwort
Danksagung
Impressum
Wer von dieem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Matthias
Prolog
Dicke weiße Schneeflocken fielen wie Watte vom Himmel, tanzten durch die Luft und schwebten langsam und sacht herab. Katharina blickte sich um und beobachtete ihr Spiel mit dem Wind, der sie durch die engen Gassen wirbelte. Die eine oder andere Flocke flog ihr ins Gesicht, doch sie schien es nicht zu bemerken. Ihre geröteten Wangen waren warm. Katharina kam der Schnee nicht kalt vor. Wie Daunen, die vom Himmel fielen, sah er aus und fühlte sich weich an. Sie spürte einen inneren Frieden, wie ihn nur die ersten Schneeflocken mit sich brachten und den man nur in Momenten wie diesen fühlen konnte.
Den Tag über war es dunkel und grau gewesen. Die Wolken hatten tief am Himmel gehangen, und der Duft des Schnees hatte in der Luft gelegen. Die ganze Zeit hatte sich Katharina gefragt, wann es endlich zu schneien beginnen würde.
Als dann am späten Nachmittag die ersten Flocken vom Himmel gefallen waren, hatte sie innegehalten und ihnen zugesehen. Ganz still hatte sie am Fenster gestanden, nach draußen geblickt und gelächelt.
Der Duft des Schnees, die nun erfüllte Prophezeiung, dass er wirklich kommen würde, ließ sie an ihre Mutter denken. Sie hatte immer vom Geruch des Schnees gesprochen und davon, dass er in der Luft lag. Und jedes Mal hatte sie recht behalten. Wenn sie an zu Hause dachte, fühlte sich Katharina ein wenig wehmütig. Die Erinnerungen an ihr Heimatdorf – an den Hof, das alte Bauernhaus, die Felder, Hügel und Wiesen – waren weit weg, wie aus einem anderen Leben.
Vorsichtig setzte Katharina einen Fuß vor den anderen und hielt sich dankbar am Arm ihres Gatten fest. Der Boden war hier nicht gepflastert, es war rutschig. Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen, und in der Gasse gab es nur wenige Laternen.
Hin und wieder drang Licht durch eines der kleinen Fenster nach draußen. Normalerweise ging Katharina ungern im Dunkeln durch die engen Gassen. Sie verabscheute die Winkel und Ecken, hinter denen jederzeit Gefahr lauern konnte. Aber heute war es anders, heute war es lebendiger als sonst. Um sie herum herrschte reges Treiben.
Das Martinsfest wurde mit einem großen Feuer auf dem Marktplatz gefeiert. Viele Leute hatten sich auf den Weg gemacht. Katharina beobachtete die Menschen, die gemeinsam mit ihnen die Gasse hinuntergingen. Einige kannte sie. Der alte Metzgermeister, bei dem sie immer ihr Fleisch holte, lief mit einer Horde Kinder winkend an ihnen vorüber und zwinkerte Katharina fröhlich zu. Seine Frau folgte ihm. Sie wirkte leicht abgehetzt und trug ein laut brüllendes Baby auf dem Arm. Katharina warf ihr einen mitleidigen Blick zu. Irgendwie sah sie nicht so aus, als würde ihr der Ausflug Freude machen.
An der nächsten Ecke wurde sie freundlich von zwei Frauen gegrüßt. Die beiden arbeiteten genauso wie Katharina als Schneiderinnen. Alle drei waren in einer der größten Nähereien der Stadt tätig. Ihre Kolleginnen waren ebenfalls mit ihren Ehemännern unterwegs. Katharina musterte die beiden. Anscheinend hatten sie sich fürs Martinsfest extra hübsch zurechtgemacht. Sie trugen weiße Schürzen, die am Saum mit Spitzen bestickt waren. Ihre Haare waren ordentlich unter Hauben versteckt, und ihre langen, wollenen Umhänge hatten sie sich mit hübschen bunten Bändern um den Hals gebunden.
Katharina sah kurz an sich hinunter. Sie hatte es heute mit der Garderobe nicht so genau genommen. Ihr war es eher wichtig, nicht zu frieren. Allerdings waren ihr die hämischen Blicke der beiden Frauen nicht entgangen. Sie schämte sich ein wenig. Vielleicht hätte sie heute Abend doch mehr Wert auf ihr Äußeres legen sollen.
»Vorsicht!«
Schnell zog ihr Gatte sie ein Stück näher an sich heran, als eine Gruppe Kinder laut kichernd an ihnen vorbeilief.
»Sie sind alle ganz aufgeregt«, sagte Katharina lachend und genoss seine Nähe und Wärme. Er fror anscheinend nie, sogar jetzt hatte er warme Hände. Sie blieben kurz stehen, und er strich ihr eine ihrer roten Locken aus dem Gesicht. Sie hatte es mal wieder nicht geschafft, ihre störrischen Haare zu bändigen. Doch er lächelte nachsichtig. Genau dafür liebte er sie. Er mochte es, wenn sie ein wenig zerzaust aussah, sie wirkte dann nicht so streng. Sogar hier in der dunklen Gasse konnte er ihre Sommersprossen erkennen, und selbst im Dämmerlicht schien ihre porzellanartige Haut ein wenig zu leuchten.
»Ist dir kalt?«, fragte er und rieb ihr fest über die Arme.
»Nein, mir ist warm.«
Wieder liefen einige Kinder an ihnen vorbei.
»Lass uns lieber weitergehen. Sonst verpassen wir noch alles.«
Kurze Zeit später traten sie auf den Marktplatz. Katharina liebte diesen Moment. Jedes Mal, wenn sie die Dunkelheit der Gassen verließ und den Platz betrat, kam es ihr vor, als wäre es das erste Mal. Hier war alles groß, hell und freundlich. Vor ihr ragten die Zinnen des mächtigen Rathauses in den Himmel. Der weitläufige Platz war umgeben von wunderschön gepflegten Fachwerkhäusern, die sich eng aneinanderschmiegten. Hinter ihnen erhob sich der beeindruckende Dom. Er war das größte Gebäude, das sie jemals im Leben gesehen hatte, und faszinierte sie jedes Mal aufs Neue.
Der Platz war gut gefüllt. Kinder liefen laut kreischend durcheinander. Die Leute standen in kleinen Gruppen beisammen und unterhielten sich lachend. Es roch nach warmem Apfelwein und frisch gebackenem Brot. Am Rand des Platzes waren einige Holzbuden aufgebaut worden, vor denen sich die Menschen drängelten.
In der Mitte des Platzes war ein großer Holzstapel errichtet worden, der weit in den grauen, dunklen Himmel ragte. Katharina wurde nun doch kalt. Fröstelnd rieb sie sich die Hände. »Komm, lass uns weiter nach vorn gehen. Dann können wir uns gut am Feuer wärmen.« Ihr Mann zog sie einfach mit sich. In dem Moment, als sie aus der Menge heraustraten, entzündeten zwei Männer den großen Holzstoß.
Jubel brach auf dem Marktplatz aus. Irgendwo begann ein Musikant auf seiner Geige ein fröhliches Lied zu spielen. Doch Katharina war das in diesem Moment gleichgültig. Sie hatte gehofft, dass sie stark sein würde, aber nun blickte sie wie hypnotisiert in die Flammen, die immer höher züngelten und sich ins Holz fraßen. Auf einmal kam sie sich schrecklich allein und verlassen vor. Nichts war geblieben von dem Frohsinn und der Zuversicht, die sie gerade eben noch in der Gasse empfunden hatte. Die Musik drang nicht mehr an ihr Ohr, und sie hörte auch die kreischenden Kinder nicht mehr. Die Erinnerung hatte sie eingeholt – dazu der unglaubliche Gestank, den sie niemals in ihrem Leben vergessen würde. Und plötzlich konnte sie sie hören. Die Stimmen waren in ihrem Kopf, raubten ihr die Kraft und ließen sie erzittern.
»Verbrennt sie, verbrennt die Hexen!«
Funken tanzten in den Nachthimmel und bildeten einen seltsamen Kontrast zu den weißen Schneeflocken. Das Holz knackte und barst in den Flammen, und plötzlich konnte sie sie sehen: die Hände und Füße, die Körper, wie sie immer mehr zerfressen wurden. Wie die Hitze in die Haut drang und den Menschen ihre Gesichter nahm. Der unglaubliche Gestank des brennenden Fleisches stieg in ihre Nase. Es stank erbärmlich, war unerträglich.
»Meine Liebe, ist alles in Ordnung?«, hörte sie ihren Gatten fragen, während sie die ersten Schritte rückwärtsging. Sie konnte hier nicht bleiben.
Abrupt drehte sie sich um und rannte fort von dem Feuer und der Erinnerung.
1
Ein empfindlich kalter Wind wehte über den Marktplatz in Idstein und brachte bereits die ersten Regentropfen. Fröstelnd rieb sich Katharina über die Arme und blickte zum Himmel. Die Sonne, die noch vor Kurzem von einem wolkenlosen Himmel geschienen hatte, war urplötzlich verschwunden. Der Marktplatz versank in der Dunkelheit des herannahenden Unwetters. Um sie herum war ein heilloses Durcheinander ausgebrochen. Die Händler packten eilig ihre Waren ein. Klirrend ging irgendwo ein Tontopf zu Bruch, und die Töpfe und Pfannen, die an einem der Nachbarstände verkauft wurden, schepperten im Wind.
Eilig rannte eine Gruppe Schausteller an Katharina vorbei. Gerade hatten sie noch getanzt und musiziert, jetzt flatterten ihre bunten Gewänder im auffrischenden Wind, der einer jungen Tänzerin sogar eines der bunten Bänder aus dem Haar riss.
Wo war nur der schöne Tag geblieben? Die Sonne hatte sich in den sauber polierten Fenstern der Häuser, die den Marktplatz säumten, gespiegelt. Der Duft von frisch gebratenem Fleisch und leckerem Brot hatte in der Luft gehangen, und die Gesichter der Menschen hatten Zuversicht und Freude ausgestrahlt. Eine Schar Gänse lief schnatternd an Katharina vorbei, gefolgt von einigen Hühnern. Sie zuckte erschrocken zusammen. Ein junges Mädchen, nicht älter als fünfzehn Jahre, rannte den Tieren verzweifelt hinterher.
Katharinas Mutter packte bereits hastig ihre Waren zusammen. Blusen, Kleider, Stoffe und Nähgarn wanderten unordentlich in ihren alten Karren. Katharina rollte die Spitzenbordüren ein, die sie und die Mutter zuvor liebevoll an den Rand des Brettes gehängt hatten, auf dem sie immer ihre Kleidungsstücke ausstellten. Es regnete immer stärker. Dicke Tropfen wurden vom Wind über den Platz getrieben, der sich in ein Pfützenmeer verwandelte. Katharinas Haarknoten hatte sich gelöst, rote Locken klebten in ihrem Gesicht. Das dunkelblaue Leinenkleid, das sie heute Morgen extra für den Markttag angelegt hatte, war bereits vollständig mit Wasser vollgesogen und hing schwer und kalt an ihr herunter.
»So ein Unwetter aber auch. Es ist eine Katastrophe. Einige der Sachen können wir bestimmt nicht mehr verkaufen.« Ihre Mutter stöhnte. Eva Heinemann war etwas kleiner als ihre Tochter. Ihr Haar hatte aber dieselbe kupferrote Farbe, auch wenn es bereits von einigen grauen Strähnen durchzogen war. Mit vereinten Kräften schoben sie das Brett auf den Karren und schützten damit wenigstens ein wenig die darunterliegenden Kleidungsstücke und Stoffe. Katharina atmete erleichtert auf, als sie es endlich geschafft hatten. »Gott sei Dank. Das schwere Ding. Es ist bei der Nässe richtig rutschig.«
»So werde ich niemals fertig. Alles geht kaputt. Ich bin ruiniert.«
Als sie die Stimme hörten, drehten sich beide gleichzeitig um. Agnes stand verzweifelt zwischen ihren Stoffen. Die schöne Seide, der wunderbare Satin – alles war bereits völlig durchnässt. Wenn die wertvollen Stoffe nicht bald aus dem Regen kamen, konnte Agnes sie nicht mehr verkaufen. Die kleine, leicht untersetzte Frau sah verzweifelt auf die Unmengen von Stoffballen, die um sie herumlagen.
Eigentlich war die schwere Arbeit für Agnes allein viel zu viel. Aber der Stand war die einzige Einnahmequelle der Familie, da ihr Mann so sehr von der Gicht geplagt war, dass er längere Zeit nicht arbeiten konnte.
»Wir helfen dir, Agnes.« Eva ging zu ihr hinüber. Katharina folgte ihr nicht sofort, sondern blieb noch einen Moment bei ihrem Esel Albert stehen und strich dem Tier beruhigend über seine zottelige Mähne. Der kleine Esel war sehr eigenwillig. Er war um einiges schmächtiger und kleiner als seine Artgenossen, hatte dafür aber einen ordentlichen Dickkopf. Katharina wusste, dass er es nicht mochte, im Regen zu stehen. Das Tier stampfte in den Pfützen herum. Beruhigend sprach Katharina auf den Esel ein, strich ihm liebevoll über den Hals, drückte ihren Kopf an seine warme Haut und spürte seinen Puls. Nach einer Weile wurde der Esel etwas ruhiger und hörte auf, unruhig umherzutänzeln.
Katharina hob langsam den Kopf, löste sich vorsichtig von dem Tier und ging nun ebenfalls zu Agnes hinüber. Vor Agnes’ Planwagen war ein großes kräftiges Maultier gespannt. Es war fast doppelt so groß wie Albert. Das Tier stand ganz still, blickte sich gutmütig um und schien sich für all die Aufregung und Panik um sich herum nicht zu interessieren. Sie tätschelte ihm liebevoll den Hals, bewunderte mal wieder die starken Flanken und die großen Hufe des Tieres.
»Na, du Dicker? Dir macht der Regen nichts aus, oder? Wir helfen jetzt deiner Herrin. Dann kommst du bald in deinen warmen Stall.«
Katharina wandte sich seufzend von dem Tier ab. Eine Ewigkeit hätte sie noch bei ihm stehen können. Sie liebte Pferde, Esel und Maultiere und konnte Stunden damit zubringen, Albert zu striegeln und zu bürsten. Ab und an half sie im Gassenbacher Hof im Stall aus. Das waren für sie immer perfekte Tage. Dann versank sie in der Welt der Tiere und vergaß alles andere um sich herum.
Agnes’ Tisch war immer noch voller Stoffe. Eine große grüne Bahn Brokatstoff lag direkt vor Katharina. Ein Teil des dicken Stoffes hing vom Tisch herab und schwamm in einer Pfütze. Der wertvolle Stoff schien völlig ruiniert zu sein. Seufzend rollte ihn Katharina zusammen und versuchte, die Stoffbahn zum Karren zu bringen. Der Stoff war so schwer, dass sie ihn kaum tragen konnte. Triefend nass hing er in ihren Armen, die schrecklich wehtaten. Katharina schwankte, und Agnes, die gerade eine Bahn gelbe Seide im Wagen verstaut hatte, bemerkte aus dem Augenwinkel, dass Katharina Probleme hatte, und eilte ihr sofort zu Hilfe. Mit vereinten Kräften schafften sie es, den schweren Stoff auf den Wagen zu heben. Katharina blieb, die Hand auf dem Wagen aufgestützt und schwer atmend, stehen.
»Ach du meine Güte. Wie machst du das nur immer allein, Agnes?«
Die alte Frau zuckte mit den Schultern, während sie sich bereits dem nächsten Stoffballen zuwandte.
»Es muss eben gehen. Wenn ich nicht mit dem Wagen auf die Märkte fahre, dann verhungern wir. Die Stoffe sind doch alles, was wir haben.«
Katharina richtete sich auf. Besorgt sah sie noch einmal zu Albert hinüber. Der Esel schnaubte unruhig. Hoffentlich würde er nicht einfach davonlaufen, denn er hatte sie bereits einige Male sprichwörtlich im Regen stehen lassen.
Plötzlich sah sie ein kleines Mädchen vor dem Karren. Die Kleine schien nicht viel älter als ein Jahr zu sein. Sie trug ein hellbeiges Leinenkleidchen mit einem braunen Wolljäckchen darüber. Kleine blonde Locken klebten an ihrem Gesicht. Sie stolperte neben dem Karren und fiel in eine der großen Pfützen. Ihr Mund begann zu zucken. Trotz des Regens konnte Katharina erkennen, dass die Kleine weinte. Ihre Wangen waren rot vor Kälte. Verzweifelt patschte sie mit ihren kleinen Fingerchen in der Pfütze herum.
Katharina sah sich um, aber niemand schien sich für das Kind zu interessieren.
»Was ist denn nun, Katharina?«
Katharina zuckte zusammen und drehte sich zu ihrer Mutter um.
»Sieh nur, Mutter, das Kind hier scheint ganz allein zu sein.« Evas Blick wanderte zum Karren hinüber.
»Aber das ist ja die Kleine von Schobers aus der Obergasse. Wie kommt die denn hierher?«
»Du kennst das Mädchen?«
»Aber natürlich. Sie heißt Luise. Eleonore Schober ist ihre Mutter. Du kennst sie doch.«
Eleonore war fünf Jahre älter als Katharina und kam aus Dasbach. Katharina konnte sich noch gut an die Hochzeit mit Josef Schober erinnern. Die ganze Gasse war mit Blumengirlanden geschmückt gewesen. Es hatte einen großen Schweinebraten und die besten Würste gegeben, und bis tief in die Nacht hinein hatten Musikanten fröhliche Lieder gespielt.
Eva ging zu ihrem Karren hinüber und hob die kleine Luise hoch. Liebevoll tröstete sie das Mädchen.
»Jetzt ist ja alles gut, mein Kind. Du wirst doch der Mama nicht weggelaufen sein?«
Suchend wanderte ihr Blick über den Marktplatz. Katharina und Agnes sahen sich ebenfalls um. Doch zwischen den packenden Händlern, Ziegen, Kühen, Maultieren, Hühnern, Gänsen und halb abgebauten Ständen war keine Eleonore zu sehen.
»Anscheinend ist sie wirklich von zu Hause fortgelaufen«, mutmaßte Eva. »Bestimmt hat Eleonore ihr Fehlen noch gar nicht bemerkt.«
Agnes’ Blick wanderte wieder über ihre Stoffballen, von denen immer noch viele im Regen lagen. Katharina sah die tiefen Sorgenfalten auf ihrer Stirn.
»Wisst ihr, was«, schlug sie vor, »ich bringe die Kleine schnell zu Schobers, und ihr räumt unterdessen den Wagen fertig ein.«
Eva nickte und reichte ihrer Tochter vorsichtig das Kind.
»Aber pass auf, dass du in der Gasse nicht ausrutschst. Es ist sicher sehr glitschig dort.«
Katharina lächelte nachsichtig. Ihre Mutter behandelte sie manchmal immer noch wie ein kleines Kind und vergaß, dass sie es mit einer erwachsenen jungen Frau zu tun hatte. »Wir werden das schon schaffen«, antwortete sie, ein Lächeln auf den Lippen.
Mit dem Kind auf dem Arm lief sie über den Marktplatz, vorbei an Ziegenpferchen und Hühnern, die in kleinen Holzkästen dem Regen trotzten. Viehhändler, Handwerker und Gerber rannten durcheinander. Fuhrwerke fuhren an, Pferde und Maultiere wieherten und stampften mit den Hufen.
Eigentlich war Idsteins Marktplatz ein ruhiger und friedlicher Platz, über den der große Bergfried wie ein Beschützer wachte. Seine Spitze war heute im Regen und im Nebel der Wolken kaum auszumachen, ebenso wenig wie das Schloss des Grafen, das dahinterlag.
Katharina war noch nie dort oben gewesen. Immer nur aus der Ferne hatte sie das beeindruckende Gebäude bewundert. Unterhalb des Bergfrieds stand grau und düster das alte Torbogengebäude, neben dem das Büro des ehrwürdigen Herrn Amtsrats untergebracht war.
Wenn kein Markt war, herrschte hier eine friedliche und ruhige Atmosphäre. Kleine Holzbänke standen unter den Bäumen, auf denen man an warmen Frühlingstagen ausruhen konnte. Kein hektisches Treiben übertönte dann die ruhige Beständigkeit, die die Fachwerkhäuser ausstrahlten. In den kleinen Läden, Geschäften und Werkstätten ging jeder seiner Arbeit nach. Ab und an fuhr ein Fuhrwerk vorbei, kleine Kinder liefen lachend durch die Gassen. Am oberen Ende des Platzes holten die Frauen aus dem Brunnen ihr Wasser und erfuhren die Neuigkeiten und den Tratsch aus den Dörfern und der Schlossküche. Doch heute konnte Katharina den Brunnen nicht sehen, denn die Filzerei hatte davor ihren Stand aufgebaut. Zwei junge Frauen waren damit beschäftigt, Taschen, Schuhe, Hüte und sonstige Utensilien zusammenzuraffen. Katharina kannte die beiden vom Sehen und nickte ihnen kurz zu, während sie schwungvoll in die Obergasse einbog.
»So pass doch auf, du dummes Ding.«
Erschrocken wich Katharina zurück. Sie war einem großen Mann direkt in die Arme gelaufen.
»Entschuldigt, mein Herr«, murmelte sie leise und sah beschämt zu Boden. Sein schwarzer Hut schwamm in einer Pfütze vor ihr.
Sie bückte sich und fischte ihn heraus. Vorsichtig hob sie den Blick, während sie ihm seinen Hut reichte – und erstarrte. Eiskalte blaue Augen sahen sie an. Eiskalte Augen, die sich tief in ihr Innerstes bohrten.
Hastig griff der Mann nach seinem Hut. Katharina wich einen Schritt zurück.
»Jetzt ist er völlig ruiniert«, schimpfte der Mann, der ganz in Schwarz gekleidet war, mit einem schwarzen Wams, einer schwarzen Hose und schwarzen Stulpenstiefeln.
Katharina zitterte. »Entschuldigt«, murmelte sie leise. »Ich habe nicht auf den Weg geachtet.« Sie spürte eine große Unruhe in sich und wäre am liebsten weggelaufen.
Der schwarze Mann musterte sie von oben bis unten. Er hatte eigentlich weitergehen wollen, war nun aber doch stehen geblieben. Diese junge Frau hatte etwas sehr Seltsames an sich. Er konnte es sich nicht erklären. Sie war eigentlich nichts Besonderes. Ziemlich groß für eine Frau, sehr dünn und schmal gebaut, kaum zwanzig Jahre alt. Ihr rotes Haar wellte sich um ihr Gesicht, Regen tropfte auf ihr dunkles Leinenkleid. Sie sah aus wie viele andere Frauen auch. Doch irgendetwas war anders. Sie wirkte selbstbewusst und stark.
Die kleine Luise auf Katharinas Arm schmatzte laut, den Daumen im Mund, und fühlte sich sichtlich wohl. Der Regen und die Kälte schienen das Kind nicht mehr zu beeindrucken. Katharina zitterte noch immer und drückte die Kleine ein wenig fester an sich, als müsste sie das Kind vor diesem seltsamen Fremden beschützen.
Der Mann schüttelte kurz den Kopf.
»Pass das nächste Mal besser auf.«
Hastig schob er sich an ihr vorbei. Katharina fing seinen Geruch auf. Eine seltsame Mischung aus Schwefel, Wein und Holzrauch stieg ihr in die Nase.
Nachdem der schwarze Mann verschwunden war, atmete Katharina erleichtert auf und versuchte, das Grauen und ihre Angst abzuschütteln. Luise lutschte noch immer an ihrem Daumen. Instinktiv presste Katharina ihre Nase an den Hals des Kindes und sog den beruhigenden Geruch tief in sich hinein. Luise duftete nach feuchtem Leinen und Haferbrei, und in ihrem Haar hing ein Hauch von Kamille. So konnten nur kleine Kinder duften. Katharina beruhigte sich ein wenig. Das Zittern ließ nach.
Langsam lief sie die Gasse weiter hinauf. Sie musste aufpassen, wo sie hintrat, der Boden war nicht gepflastert und schmierig. Stöhnend schob sie das Kind auf ihrem Arm ein Stück nach oben und blickte im Vorbeigehen in die Hinterhöfe der Häuser. Wie immer stapelten sich dort Essensreste und andere Abfälle. Der fürchterliche Gestank von verfaultem Fleisch, Gemüse und Urin hing in der Luft. Überall liefen Ratten herum. Die Tiere waren nicht besonders scheu, kreuzten sogar ihren Weg. Sie wich angewidert vor einem alten Bettler, der an der nächsten Ecke im Abfall wühlte, zurück. Der arme Kerl trug ein schäbiges Hemd, seine Hose war zerschlissen, und seine Füße waren nackt. Er sah Katharina aus müden Augen an, hob seinen zerschlissenen Hut zum Gruß und schenkte ihr ein zahnloses Lächeln. Widerwillig musterte sie ihn, gab dann aber doch mit einem kurzen Nicken seinen Gruß zurück.
Kurz bevor sie das Haus der Schobers erreichte, kam ihr eine völlig aufgelöste Eleonore entgegen. Bei Katharinas Anblick lächelte sie erleichtert.
»Luise, da bist du ja. Kind, wo bist du nur gewesen?«
Überglücklich nahm sie Katharina das Kind aus den Armen. Tränen der Erleichterung standen in Eleonores strahlenden Augen. Liebevoll küsste sie die Wangen ihrer Tochter und drückte sie ganz fest an sich. Immer wieder strich sie der Kleinen über die blonden Löckchen, als könnte sie es kaum fassen, dass sie das Kind wiederhatte.
Nach einer Weile setzte sie Luise auf ihre Hüfte und bedankte sich bei Katharina.
»Danke, Katharina. Wo hast du denn unsere kleine Ausreißerin gefunden?«
»Sie tauchte auf einmal vor unserem Karren auf. Weil wir dich nirgendwo sahen, nahmen wir an, dass sie dir weggelaufen ist.«
Eleonore stöhnte.
»Sie läuft zur Zeit andauernd weg. Ständig bin ich dabei, sie zu suchen. Keine Tür kann ich mehr offen stehen lassen. Gott sei Dank hast du sie gefunden. Bei dem Durcheinander, das auf dem Marktplatz herrscht, hätte ja alles Mögliche passieren können.«
Luise streckte lachend ein Händchen nach Katharina aus und quietschte vor Freude. Katharina stupste der Kleinen sacht auf die Nase.
»Ist ja noch mal gut gegangen. Aber das solltest du nicht mehr machen, Luise. Die Mama braucht dich doch.«
Eleonore musterte ihre Tochter.
»Ich denke, du brauchst jetzt erst einmal ein warmes Bad. Du bist ja ganz kalt.«
Ihr Blick fiel auf Katharina. »Möchtest du mit reinkommen? Ein warmer Tee wird dir sicher guttun.«
Katharina hätte gerne Ja gesagt. Ein warmer Tee wäre jetzt wunderbar gewesen. Aber sie musste zurück. Die Mutter wartete bestimmt schon auf sie. Sie schüttelte wehmütig den Kopf.
»Nein, ich kann nicht. Die Mutter wartet mit den Sachen. Wir müssen nach Hause.«
»Aber dann ein andermal. Komm doch, wenn du das nächste Mal in der Stadt bist, bei uns vorbei. Irgendwie muss ich mich für deine Hilfe erkenntlich zeigen.«
»Aber das war doch selbstverständlich. Jeder hätte so gehandelt.«
Katharina strich sich die Haare aus dem Gesicht. Der provisorische Knoten im Nacken hatte sich gelöst.
Eleonore musterte Katharina verstohlen von der Seite. Sie hatte sie schon lange nicht mehr gesehen. Katharina war groß und hübsch. Ihre Haut schimmerte ein wenig wie Porzellan. Die vielen Sommersprossen in ihrem Gesicht gaben ihr etwas Weiches. Sie war sehr schlank, fast ein wenig zu schmal. Bestimmt würde Eva bereits nach einem guten Gatten für Katharina Ausschau halten.
»Nein, so selbstverständlich ist das nicht«, sagte sie schließlich und zog Katharina liebevoll an sich. »Es war schön, dich zu sehen. Sag deiner Mutter einen lieben Gruß von mir.«
»Gerne«, antwortete Katharina, »und du solltest wohl etwas besser darauf achten, dass die Türen geschlossen sind. Nicht dass die Maus noch in den Stadtbrunnen plumpst.«
»Das mache ich, versprochen.«
Winkend lief Katharina die Gasse hinunter.
Eva stand zitternd vor dem Karren, als Katharina zurückkam. Agnes war verschwunden. Der Platz war fast völlig leer. Verwundert sah sich Katharina um. War sie so lange weg gewesen?
Als sie ihre Mutter erreichte, schien diese unendlich erleichtert zu sein. Der starke Regen hatte sich in einen kalten Nieselregen verwandelt, der wie feiner Nebel vom Himmel fiel. Alberts Mähne hing traurig herab. Er sah missmutig aus, hatte es aber anscheinend aufgegeben, ständig mit den Hufen zu stampfen, und stand still da.
»Wo warst du denn so lange?«
Evas Stimme zitterte. Sie war völlig durchgefroren. Erst jetzt bemerkte auch Katharina wieder die Kälte. Seltsam, vorhin in der Gasse war ihr noch richtig warm gewesen. Bei dem Gedanken an die Gasse erschauerte sie. Erneut sah sie die eiskalten Augen des seltsamen Mannes vor sich und rieb sich fröstelnd über die Arme.
»Es war sehr voll auf dem Marktplatz. Am Anfang war es gar nicht so leicht, durchzukommen. Eleonore war unendlich erleichtert.«
»Also ist ihr die Kleine doch weggelaufen.« Eva nahm, während sie dies sagte, Alberts Zügel, und sie setzten sich langsam in Bewegung. »So warst du in dem Alter auch«, fuhr Eva lächelnd fort. »Dich musste ich auch immer suchen.«
Albert schnaubte. Katharina legte beruhigend ihre Hand an seinen warmen Hals. Es begann zu dämmern, und die Häuser und Höfe versanken immer mehr im Zwielicht. Niemand war mehr zu sehen. Nur die Geräusche des Esels, das Rattern der Räder und ihre Schritte waren zu hören. Die Mutter atmete schwer. Ein langer und anstrengender Tag neigte sich seinem Ende zu. Erneut dachte Katharina an den schwarzen Mann und seinen seltsamen Blick. Sollte sie ihrer Mutter davon erzählen? Sie verwarf den Gedanken wieder. Es war ja eigentlich nichts passiert. Sie war nur mit jemandem zusammengestoßen.
Kurz darauf erreichten sie das Stadttor und liefen aufs freie Feld hinaus. Erst jetzt fiel die letzte Anspannung von Katharina ab. Befreit atmete sie die frische Luft ein. Endlich ging es zurück zu ihrem Hof in Niederseelbach.
2
In dem kleinen Raum war die Kerze auf dem Nachttisch bereits weit heruntergebrannt. Sie flackerte ein wenig, als Pfarrer Wicht die Tür öffnete. Die Vorhänge am Fenster waren zugezogen, und die Gerüche von Schweiß und Urin schlugen ihm entgegen. Eine besondere Mischung, die nur in Räumen in der Luft lag, in denen der Tod anwesend war. Das ordentlich zurechtgemachte Bett füllte fast den ganzen Raum aus. Die Augenlider des Kranken flatterten leicht, er hatte die Hände gefaltet.
Michael Leitner war kein besonderer Mensch. Er war ein einfacher Handwerker, der sich aber einen hervorragenden Ruf als Sattler erarbeitet hatte. Aus ganz Nassau erhielt er inzwischen Aufträge und war in der Stadt mehr als beliebt. Sogar den Gassenbacher Hof belieferte er mit Waren, genauso wie die Stallungen des Grafen, worauf er besonders stolz war. Sein großes gepflegtes Anwesen lag etwas versteckt in einem Hinterhof. Überall auf dem Gelände waren Tierhäute gestapelt, und es duftete nach frisch gegerbtem Leder.
Vorsichtig setzte sich Pfarrer Wicht zu dem schwer atmenden Mann ans Bett.
Er war Priester aus Leidenschaft, ein Mann Gottes. Für ihn waren solche Besuche normal und gehörten zu seinem Alltag. Doch heute fühlte er sich in seiner Haut nicht wohl. Am liebsten hätte er Gevatter Tod fortgeschickt, aber das konnte er nicht. Michael Leitner hustete und versuchte, ein wenig den Kopf zu heben, was ihm aber nicht gelang. Beruhigend strich Pfarrer Wicht ihm über den Arm. Der Husten saß tief und hörte sich trocken an. Pfarrer Wicht seufzte. Michael Leitner war nicht der Erste, bei dem er dieser Tage saß. Diese Krankheit war schrecklich, sie griff immer weiter um sich und ließ sich einfach nicht aufhalten.
Die Tür hinter ihm quietschte ein wenig, als Magdalena Leitner vorsichtig den Raum betrat. Sie hatte verweinte Augen, unter denen tiefe, dunkle Schatten lagen. Unter ihrem Kleid war die Wölbung ihres Bauches zu erkennen, bald würde sie ihr fünftes Kind zur Welt bringen. Die Augen des Pfarrers blieben kurz an ihren Rundungen hängen. Stolz hatte Michael ihm vor einer Weile von der erneuten Schwangerschaft seiner Frau erzählt.
»Kann ich dabei sein?«, fragte Magdalena und sah den Priester schüchtern an.
»Aber natürlich.«
Pfarrer Wicht nickte der jungen Frau aufmunternd zu. Irgendwo im Haus fiel klirrend etwas zu Boden, und ein Kind begann zu weinen. Magdalena schien es nicht zu bemerken. Sie schloss behutsam die Tür und stellte sich an die andere Seite des Bettes. Der Pfarrer sprach leise die Sterbesakramente. Magdalena rannen Tränen über die Wangen. Liebevoll hielt sie die Hand ihres Gatten, blickte ihn voller Zuneigung an, während sie den Worten des Priesters lauschte, die ihr weit entfernt schienen. Sanft strich sie Michael mit einem Finger über die Wange.
Der Priester beobachtete die junge Frau voller Mitleid. Magdalena verlor nicht nur ihren Gatten und Versorger, sie verlor den Mann, den sie liebte. Michael Leitner atmete nur noch flach, und seine Augenlider flatterten kaum noch.
Pfarrer Wicht sprach ruhig weiter und konzentrierte sich wieder auf seine Worte. Obwohl er sie auswendig wusste, las er sie weiter vor. Er wollte die trauernde Frau nicht mehr ansehen und versuchte, ihr ausgemergeltes Gesicht und ihre zitternden Hände auszublenden. Er tat hier nur seine Arbeit und spendete einem ihm anvertrauten Menschen die Sterbesakramente. Als er Michael Leitner die Stirn salbte, schniefte Magdalena und rieb sich beschämt die Tränen aus den Augen. Sie wollte nicht laut sein, diesen Augenblick nicht stören. Pfarrer Wicht strich dem Sterbenden, bevor er sich erhob, noch einmal über den Arm. Der Gestank nahm ihm langsam den Atem. Eine Weile konnte er ihn ertragen, doch dann überkam ihn jedes Mal Panik, und er musste fort aus solchen Räumen, weg von den Sterbenden und ihrem Weg ins ewige Leben.
Magdalena folgte ihm aus dem Raum, schloss leise die Tür und ging mit ihm die Treppe hinunter. Neugierig steckte ein kleines braunhaariges Mädchen seinen Kopf durch die Küchentür. Ihre Wangen waren leicht gerötet, und sie hatte einen süßen Erdbeermund. Die Ähnlichkeit zu ihrem Vater verschlug Pfarrer Wicht kurz den Atem. Unschuldig sah sie den Priester aus ihren braunen Augen an.
»Hast du den Papa jetzt wieder gesund gemacht?«
Aufgeregt wollte Magdalena das Kind wegscheuchen. »Juliana, wir haben doch …«
Pfarrer Wicht hielt sie zurück und ging langsam vor der Kleinen in die Hocke. »Nein, das kann ich leider nicht. Der liebe Gott hat ihn gerufen. Er braucht ihn ganz dringend.«
»Aber ich brauche ihn doch auch.«
»Ich weiß, mein Kind« – er strich ihr tröstend übers Haar –, »aber so ist nun einmal der Lauf der Dinge, wir können sie leider nicht ändern.« Erneut wurde es ihm ein wenig schwer ums Herz. Wie sollte so ein kleines Kind den Tod verstehen? Liebevoll nahm Magdalena ihre Tochter in die Arme und wischte sich beschämt die aufsteigenden Tränen aus den Augen.
Pfarrer Wicht stand etwas unbeholfen im Flur. Eigentlich sollte er aus Höflichkeit noch einen Moment länger bleiben, aber er konnte es nicht. Überall hier war Gevatter Tod und lauerte auch bereits auf ihn selbst. Er wartete nur noch auf den richtigen Moment, um ihn zu holen, das fühlte Pfarrer Wicht in seinen alten Knochen. Traurig blickte er noch einmal zur Treppe. Den jungen Mann dort oben holte er bereits, obwohl es dafür eigentlich noch viel zu früh war. Für ihn war es noch nicht richtig, zu gehen. Tröstend strich er der zukünftigen Witwe noch einmal über den Arm.
»Solltet Ihr Hilfe brauchen, dann kommt zu mir. Ihr wisst, die Kirche lässt Euch nicht allein. Irgendein Weg wird sich immer finden.«
Dankbar sah Magdalena ihn an. Sie war eine fromme Frau, die er immer gerne im Gottesdienst sah. Keinen Sonntag ließ sie aus, auch jetzt, als ihr Mann krank war, kam sie treu in die Kirche. Doch all ihr Beten und Flehen hatte nichts genützt, das Schicksal wollte es anders.
Er öffnete die Haustür, und frische kalte Luft wehte ihm entgegen. Dankbar trat er in die Dunkelheit des Hofes hinaus, während Magdalena in der Tür stehen blieb.
»Sobald es vorbei ist, komme ich wegen der Beerdigung und allem vorbei.« Ihre Stimme stockte.
Er nickte und hob die Hand zum Gruß.
Als sich die Tür hinter ihm schloss, atmete er auf. Endlich war es überstanden. Langsam lief er über den Hof und genoss den kühlen Abendwind. Im Stall gackerten einige Hühner, und er hörte eine Ziege meckern. Das alte Hoftor quietschte, als er es öffnete. Draußen herrschte völlige Dunkelheit. Erst jetzt wurde ihm bewusst, wie spät es schon war. Hastig schloss er das Tor und lief die Gasse hinunter. Er musste sich beeilen, denn der Graf wartete bereits auf seinen Bericht von den Umbauarbeiten der Kirche.
Eine Windböe erfasste seinen Umhang, fröstelnd zog er diesen enger um sich. In diesem Jahr war es bereits ungewöhnlich kalt, Schnee lag schon seit Tagen in der Luft.
Alles war ruhig und friedlich. Doch der Pfarrer drehte sich immer wieder um, spähte in die Hinterhöfe und Fenster. Es war nicht gut, allein durch die Dunkelheit zu laufen, denn die Ruhe war trügerisch. Er wusste bereits seit Langem, dass es der Teufel war, der in den dunklen Winkeln lauerte und versuchte, sich seine Opfer zu holen. Idstein hatte sich verändert. Den Menschen tat der neue Wohlstand nicht gut, sie wurden zu leichtfertig.
Damals, nach dem Dreißigjährigen Krieg, da mussten alle sehen, wie es weiterging. Da war keine Zeit gewesen für Trinkgelage und Hurerei. Die Häuser und Höfe hatten leer gestanden, und jeder hatte ums Überleben kämpfen müssen. Doch jetzt ging es allen wieder gut – und sie vergaßen nur zu oft, Buße zu tun und tugendhaft zu sein.
Erleichtert darüber, der dunklen Gasse entkommen zu sein, trat er auf den Marktplatz.
Ruhig lagen die Häuser vor ihm, der alte Nachtwächter entzündete am anderen Ende eine Laterne und verschwand dann in einer der Gassen. Ein unangenehmer Wind wehte dem Pfarrer plötzlich ins Gesicht und zog an seinem Hut. Mit gesenktem Haupt und schnellen Schrittes lief er am hell erleuchteten Gasthaus Zum Schwanen vorbei. Er verabscheute dieses Haus der Sünde, in dem der Teufel in Form von Bier, Wein und Hurerei sein Unwesen trieb. Erschrocken zuckte er zusammen, als sich die Tür zur Gaststube plötzlich öffnete. Eine Gruppe junger Männer trat laut lachend und grölend auf die Straße. Einer von ihnen entdeckte den Priester.
»Na, da sieh mal einer an, wer da so spät noch durch die Gassen läuft. Müsst Ihr nicht in Eurer Kirche sein, Herr Pfarrer?«
Pfarrer Wicht rümpfte die Nase, obwohl er ein ganzes Stück von der Gruppe entfernt stand, konnte er die Alkoholausdünstungen der Männer riechen.
»Ach, Anton«, rief einer, »lass doch den armen Pfarrer in Ruhe, du hast ihn erschreckt.«
Erneut begannen die Männer zu lachen.
»Ihr solltet mal Wein trinken«, lallte einer, »der macht das Leben gleich viel schöner und lässt einen die Sorgen vergessen.«
Pfarrer Wicht versuchte, sich zu beherrschen. Diese Männer waren betrunken, es machte keinen Sinn, mit ihnen zu sprechen. Er ließ sie einfach stehen, wandte sich ab und lief weiter, beschleunigte seine Schritte.
Die Männer lachten und grölten, riefen ihm noch irgendetwas hinterher, doch er konnte ihre Worte nicht mehr verstehen. Außer Atem erreichte er das Torbogengebäude und blieb, sich an der Mauer abstützend, für einen Moment stehen. Was war nur geschehen? Warum hatten sich die Menschen so verändert?
»Guten Abend, Herr Pfarrer, ist alles in Ordnung?«
Pfarrer Wicht schrak zusammen. Als er aufblickte, sah er in die gutmütigen Augen des Herrn Amtsrats.
»Ja, ja, alles in Ordnung. Guten Abend, Herr Amtsrat.«
Der Geistliche richtete sich auf und strich sich würdevoll über die Robe. Der Amtsrat musterte ihn misstrauisch.
Pfarrer Wicht musste bei seinem Anblick innerlich lächeln. Der Amtmann war leicht untersetzt und einen halben Kopf kleiner als er. Er trug wie immer seine samtene Amtstracht und fein polierte Lederschuhe mit Absatz und Silberschnallen. Dunkle Locken fielen unter seinem breitkrempigen Hut bis auf seine Schultern.
Eigentlich hätte er auf andere Menschen beeindruckend wirken müssen, bei der kostbaren Kleidung, die er trug. Aber der dicke Mann wirkte eher wie ein aufgeplusterter Truthahn.
»Was treibt Euch denn zu so später Stunde noch ins Schloss?« Pfarrer Wicht schob seine unfeinen Gedanken beiseite.
»Ich möchte dem Grafen von den Fortschritten in der Kirche berichten.«
»Ach, ja richtig, diese wird ja renoviert. Wie geht es denn mit den Arbeiten voran?«, fragte der Amtsrat.
Der Priester geriet ins Schwärmen, was er immer tat, wenn ihn jemand auf die Kirche ansprach.
»Oh, es ist so wunderbar. Die Künstler sind von Gott gesegnet und schaffen einzigartige Bilder. Die ganze Ausstattung, der Marmor und die Skulpturen, es wird einfach bezaubernd.«
»Wann darf das Meisterwerk denn besichtigt werden?«
»Jetzt natürlich noch nicht. Aber an Weihnachten werden wir, wie in jedem Jahr, einen feierlichen Gottesdienst in der Kirche abhalten. Ich hoffe, dass die Arbeiten bis dahin abgeschlossen sind. Wenn die Künstler so weitermachen wie bisher, steht dem Ganzen bestimmt nichts im Wege.«
»Aber das ist ja wunderbar. Dann wird es dieses Jahr ein besonderes Fest.«
»O ja, das wird es«, antwortete der Pfarrer, der allmählich ungeduldig wurde.
»Aber jetzt muss ich weiter. Der Graf erwartet mich. Leider hat mich ein Sterbefall aufgehalten.«
»Ach du meine Güte, wer ist denn der Arme?«
Der Pfarrer biss sich auf die Lippe. Er hätte es besser wissen sollen. Jetzt wurde er noch länger aufgehalten.
»Michael Leitner aus der Obergasse hat eine schlimme Lungenentzündung.«
Hätte er das sagen dürfen? Verletzte er damit nicht seine Gelübde? Aber andererseits wusste bereits die halbe Stadt, dass der Mann krank war.
»Ach ja, richtig, davon habe ich auch schon gehört. Die arme Magdalena Leitner, jetzt, wo sie auch noch das Kind erwartet, schrecklich ist so etwas.«
Pfarrer Wicht verdrehte die Augen, er musste den Amtsrat endgültig loswerden.
»Aber nun muss ich wirklich weiter. Der Graf wird sicher schon ungeduldig auf mich warten.«
»Entschuldigt, jetzt habe ich Euch aufgehalten.« Die Stimme des Amtsrats klang schmeichelnd, er hob seinen Hut zum Gruß und setzte sich endlich wieder in Bewegung.
»Dann wünsche ich Euch noch einen guten Abend und einen sicheren Heimweg.«
Der Pfarrer wandte sich erleichtert zum Gehen.
»Euch auch eine gute Nachtruhe, Herr Amtsrat. Und grüßt Eure werte Frau Gemahlin.«
Eilig lief er am Bergfried vorbei und über die Brücke, die zu dem weißen Renaissance-Gebäude hinaufführte. In diesem brannte nur noch in wenigen Fenstern Licht. Es war wunderbar und einmalig, das Schloss wieder in seiner alten Pracht zu sehen. Der Graf hatte es nach seiner Rückkehr aus dem Exil instand setzen lassen. Aus der teilweise ausgebrannten Ruine, die nach dem Krieg die wenigen Häuser Idsteins überragt hatte, war wieder ein herrschaftliches Anwesen geworden, das einem Grafen als Sitz mehr als würdig war.
Als ein Page ihm später das Schlosstor öffnete, entfloh Pfarrer Wicht dankbar dem kalten Wind.
»Guten Abend, Herr Pfarrer.« Der junge Mann senkte sein Haupt zum Gruß. »Darf ich Euch Euren Umhang abnehmen?«
Pfarrer Wicht löste die Schnüre seines Umhangs, reichte ihn dem jungen Pagen und musterte den Knaben misstrauisch. Er schien neu im Schloss zu sein, denn er hatte ihn vorher noch nie gesehen.
»Der Graf erwartet Euch in der Bibliothek«, sagte der Page, der nicht älter als fünfzehn Jahre sein mochte.
Pfarrer Wicht war neugierig. Am liebsten hätte er den Burschen gefragt, wo er herkam, denn eigentlich kannte er alle Jungen seines Alters in Idstein. Aber da er in Eile war, verkniff er sich die Frage und schlug den Weg zur Bibliothek ein.
Der lange Gang wurde durch einige Kerzen erhellt, die in hübschen, mit gläsernen Kristallen verzierten Halterungen an der Wand steckten. Ein prachtvoller Teppich dämpfte seine Schritte. Keine Bediensteten waren unterwegs, eine beruhigende Stille hüllte ihn ein.
Erhobenen Hauptes betrat er die Bibliothek, die der beeindruckendste Raum des ganzen Schlosses war. Ein großes Gemälde bedeckte die von Stuck eingerahmte Decke, hohe Bücherregale aus massivem Eichenholz säumten die Wände. Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Büchern und Schriftrollen standen und lagen darin. Pfarrer Wicht atmete den Duft der Bücher ein, die Mischung von Papier und Leder, die es nur in diesem prachtvollen Raum gab. In einem großen, offenen Kamin brannte ein knisterndes Feuer, und auf einem flauschigen weißen Teppich, der direkt vor dem Kamin ausgebreitet war, standen zwei große, mit grünem Stoff bezogene Lehnstühle. Der Graf beugte sich in einem der Stühle nach vorn und lächelte, als er den Priester erblickte.
»Guten Abend, Herr Pfarrer. Kommt zu mir. Hier am Feuer könnt Ihr Euch wärmen.«
Das ließ sich der Priester nicht zweimal sagen. Er verneigte sich kurz und setzte sich in den großen Lehnstuhl, der dem des Adligen gegenüberstand. Dankbar hielt er seine kalten Hände ans Feuer.
»Ihr kommt spät.« Des Grafen Stimme klang leicht missbilligend.
»Ich wurde leider noch aufgehalten. Eine Familie hat um die Sterbesakramente gebeten. Das kann ich nicht ablehnen. Entschuldigt, Euer Gnaden.«
Der Graf nickte. »Ist es jemand, den ich kenne?«
»Ja vielleicht. Michael Leitner, der Sattler, liegt im Sterben. Er beliefert auch Eure Stallungen mit Waren. Er ist noch sehr jung, hat Familie, Frau und Kinder.«
»Was für ein Jammer. Was fehlt dem junge Mann denn?« Der Pfarrer wusste, dass die Anteilnahme des Grafen nur gespielt war. Er interessierte sich nicht besonders für die Belange und Sorgen seiner Untertanen. Früher hatte er sich mehr darum gekümmert, aber seit er alt geworden war, hatte er für solche Dinge keinen Sinn mehr.
»Es ist vermutlich eine Lungenentzündung. Es gab, besonders in der letzten Zeit, mehrere Todesfälle dieser Art, aber bisher sind nur kleine Kinder und alte Leute daran gestorben. Es ist traurig, dass es ausgerechnet ihn erwischt hat. Er war so ein guter und fleißiger Mann. Diese Nacht wird er wohl nicht überleben.«
Pfarrer Wicht musterte den Grafen, während er sprach. Dieser trug ein weißes Hemd, das er an den Armen hochgekrempelt hatte, dazu dunkelbraune, samtene Kniehosen, die im Schein des Feuers schimmerten. Die Locken seiner dunklen Perücke waren wie immer ordentlich frisiert und wellten sich sanft auf seine Schultern. Doch der Priester ließ sich von der Maskerade nicht täuschen. Der Graf sah müde und abgespannt aus, tiefe Falten lagen um seine Augen, und seine Wangen waren eingefallen.
Eine junge Dienerin trat fast unhörbar näher. Sie trug ein Tablett mit Tee und Gebäck und stellte es langsam auf dem kleinen Tisch ab, der zwischen den Sesseln stand. Vorsichtig schenkte sie die dampfende, nach Pfefferminz duftende Flüssigkeit in die Tassen aus feinstem Porzellan.
Als sie fertig war und den Raum verlassen hatte, beugte sich der Graf mit einem aufgeregten Glänzen in den Augen nach vorn.
»Lasst uns jetzt lieber über etwas Angenehmeres sprechen. Wie gehen denn die Arbeiten in der Kirche voran?«
Der Pfarrer nahm einen kleinen Schluck von dem heißen Tee und stellte die zerbrechlich aussehende Tasse vorsichtig auf dem Tisch ab. Erneut geriet er ins Schwärmen.
»Ach, es ist so bezaubernd. Herr Immenraedt und die anderen Künstler schaffen jeden Tag unglaubliche Meisterwerke. Es ist faszinierend, was Gott diesen Menschen für einzigartige Talente mitgegeben hat. Der dunkle Marmor, die zauberhaften Gemälde und Skulpturen – ich bin jeden Tag wieder aufs Neue begeistert. Ihr müsst unbedingt in die Kirche kommen und die Meisterwerke bewundern.«
Der Graf bemerkte das Leuchten in den Augen des Geistlichen. Am liebsten wäre er sofort aufgesprungen und mit dem Pfarrer zur Kirche gegangen. »Gerne komme ich einmal wieder in die Kirche. Aber das wird noch ein wenig dauern.« Er zeigte auf sein Bein, das eingebunden auf einem kleinen Hocker lag. Erst jetzt fiel es dem Pfarrer auf.
»Mich plagt mal wieder die Gicht. Bei dieser schrecklichen Kälte ist das aber auch kein Wunder.«
»Das tut mir leid, Euer Gnaden.« Pfarrer Wicht setzte eine betroffene Miene auf und gab sich alle Mühe, Anteilnahme zu zeigen. »Ich werde zu Gott beten, damit es Euch bald wieder besser geht.«
Der Graf winkte ab.
»Na, ob der mir noch helfen kann, wage ich zu bezweifeln.« Der Pfarrer sah Graf Johannes entgeistert an. Seit wann sprach der Graf in solchen Tönen? Er war doch immer ein gottesfürchtiger Mann gewesen, der zeit seines Lebens Trost im Gebet gesucht hatte.
»Wie meint Ihr das?«
»Neulich war Meister Leonhard bei mir.«
Pfarrer Wicht zog bei diesem Namen die Augenbrauen hoch. Er mochte den Henker des Grafen nicht, an ihm hafteten Blut und Sünde. Leonhard Busch war ein überheblicher Mann, der seltsame Tränke und Wundermittel braute und so gut wie nie den Gottesdienst besuchte. Nicht ein einziges Mal hatte Pfarrer Wicht gesehen, dass der Henker Zwiesprache mit Gott hielt.
Der Graf fuhr fort:
»Er hat mir mit der Gicht geholfen. Mein dummer Medikus ist ja mal wieder auf Reisen. Seine Salben sind, Gott sei’s gedankt, ebenfalls sehr wirkungsvoll, damit wird es sicherlich bald besser gehen. Er hat mir von einigen seltsamen Vorkommnissen erzählt. Ungemach und Hexerei sollen in der Luft liegen, so manchen Schadenszauber hat er bereits aufgedeckt. An vielen Höfen geben die Kühe keine Milch mehr, einige Pferde sind auf seltsame Art und Weise umgekommen, und seine Tinkturen und Salben sind wirkungslos geblieben. Der Teufel hat seiner Meinung nach die Hände im Spiel, und bestimmt gibt es Hexentanz und Buhlschaften. Natürlich hat er selbst es nicht gesehen, aber er geht fest davon aus, dass die Hexen unter uns sind. Habt Ihr von solchen Gerüchten auch etwas gehört?«
Der Pfarrer war überrascht, dass der Graf das Thema ansprach. Mit Schaudern dachte er an die dunklen, unheimlichen Gassen, in denen er sich nicht mehr sicher fühlte.
»Seltsam, dass der Henker solche Dinge sagt.«
Nachdenklich fuhr er sich mit der Hand übers Kinn. Wie sollte er dem Grafen seine Gefühle erklären? Denn von Schadenszaubern, Tinkturen und deren Wirksamkeit hatte er natürlich nicht so viel Ahnung. Aber er bemerkte die anderen Laster, spürte ebenfalls den Teufel, sah das Böse an jeder Ecke aufblitzen. Er begann, seine Eindrücke zu schildern:
»Idstein hat sich auch in meinen Augen verändert, den Menschen geht es zu gut. Sie frönen wieder zu sehr dem Wein und dem Weibe. Gerade eben hat mich der Pöbel auf der Straße belästigt. Eure Untertanen verlieren immer mehr den Respekt vor der Obrigkeit. Die Menschen suchen nicht mehr ihr Seelenheil in der Kirche und im Gebet. Gerüchte über Schadenszauber sind mir nicht zugetragen worden, aber der Teufel hat viele Gesichter. Die Sünde steckt in einer Vielzahl von Dingen, die wir uns oft nicht erklären können.«
»Also seid Ihr derselben Meinung wie Meister Leonhard?«
»In Bezug auf die Sünde mit Sicherheit. Der Teufel kann durchaus unter uns sein.«
»Und wie erkennen wir ihn?«
»Das ist nicht leicht. Er sucht sich seine Opfer unter den Schwachen, unter denen, die ihren Glauben verloren haben. Diejenigen, die nicht eng genug mit Gott verbunden sind, die wird er erwählen und zu seinen Sklaven machen.«
Der Graf seufzte.
»Was soll ich denn jetzt tun? Ich kann doch nicht zulassen, dass in Nassau der Teufel umgeht.«
Der Pfarrer dachte an die drei jungen Männer und sah ihre hämisch grinsenden Gesichter vor sich. Wie sehr hatte er sich gedemütigt gefühlt.
»Ihr könntet den Teufel austreiben. Verfolgungen hat es doch bereits häufiger gegeben. Mit Sicherheit treiben die Hexen ihr Unwesen in Nassau.«
Der Priester beugte sich in seinem Lehnstuhl nach vorn. In seinem Gesicht spiegelten sich Eifer und Rachegelüste wider, er wollte nur zu gern seine Macht ausspielen. Allzu oft hatte er in den letzten Wochen die Häme des Volkes ertragen müssen. Nicht zum ersten Mal hatten sie seine Kirche verspottet.
»Gott wäre Euch mit Sicherheit sehr zugetan, wenn Ihr den Teufel bekämpfen würdet. Bestimmt würde er Euch seine Tore weit öffnen, einem Helden wie Euch, der todesmutig seinen Mann stehen würde gegen die Sünde und den Satan. Gewiss hättet Ihr Euch damit einen guten Platz gesichert auf dem Weg ins Paradies.«
Der Graf nippte nachdenklich an seinem Tee. Vielleicht hatte Pfarrer Wicht gar nicht so unrecht. Er könnte durchaus eine Verfolgung beginnen, in anderen Städten war so etwas üblich. Für Gott, seine Kirche und seinen Glauben könnte er es tun. Immerhin huldigte er Gott bereits mit der Renovierung der Kirche und sammelte Punkte auf seinem Konto in der Ewigkeit. Bestimmt würde er davon noch eine Menge mehr bekommen, wenn er den Teufel austrieb. Er war alt, krank und schwach, es konnte für ihn nur von Vorteil sein, sich mit dem Allmächtigen gut zu stellen.
»Ihr meint also, ich sollte eine Hexenverfolgung beginnen?«
»Wenn Ihr es so sagt – ja, das meine ich.«
»Aber ohne eine konkrete Anschuldigung sind mir die Hände gebunden.«
Da musste der Pfarrer dem Grafen leider recht geben. In der Karolina, dem Gesetz zur Hexenverfolgung, war alles genau vorgegeben. Niemand konnte einfach wahllos angeklagt werden. Erst wenn eine konkrete Anschuldigung vorlag, konnte die oder der Betroffene eingeholt und befragt werden.
»Dann müssen wir eben in der nächsten Zeit besonders wachsam sein. Ich bin mir ganz sicher, dass eine Hexe irgendwann einen Fehler macht.«
Pfarrer Wicht hatte sofort eine Frau vor Augen, waren sie es doch meist, die Unzucht trieben und die Männer zur Sünde verleiteten.
»Dann werde ich morgen mit dem Superintendenten sprechen«, antwortete der Graf eifrig. »Alles soll genau unter die Lupe genommen werden, jedem noch so kleinen Verdacht muss nachgegangen werden. Philipp Elbert ist mein zuverlässigster Mann, er wird alles sehr gewissenhaft in die Wege leiten.«
Der Pfarrer nickte bestätigend und griff nach einem großen Stück des Gebäcks. Erst jetzt bemerkte er, wie hungrig er war. »Bestimmt wird dann wieder Ruhe in Nassau einkehren. Ihr werdet sehen, Euer Gnaden, wenn die Hexen fort sind, wird die Sünde weichen, und der Respekt vor der Kirche und Gott wird zurückkehren.«
3
Das Klopfen an der Tür riss Katharina aus dem Schlaf. Leise schlich ihre Mutter ins Zimmer und stellte eine brennende Kerze auf den Nachttisch.
»Katharina«, flüsterte sie, »es ist Zeit zum Aufstehen, du kommst sonst zu spät.«
Stöhnend drehte sich Katharina auf die Seite, während ihre Mutter wieder den Raum verließ, um nach dem Haferbrei zu sehen, der bereits auf dem Ofen stand.
Katharina hätte die Kerze am liebsten wieder ausgeblasen. Gestern Abend war es spät geworden. Das Kleid für die Schulmeisterin hatte fertig werden müssen, die alte Dame wollte es heute abholen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, keine Vögel zwitscherten, im Zimmer war es kalt.
Sehnsüchtig dachte Katharina an ihre Kindheit zurück. Früher war sie nie so zeitig geweckt worden, selbst an Schultagen war es bereits hell gewesen, wenn sie aufgestanden war. Allerdings musste sie zugeben, dass sie mit der Schule wirklich Glück gehabt hatte, denn das kleine Gebäude lag nur eine Straße von ihrem Hof entfernt. Katharina konnte sich noch gut daran erinnern, wie sie früher mit dicken Strümpfen an den Füßen und einem wollenen Tuch über den Schultern gemütlich in der Wohnstube gesessen hatte und wie schön es gewesen war, ohne jede Verpflichtung einfach in den Tag hineinzuleben.
Sie setzte sich gähnend auf und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Das dunkelgrüne Leinenkleid, das sie heute anziehen wollte, hing, zusammen mit Hemd, Schürze und Strümpfen, ordentlich über ihrem Stuhl. Auf der Kommode, die ihrem Bett gegenüberstand, schimmerte das Porzellan der Waschschüssel im Kerzenlicht. Dienstags arbeitete sie im Gassenbacher Hof als Stallmagd. Katharina liebte die Arbeit im Stall. Dann war sie bei ihren geliebten Pferden, konnte sie striegeln, bürsten, streicheln und sich mit ihnen unterhalten.
Seufzend schlug sie die Decke zurück, zog sich ihr Nachthemd über den Kopf und huschte zur Waschschüssel. In dem kleinen Spiegel, der darüber hing, konnte sie kaum ihr Gesicht erkennen. Während sie sich wusch und ihren zerzausten Haaren mit einer Bürste zu Leibe rückte, machte sie sich mal wieder Gedanken darüber, wie es die Mutter schaffte, immer zur selben Zeit wach zu sein. Das war ihr ein Rätsel. Sie würde, besonders um diese Jahreszeit, jeden Tag verschlafen. Eilig zog sie sich das Hemd über den Kopf und schlüpfte in die langen, wollenen Strümpfe. In dem Moment, als sie die Schnüre ihres Kleides schloss, klopfte es erneut an die Tür.
»Herein!«
Vorsichtig blickte Cäcilie, die Magd des Hauses, ins Zimmer. »Guten Morgen, Katharina, die Herrin schickt mich. Sie wartet mit dem Haferbrei, Ihr sollt ihn noch warm essen.«
»Ja, ja, ich komme gleich.«
Jeden Morgen war es dasselbe, Katharinas Stimme klang leicht gereizt. Sie war noch nie im Bett liegen geblieben oder noch einmal eingeschlafen. Cäcilie verzog beleidigt das Gesicht und schloss ein wenig zu laut die Tür.
Jetzt hatte Katharina ein schlechtes Gewissen, sie wollte die Magd nicht kränken. Das schüchterne Mädchen, das aus Oberseelbach stammte, war sehr leicht zu erschrecken. Ihre ganze Familie war bei einem Brand ums Leben gekommen, und Cäcilie hatte als Einzige überlebt, weil sie beim Ausbruch des Feuers nicht zu Hause gewesen war. Eva hatte das Mädchen aus Mitleid aufgenommen. Wenn Cäcilie Katharina aus ihren großen, grünen Augen ansah, kam sie ihr wie ein schüchternes Reh vor. Cäcilie war keine besondere Schönheit. Sie hatte glanzloses, mittelblondes Haar, das sie mit einem Stück Stoff im Nacken zusammenband. Sie trug stets hellbeige, einfache Leinenkleider, mit einem Strick als Gürtel. Der helle Stoff ließ sie noch blasser und unscheinbarer wirken. Meistens saß sie still in einer Ecke oder half Michael, dem Stallknecht, bei seiner Arbeit. Ohne sie konnte es sich Katharina auf dem Hof nicht mehr vorstellen. Sie hatte sich an die angenehme und ruhige Art des Mädchens gewöhnt.
Leicht resigniert nahm Katharina ihre Haube von der Kommode und lief der jungen Magd hinterher. »Cäcilie, warte. Ich wollte das nicht.«
Sie holte sie im Treppenhaus ein.
»Es ist ja auch nicht deine Schuld.«
Die junge Magd lächelte.
»Ich weiß auch nicht, warum ich immer hinaufgehen soll. Jedes Mal, wenn ich ins Zimmer komme, seid Ihr schon fertig angekleidet, aber Eure Mutter würde mich ausschimpfen, wenn ich nicht gehorchte.«
Katharina lächelte. Cäcilie mochte schüchtern und sehr ruhig sein, aber dumm war sie nicht.
In der Wohnstube empfing die beiden wohlige Wärme. Im Ofen brannte ein knisterndes Feuer, und Kerzen erhellten den Raum. Ihr Licht zauberte überall bizarre Schatten an die Wände, die von dicken, schwarzen Balken durchzogen waren. Auf dem Tisch stand bereits der Topf mit dem dampfenden Haferbrei. Michael saß auf der Fensterbank und löffelte sein Frühstück in sich hinein, nickte den beiden Frauen kurz zu, sagte aber nichts. Morgens war er immer etwas mürrisch. Der Stallknecht war älter als Katharina und arbeitete schon seit einigen Jahren auf dem Hof. Seine braunen Haare waren mit der Zeit an der Stirn ein wenig dünner geworden. Ansonsten war er aber durchaus ein gut aussehender Mann. Wenn er nicht ein einfacher Stallknecht wäre, hätte er mit Sicherheit die Wahl zwischen vielen hübschen Frauen.
Die Mutter schüttete heißes Wasser in eine große Tonkanne, die nur bis zur Hälfte gefüllt werden konnte, da sie sonst zu schwer wurde. In der anderen Ecke des Raumes lagen Katharinas und Evas Nähsachen unordentlich auf dem kleinen Sofa, das neben dem Ofen stand. Das Kleid der Schulmeisterin war fast fertig, den Saum konnte die Mutter heute auch allein umnähen.
Katharina nahm sich von dem Haferbrei. Sie war auf einmal recht guter Dinge. »Heute läuft Maria ein Stück mit mir.« Verwundert sah Eva ihre Tochter an, während sie die Teekanne auf den Tisch stellte.
»Ja, warum das denn?«
»Sie muss für die kleine Anna Schuhe abholen.«
»Ach, wie schön.« Eva lächelte. »Dann bekommt das Mädchen also schon die ersten richtigen Schuhe, so schnell vergeht die Zeit.«
Katharina freute sich, dass Maria mitkam. Wenn sie sich mit der Freundin unterhalten konnte, kam ihr der Weg nicht so weit vor. Die beiden Frauen waren gemeinsam aufgewachsen. Maria war für Katharina die Schwester, die sie nie gehabt hatte. Sie beneidete die Freundin immer ein wenig um ihre Schönheit. Maria war mit gleichmäßigen Gesichtszügen und goldblondem Haar gesegnet, hatte große, blaue Augen und volle rote Lippen.
Sie war nur ein Jahr älter als Katharina, jedoch bereits Witwe und Mutter einer einjährigen Tochter. Als Maria kaum achtzehn Jahre alt gewesen war, hatte die alte Kathi, ihre Mutter, sie mit dem Schmied aus Wörsdorf verheiratet. Mit Grausen dachte Katharina an den fast fünfzigjährigen Mann zurück, der dem Alkohol mehr zugetan gewesen war als allem anderen und kaum noch Zähne im Mund gehabt hatte. Eva hatte damals mit Marias Mutter gesprochen, doch auch sie hatte ihre Freundin nicht umstimmen können. Maria war dem Mann bereits vor einigen Jahren versprochen worden, und Kathi war an ihr Versprechen gebunden.
Im Sommer war der Schmied dann am Fieber gestorben, und Maria war wieder zurück nach Niederseelbach gekommen und half nun der Mutter auf dem Hof und bei ihrer Tätigkeit als Hebamme.
Die alte Kathi Häuser, die auch »die Wiesin« genannt wurde, mochte eine sehr strenge Mutter sein, aber als Hebamme hatte sie einen guten Ruf. Wenn eine Frau in der Gegend von einem Kind entbunden wurde, war sie stets zugegen. Es gab kaum ein Kind in Niederseelbach und Idstein, das nicht von ihr auf die Welt geholt worden war. Fast immer begleitete Maria ihre Mutter, obwohl sie es eigentlich nicht ertragen konnte, das Leid der Frauen zu sehen. Zweimal war sie dabei gewesen, als Mutter und Kind im Kindbett gestorben waren. Tagelang war Maria danach völlig verstört herumgelaufen und hatte Katharina von den bittenden Augen der Frauen erzählt, von ihren Schreien, die immer leiser wurden und am Ende ganz verstummten.
Katharina erhob sich von der Bank und griff nach ihrem Umhang, der an einem Haken neben der Tür hing.
»Dann werde ich mal sehen, ob Maria schon wartet. Heute Abend bin ich dann ja wieder da.«
Eva erhob sich ebenfalls und umarmte ihre Tochter zum Abschied. »Sei vorsichtig und gib auf dem Weg gut acht, es ist noch dunkel, und es könnte glatt sein.«
Katharina lächelte und drückte ihrer Mutter liebevoll einen Kuss auf die Wange.