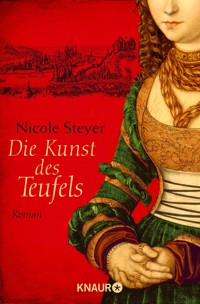
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Teufel hilf mir, Leib und Seel' geb' ich dir." Ein Spruch auf Zetteln, die im Jahre 1620 unter Landsknechten in der Nähe von Passau kursieren, verspricht Unverwundbarkeit für einen Tag. Stirbt man doch, so gehört die Seele dem Teufel. Auch Rupert, der Bruder der jungen Holzschnitzerin Teresa lässt sich auf den Handel ein und verliert Leben und Seele. Teresa bleibt in tiefer Trauer allein zurück. Ihr Weg führt sie nach Passau, wo sie sich in den Studenten Christian verliebt. Sie ahnt nichts von seiner dunklen Seite …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Nicole Steyer
Die Kunst des Teufels
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Teufel hilf mir, Leib und Seel geb’ ich dir.«
Dieser Spruch steht auf den Zetteln, die im Jahre 1620 in Passau unter Landsknechten kursieren und die Unverwundbarkeit für einen Tag versprechen. Verliert man doch sein Leben, so gehört die Seele dem Teufel. Auch Teresas Bruder Rupert lässt sich auf den Handel ein und verliert sein Leben und seine Seele. Teresa bleibt allein zurück. Ihr Weg führt sie nach Passau, wo sie sich in den Studenten Christian verliebt, nicht ahnend, dass er der Urheber der Teufels-Zettel ist.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Karte
Prolog
Auf dem »Goldenen Steig«
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Drei Flüsse, eine Stadt
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
»Maria Hilf«
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Geschichtlicher Hintergrund
Passauer Kunst
Goldener Steig
Wallfahrtskirche Maria Hilf
Berchtesgadener War
Passauer Wolfsklingen
Perlenfischerei in der Ilz
Noch ein paar Worte
Gewidmet meinem Großvater
Fred Pauli († 06.12.1980)
In meiner Erinnerung ist mir nur ein kleiner Augenblick mit Dir geblieben.
Doch in diesem Moment hast Du gelächelt.
»Teufel hilf mir,
Leib und Seel geb’ ich Dir.«
Prolog
Funkelnde Kristalle lösten sich von den mit Eis überzogenen Ästen, die über ihm in den flammend roten Abendhimmel ragten. Sie tanzten durch die glasklare Luft und schmolzen auf seiner Haut. Wald, Wiesen und Felder waren schneebedeckt. Eisige Stille hatte sich über das Schlachtfeld gelegt und die Geräusche des Todes mit kaltem Hauch betäubt.
Langsam versank die Sonne hinter den Hügeln, die Zweige verloren ihren glitzernden Zauber, und der Abendstern kündigte die Nacht an. Bald würde der ganze Himmel von hellen Lichtern erfüllt sein, dachte er wehmütig. Früher hatte er oft mit seinem Vater, dem nächtlichen Frost trotzend, vor dem Haus gesessen. Gemeinsam hatten sie den Nachthimmel betrachtet, in ihrer Phantasie Sternbilder erschaffen oder geschwiegen.
Auch jetzt fühlte er die Kälte nicht, obwohl sie ihm bereits vor Stunden in die Glieder gekrochen war. Sie dämpfte den Schmerz, der ihm den Atem geraubt hatte. Er wandte den Kopf zur Seite, sah den rot gefärbten Schnee, spürte die heißen Tränen auf seinen Wangen. Wie lange würde es dauern, bis das Grauen begann? Wie viel Zeit blieb noch, um die Prophezeiung aufzuhalten? Er wusste es nicht. Vor seinem inneren Auge sah er die schwarz gedruckte Schrift, die ihm Unverwundbarkeit versprochen hatte. Einen Pakt mit dem Teufel hatte er geschlossen – und verloren. Er zitterte vor Angst. Am liebsten hätte er sich zusammengerollt wie ein kleines Kind. Doch er hielt an dem Gedanken fest, dass er es schaffen könnte. Nur noch wenige Stunden musste er durchhalten, dann wäre seine Seele frei. Seine Augenlider wurden schwer. Seine Finger krallten sich in den Schnee. Er versuchte, den Kopf zu heben und sich aufzurichten, aber ihm fehlte die Kraft dazu. Es war vorbei, das spürte er. Gleich würde der Teufel kommen, seine Seele holen und ihn hinabreißen in die Hölle, weil er so dumm gewesen war und an eine Lüge geglaubt hatte. Seine Hände entspannten sich, und die Sterne verblassten vor seinen Augen, bis sie in vollkommener Dunkelheit verschwanden.
Auf dem »Goldenen Steig«
Kapitel 1
Teresa saß auf dem Wagen des Händlers Kaspar Eggli und reckte ihr Gesicht in die milde Oktobersonne. Sie mochte es, auf dem mit allerlei Tand beladenen Wagen mitzufahren. Eggli war ein kleiner, untersetzter Mann mit großen braunen Augen und Halbglatze, die er unter einer braunen Wollmütze versteckte. Mit der Haarfülle ist der Herrgott bei mir geizig gewesen, hatte er einmal augenzwinkernd zu Teresa gesagt, während sie ihm dabei geholfen hatte, seine Glaswaren, Unmengen von Tongeschirr, Honiggläser, Kerzen und viele bunte Perlenketten auf seinem Wagen zu verstauen. Seit dem Sommer war er Witwer, doch von seiner verstorbenen Frau, die Teresa nicht mehr kennengelernt hatte, sprach er nur selten. Eines Morgens hatte sie tot neben ihm im Bett gelegen. Er war fest davon überzeugt, dass die Hitze seine Frau umgebracht hatte, denn besonders im Sommer war sie oftmals schwach auf den Beinen gewesen. Still war sie gegangen, genau so, wie sie im Leben gewesen war. Eine zarte, kinderlos gebliebene Person. Teresa hatte aus seinen wenigen Worten die Traurigkeit herausgehört. Er musste seine Frau wirklich geliebt haben.
Neben Kaspars Wagen lief Teresas Bruder Rupert, mit ernster Miene, seine Kraxe voller Holzspielzeug auf dem Rücken. Sie wusste, dass er es nicht gern sah, wenn sie bei Kaspar Eggli mitfuhr. Nicht, weil er Kaspar Eggli nicht mochte, sondern weil es Gerede geben würde, denn es schickte sich nicht für ein junges Mädchen, auf dem Wagen eines alten Witwers mitzufahren. Einige der Händler wurden von ihren Frauen begleitet – geschwätzige alte Hennen –, die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hatten, als sich das Maul über andere zu zerreißen. Besonders die Frau des Lederers, Mechthild, war für ihr Schandmaul bekannt. Teresa war den Weibern von Anfang an ein Dorn im Auge. Wenn es nach den Frauen gegangen wäre, hätten sich der junge Bursche und das vorlaute Mädchen aus Berchtesgaden niemals der Gruppe anschließen dürfen. Kaspar winkte Rupert zu sich her.
»Wir erreichen bald die Herberge Vendelsberg. Dort werden wir eine längere Rast einlegen, denn die Pferde brauchen Ruhe. Hast du nicht gesagt, dass euch beiden das Geld ausgeht? Etwa eine Stunde Fußweg von hier entfernt liegt Waldkirchen, ein großer Ort, wo ein befreundeter Händler von mir ein Kontor leitet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er an deinem Spielzeug Gefallen findet.«
Rupert wollte etwas erwidern, doch Teresa war schneller.
»Das hört sich gut an. Bestimmt können wir dort einige Sachen verkaufen, nicht wahr, Rupert?«
Ruperts Miene verfinsterte sich, und Teresa zog den Kopf ein. Sie hatte ihm mal wieder vorgegriffen, und das mochte er gar nicht. Kaspar reagierte nicht auf Teresas Worte, was Rupert ein wenig besänftigte.
»Ist vielleicht keine schlechte Idee«, erwiderte Rupert. »Bevor wir den Nachmittag in der Herberge vertrödeln. Ein paar Kreuzer könnten wir gut gebrauchen.«
»Dann werde ich dir nachher erklären, wo du das Kontor in Waldkirchen findest«, antwortete Kaspar. »Wenn du dem Händler sagst, dass ich dich schicke, empfängt er dich bestimmt.«
Rupert nickte. Von vorn erklang der Ruf, dass die Herberge in Sicht kam.
Einige Zeit später stand Teresa vor einem der wenigen Stadttore Waldkirchens. Sie war umgeben von Säumern, Wein- und Tuchhändlern, armseligen Glasträgern, Landsknechten, einem Bauern mit einer Herde Ochsen und den berüchtigten ungarischen Sauschneidern, die erbärmlich stanken. Teresa wich vor einem der Männer zurück, reckte sich und suchte die Menge nach ihrem Bruder ab. Wie er es mit seiner Kraxe voller Holzspielzeug auf dem Rücken so schnell zwischen den vielen Leuten hindurch geschafft hatte, war ihr ein Rätsel. Natürlich hatte er es abgelehnt, sie nach Waldkirchen mitzunehmen, war sogar laut geworden, als sie nicht zu betteln aufgehört hatte. Trotzdem war sie ihm den ganzen Weg nachgelaufen, obwohl er sie mehrmals zum Umkehren aufgefordert hatte. Jetzt war er endgültig verschwunden, und Teresa war hoffnungslos in der bunten Menge steckengeblieben. Sie schob sich an der Herde Ochsen und einer Gruppe Frauen vorbei, die mit Äpfeln gefüllte Huckelkiepen auf dem Rücken trugen. So schnell würde er ihr nicht entkommen. Doch auf der anderen Seite des Stadttors geriet sie in eine Gruppe böhmischer Säumer, die sie aufhielten. Die Männer trugen die für Säumer typischen Gewänder, weiße oder rote Leinenhemden mit grünen oder blauen Filzüberwürfen darüber, einen Strick als Gürtel und braune Hosen aus Wildleder. Einer von ihnen hielt Teresa lachend am Arm fest.
»Seht nur, Männer, ein hübsches Küken habe ich gefunden, das ganz allein zu sein scheint.« Er grinste breit.
»Lass mich los«, schimpfte Teresa. Sie wollte sich losreißen, aber der Bursche hielt ihr Handgelenk fest. Er sprach mit böhmischem Akzent, sein Atem roch nach Pfeifentabak und Wein. Teresa spuckte ihm wütend ins Gesicht.
»Eher ein zickiges Hühnchen, Jiri«, sagte ein anderer, ebenfalls mit böhmischem Akzent, und zeigte beim Lachen seine fauligen Zähne.
»Lasst mich los. Rupert, so hör mich doch! Rupert!«, rief Teresa laut.
»Sie ruft nach ihrem Gatten«, sagte ein weiterer Bursche, der strohblondes Haar und helle blaue Augen hatte. Hätte er nicht so hämisch gegrinst, Teresa hätte ihn beinahe hübsch gefunden. Sein Gesichtsausdruck wurde gehässig, er machte einen Schritt auf sie zu.
»Ist dir dein Ehegatte abhandengekommen, mein Täubchen?« Er drehte sich zu seinen Kameraden um. »Was machen wir denn jetzt mit dem hübschen Mädchen? Allein können wir es schlecht zurücklassen. Oder was meint ihr?«
»Lasst sie gehen«, erklang plötzlich eine tiefe Stimme. »Am helllichten Tag ein Mädchen belästigen, euch werde ich Beine machen.«
Teresa wandte den Kopf. Ein Bär von einem Mann schob sich durch die Menge. Er hatte dunkles Haar, einen Vollbart, starke Oberarme und war braungebrannt. Die ersten Leute blieben neugierig stehen. Hilfesuchend schaute sich Teresa um, doch ihr Bruder war weit und breit nicht zu sehen. Der dunkelhaarige Mann trat näher an den Böhmen heran.
»Lasst das Mädchen los und verschwindet. Gesindel wie euch können wir hier nicht gebrauchen.«
»Gesindel nennst du uns«, antwortete der blonde Böhme und richtete sich zu voller Größe auf. »Uns, die tapferen Burschen, die das Weiße Gold nach Böhmen bringen.«
Der bärtige Mann machte einen Schritt auf den Blonden zu. »Tapfere Männer, dass ich nicht lache. Was hat euch das Mädel getan, dass ihr es so unflätig behandelt?«
Er griff nach Teresas Arm und wollte sie zu sich ziehen, aber der Säumer ließ sie nicht los. »Verschwinde. Es ist unsere Sache, mit welchen Weibern wir es haben.« Er spuckte vor dem Hünen auf den Boden.
»Du elender, respektloser Bursche, dir werde ich es zeigen.« Der Hüne machte einen schnellen Schritt auf den Säumer zu, umfasste mit seinen riesigen Pranken seinen Hals und begann ihn zu würgen. Überrascht ließ der Säumer Teresa los. Weitere Männer mischten sich ein.
Teresa wurde zur Seite geschubst und fiel zu Boden. Um sie herum sah sie nur noch Stiefel und Hosenbeine, lautes Gebrüll drang an ihr Ohr. Neben ihr zog ein Bursche seinen Dolch aus dem Gürtel. Erschrocken riss sie die Augen auf und versuchte, auf allen vieren der Menge zu entkommen. Einige Male trat irgendjemand gegen ihre Beine, ein harter Schlag traf sie am Kopf, ihre Haube ging verloren, und ihr Zopf löste sich. Da drang plötzlich die Stimme ihres Bruders an ihr Ohr, und sie spürte seine Hände, die sich um ihre Taille legten. »Komm schnell, lass uns verschwinden.«
Gemeinsam flohen sie vor dem Pöbel über den Marktplatz und suchten in einer engen Gasse Schutz.
Nach Luft japsend, ließ sich Teresa gegen eine Hauswand sinken. Nach einer Weile wischte sie sich die Tränen aus dem Gesicht und richtete ihr Haar. »Die Haube ist weg«, sagte sie, während sie ihren Zopf neu flocht.
Ihr Bruder stand neben ihr. Eine der Holzfiguren, ein kleines Pferdchen, war zu Boden gefallen. Teresa bückte sich und hob es auf.
»Wärst du nur bei den anderen geblieben, dann wäre das alles nicht passiert«, rügte Rupert sie.
»Um mich zu langweilen, während du dich über den Tisch ziehen lässt?« Teresas Ton klang vorwurfsvoll.
»Nein, damit du in Sicherheit bist. Du siehst doch, was passiert ist.«
»Wärst du bei mir geblieben, hätten mich die Männer erst gar nicht angefasst«, antwortete Teresa schnippisch und verschränkte die Arme vor der Brust. Rupert seufzte. Sie hatte recht. Er hätte besser auf sie achtgeben müssen. Er war seit dem Tod ihrer Eltern das Familienoberhaupt, derjenige, der den Ton angab. Jedenfalls sollte das so sein, aber die Wirklichkeit sah anders aus. Teresa hatte wie schon so oft ihren Willen durchgesetzt.
»Nimmst du mich jetzt mit?«, fragte sie.
»Ich kann ja doch nicht verhindern, dass du mir nachläufst«, antwortete er resigniert. Wieder einmal hatte sie gewonnen. »Aber ich rede, und du hältst dich zurück.« Er hob mahnend den Zeigefinger.
Über Teresas Lippen huschte ein Lächeln. »Versprochen, ich werde ganz still sein. Eine Unterstützung im Hintergrund, mehr nicht.« Sie hängte sich bei ihm ein, und die beiden verließen die Gasse. Auf dem Marktplatz wurden sie von der warmen Oktobersonne empfangen. Der Tumult am Stadttor hatte sich aufgelöst. Die böhmischen Säumer waren genauso verschwunden wie der dunkelhaarige Hüne. Teresas Stimmung besserte sich. Sie summte eine Melodie und atmete tief den Duft von frisch gebackenem Brot ein, während sie an Marktständen und dem Stadtbrunnen vorbeiliefen. Rupert schaute sorgenvoll nach vorn, wo das Haus des Händlers auftauchte, dem er ihre Ware anbieten wollte. Hoffentlich würde alles gutgehen.
Wenig später betraten die beiden Geschwister den weitläufigen, vierkantigen Innenhof, der komplett von Gebäuden umschlossen war. Während Rupert einer Magd ihr Anliegen erklärte, schaute sich Teresa um. Kunstvolle Malereien, die Säumer mit ihren Pferden und Schiffen auf dem Fluss zeigten, zierten die Wände des Anwesens. Ein Holzbalkon umrahmte den Hof, auf dem eine Magd Wäsche aufhängte. Sie musterte die beiden Neuankömmlinge genauso neugierig wie der schmächtige rothaarige Bursche, der auf zwei große Brauereipferde achtgab, die, vor einen Wagen gespannt, unruhig mit den Hufen scharrten. Vor einer offenen Tür saßen zwei Mägde, Hühner rupfend und schwatzend, in der Sonne. Als Teresa und ihr Bruder an ihnen vorübergingen, verstummten sie. Teresa konnte ihre abfälligen Blicke im Rücken spüren, doch sie wandte sich nicht um. Sie wusste genau, was die beiden Mägde dachten, genauso wie Rupert, der ihr einen warnenden Blick zuwarf. Niemals würde sie sich damit abfinden können, dass Geschäfte Männersache waren. Immerhin hatte sie die Ware hergestellt, die heute verkauft werden sollte. Stunde um Stunde hatte sie in der Werkstatt des Vaters zugebracht, um die vielen Holzpferdchen, Kutschen und Soldaten zu schnitzen. Noch einmal so viel Zeit hatte sie für das Bemalen gebraucht, da sie dabei nicht ganz so geschickt war. Der Vater hatte es besser gekonnt, sowohl das Schnitzen wie auch das Bemalen der Figuren. Schon als kleines Mädchen hatte sie ihn – im Gegensatz zu Rupert, der noch nie Interesse an Holzarbeiten gehabt hatte – gern bei der Arbeit beobachtet. Die Liebe zum Schnitzen hat Rupert nicht geerbt, hatte der Vater einmal zu ihr gesagt, die muss im Herzen sein. Teresa wusste, was er gemeint hatte. Wenn sie ein Schnitzmesser in der Hand hatte, dann gab es nur noch die Figur, die sie erschaffen wollte.
Ihr Vater hatte ihr nie das Gefühl gegeben, als Mädchen wertlos zu sein. Doch ihr Bruder tat es. Am liebsten wäre sie jetzt nach Hause gelaufen, um sich weinend in die Arme des Vaters zu werfen. Doch er würde sie niemals wieder umarmen und schweigend über ihr Haar streichen, wie er es so oft getan hatte. Sie würde ihn nicht mehr in seiner Werkstatt sitzen sehen, das Schnitzeisen in der Hand, von Holzspänen umgeben. Der letzte Winter mit seiner schrecklichen Kälte, die sich in seiner Lunge festgesetzt hatte, hatte ihn geholt. Qualvoll war es mit ihm zu Ende gegangen. Sie hatten ihn neben der Mutter und den beiden Geschwistern, die der Herrgott viel zu früh zu sich genommen hatte, beerdigt.
Der Händler öffnete die Tür zu einem Lagerhaus. Mit allerlei Waren vollgestopfte Regale säumten die Wände: Geschirr, Keramik, Holzwaren, feinste Spitze, Glaskaraffen und Gläser, die in den nahen Glashütten gefertigt wurden. Stoffballen lagen in einer Ecke neben aufgestapelten Weinfässern und Salzkufen, wie die Holzgefäße für den Transport des Weißen Goldes genannt wurden.
Rupert stellte seine Kraxe auf dem breiten Tisch ab, der die Mitte des Raumes ausfüllte. Der Händler befingerte neugierig die bunten Figuren, die daran hingen. Er war ein dicklicher Mann mit schütterem Haar und kleinen Augen, die unter Schlupflidern verschwanden. An seiner Kleidung war sein Wohlstand zu erkennen. Ein samtenes Wams mit goldenen Knöpfen umspannte seinen runden Leib, seine Stiefel waren aus feinstem Leder.
Rupert legte einige der Spielzeuge auf den Tisch. Teresa bemerkte, dass seine Hände leicht zitterten und Schweißperlen auf seiner Stirn standen. Wieder war er aufgeregt, was er nicht sein durfte. Händler waren wie Tiere, die die Angst rochen. Auch dieser hier beobachtete sein Gegenüber genau, hob die kleinen Holzspielzeuge in die Höhe und betrachtete sie von allen Seiten. Am liebsten hätte Teresa ihn angeschrien, ihr Spielzeug mit mehr Respekt zu behandeln, denn ihre Seele hing an jedem Stück, doch sie hielt sich wie versprochen zurück. Schweigend hörte sie den ersten Preisvorschlag, der viel zu niedrig war. Ihr Bruder zögerte. Der Händler schaute ihn abwartend an. In ihr brodelte es. Rupert würde womöglich darauf eingehen. Energisch schob sie ihn zur Seite.
»Es ist zu wenig«, sagte Teresa herausfordernd. Irritiert blickte der Händler von ihr zu Rupert, der den Kopf einzog, da er schon wusste, was kommen würde. Und Teresa wusste es auch. Wieder einmal hatte sie sich nicht beherrschen können, was nicht zum ersten Mal für einen Rauswurf sorgen würde. Doch der Händler reagierte anders. Abschätzend schaute er Teresa an. So ein eigenwilliges Mädchen war ihm noch nie begegnet. Sie wirkte stolz, mit ihrem vorgereckten Kinn und dem Ausdruck von Eigensinn in den Augen. Sein Blick fiel auf ihre Hände, die von Schrammen übersät waren. Er verstand: Das Mädchen hatte die Spielzeuge geschnitzt. Sein Blick wanderte von ihr zu Rupert. Ein schmächtiger braunhaariger Bursche mit unstetem Blick, Schweiß auf der Stirn und feingliedrigen Händen, ohne Schrammen. Teresa glaubte, die Gedanken des Händlers zu erraten. Langsam schob sie eines der Pferde nach vorn.
»Man kann auf ihnen pfeifen.«
Der Händler griff danach und setzte es an die Lippen. Ein schriller Pfiff erklang. Überrascht schaute er das Kunstwerk an, dann musterte er Teresa erneut. Wie alt mochte das selbstbewusste und durchaus talentierte Mädchen sein, vielleicht sechzehn oder siebzehn? Er legte die Pfeife zurück und beugte sich zu ihr vor.
»Ihr habt recht, meine Schöne. Es ist zu wenig dafür, dass so zarte Hände leiden mussten.«
Seine Stimme wurde schmeichelnd. Er griff nach ihrer Hand und begann, sie zu streicheln. Sein Blick wanderte zu ihren Brüsten. Abrupt zog sie ihre Hand weg. Er zuckte zurück, räusperte sich und sagte: »Ich lege noch zwanzig Kreuzer drauf. Mein letztes Wort.«
Zum ersten Mal reagierte ein Händler anders auf Teresas Einmischung, was sie verwirrte. Beschämt senkte sie den Blick, während ihr Bruder nach vorn trat und sie behutsam zur Seite schob. Der Mann legte die Münzen auf den Tisch, und Rupert steckte sie in seinen Beutel. Die kleinen Holzpferdchen, Kutschen und Soldaten hatten ihren Besitzer gewechselt. Wie aus dem Nichts trat ein unscheinbares Mädchen, nicht älter als vierzehn Jahre, näher. Den Kopf gesenkt, verstaute sie die neue Ware in einem Weidenkorb und verschwand zwischen den Regalreihen, während Rupert seine Kraxe wieder aufsetzte.
Auf dem Hof legte ihm der Händler kameradschaftlich den Arm über die Schultern.
»Wollt ihr nicht heute Nacht hierbleiben? Wir haben ein Gästezimmer und guten Wein. Dann könnt ihr von der Lage auf dem Steig berichten.« Der Händler schaute zu Teresa, die errötete und den Blick abwandte. Rupert bemerkte die Unruhe seiner Schwester. Sie mochte ihn für einen unnützen Taugenichts halten, aber er wusste sehr wohl, was die plötzliche Großzügigkeit des Händlers ausgelöst hatte.
»Euer Angebot ist verlockend«, antwortete er freundlich, »aber wir müssen heute noch weiter. Wir reisen in einer Gruppe, die uns Schutz bietet, Ihr versteht.«
Noch einmal wanderte der Blick des Händlers zu Teresa, die näher zu ihrem Bruder ging.
»Ich verstehe«, antwortete er zögernd. Rupert trat auf die Straße, und Teresa folgte ihm erleichtert. Sie wollte nur noch fort von dem Anwesen, das sie noch vor kurzem beeindruckt hatte. Der Händler blieb im Eingang stehen.
»Dann wünsche ich sicheres Weiterkommen. Gott zum Gruß.« Während Rupert den Abschiedsgruß erwiderte, beobachtete Teresa schaudernd eine schwarze Katze, die dem Händler in den Innenhof folgte. Erleichtert atmete sie auf, als sich das Hoftor hinter ihm schloss.
»Sehen wir zu, dass wir weiterkommen. Die anderen warten bestimmt schon auf uns«, sagte Rupert. Teresa folgte ihm schweigend über den Marktplatz. Die letzten Strahlen der Oktobersonne fielen auf die Dächer der Häuser, und ein Mückenschwarm tanzte in der milden, von Laubgeruch erfüllten Luft. Bald würde es dunkel werden.
In einigen Wochen wollten sie Nürnberg erreicht haben, wo ihr Oheim lebte, der für Teresa ein Unbekannter war. Selbst Rupert kannte ihn kaum. Nur ein Mal war der Händler aus Nürnberg in Berchtesgaden gewesen. Trotzdem hatte er den beiden eine Zukunft in seinem Kontor zugesagt.
Teresa kämpfte mit ihrem schlechten Gewissen. Wieder einmal war sie vorlaut und ungerecht zu Rupert gewesen.
»Es tut mir leid.« Sie setzte eine betretene Miene auf.
Rupert blieb stehen und atmete tief durch. Wie gut er ihr aufbrausendes Wesen und ihre Ungeduld kannte. Allerdings verstand er sie auch, denn es war ihre Arbeit, die nur deshalb nicht angemessen anerkannt wurde, weil Teresa eine Frau war. Sie hatte die letzten Monate all die Spielzeuge geschnitzt, die er auf dem Rücken trug. Ihre Hände waren voller Schrammen und Schnitte, nicht die seinen. Er wünschte sich, der starke Bruder zu sein, der für sie sorgte, aber er war es nicht.
Er legte den Kopf schräg. Plötzlich umspielte ein spitzbübisches Grinsen seine Lippen. »Er hätte dich am liebsten hinter die Fässer gezerrt.«
Teresa errötete bis unter die Haarwurzeln. Sie schlug nach ihm, doch er wich ihr aus. Kichernd wie kleine Kinder liefen sie die Gasse hinunter, schlüpften durch eines der Stadttore und schlugen den Rückweg zum Vendelsberg ein.
Am Abend saß Teresa an einem Tisch in der hinteren Ecke der Gaststube und ließ ihren Blick durch den gut besuchten Raum schweifen, in dem die Gerüche von Pfeifentabak, gebratenem Fleisch und Schweiß die Luft schwängerten. Eine große Gruppe Tuch- und Weinhändler aus Tirol, die am späten Nachmittag eingetroffen war, saß, verteilt über einige Tische, im Raum und sang Lieder, einer von ihnen fiedelte sogar auf einer Geige. Fröhlich klatschten auch die anderen Gäste der Herberge, hauptsächlich Säumer und Händler, den Takt mit oder tanzten, ein Mädchen im Arm, durch den Raum. Ihr Bruder saß neben ihr, ihm gegenüber ein Landsknecht, den Teresa auf den ersten Blick abstoßend fand, obwohl er durchaus gutaussehend war, wenn man die breite Narbe nicht beachtete, die seine rechte Wange zierte. Sein blondes Haar hatte er zurückgebunden, und seine blauen Augen leuchteten im Licht der Kerzen. Immer wieder zwinkerte er Teresa zu, während er von der Zeit berichtete, als er noch Teil des Passauer Kriegsvolks gewesen war, das vor gut zehn Jahren in der Nähe von Passau gelagert hatte. Ruhmreich waren sie für Kaiser Rudolf den II. nach Böhmen gezogen, um es zu erobern. »Das waren noch Zeiten, damals, im Jahre des Herrn 1610. Was da heute gen Böhmen zieht, das kann uns längst nicht das Wasser reichen.«
Rupert hing an seinen Lippen, doch ein an ihrem Tisch sitzender Händler ließ sich von der Prahlerei des Landsknechts nicht beeindrucken. »Ruhmreich, dass ich nicht lache. Den guten Passauer Namen habt ihr in Verruf gebracht mit euren Überfällen und Plünderungen. Unser Vieh und unsere Leinwand habt ihr gestohlen und die Kornfelder zerstört. Nur Not und Elend habt ihr über Passau gebracht, um dann wie ein Heuschreckenschwarm Oberösterreich zu plündern. Immerhin wurde euer Anführer Laurentius Ramee für die vielen Grausamkeiten zur Rechenschaft gezogen und hingerichtet. Ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ihr mich fragt.«
Der Landsknecht verzog nur kurz das Gesicht. »Jeder, wie er meint«, antwortete er gelassen und zwinkerte Teresa erneut zu. »Wir haben unsere Arbeit getan, nicht mehr und nicht weniger.«
Der Händler erhob sich kopfschüttelnd. »Wenn Ihr Raubzüge und Plünderungen als Euren ehrenwerten Dienst anseht, dann ist es besser, wenn ich jetzt gehe.« Er verschwand zwischen den Tanzpaaren.
Rupert wollte ebenfalls aufstehen, doch der Landsknecht hielt ihn am Arm zurück. »Er mag recht haben. Einige Dinge sind damals tatsächlich nicht wie geplant gelaufen. Aber jetzt sind die Zeiten noch unsicherer. Böhmen ist ein Pulverfass, das jeden Moment hochgehen wird. Und vergesst nicht die Belagerung der nicht fernen Wallerer Schanze, erst vor wenigen Monaten.«
»Wie meint Ihr das?«, fragte Rupert.
»Truppen bringen das Übel mit sich, welches Heer es auch immer sein mag. Tilly lagert nicht weit von hier. Ihr solltet Euch in Acht nehmen, damit Euch und Eurer hübschen Begleitung« – er schaute zu Teresa – »kein Unheil geschieht.«
Rupert legte beschützend den Arm um seine Schwester. Der Name »Tilly« hatte sie erzittern lassen, denn es war der Name des Feldherrn, der die Katholische Liga anführte und über den in der letzten Zeit öfter gesprochen worden war. Flugblätter, in denen von einer großen Schlacht in Böhmen die Rede war, hatten ihre kleine Gruppe erreicht. Tilly sollte mit seinem Heer dorthin unterwegs sein, um den Aufstand der protestantischen Böhmen endgültig niederzuschlagen.
Der Landsknecht beugte sich über den Tisch. »Räuberbanden und Marodeure ziehen die Heere an, die besonders gern Händlergruppen plündern.«
Rupert wurde blass, und Teresas Herz begann, schneller zu schlagen. Bisher hatten sie sich in ihrer Reisegruppe immer sicher gefühlt. Erst jetzt wurde sich Teresa klar darüber, dass nur wenige der Männer bewaffnet waren.
Der Landsknecht schien ihre Gedanken zu erraten. »Ihr solltet Euch besser schützen.«
»Ich trage einen Dolch bei mir, genauso wie die anderen Händler. Doch Kämpfer sind wir alle nicht«, erklärte Rupert unsicher.
Der Landsknecht erwiderte verständnisvoll: »Das dachte ich mir. Manche Gruppen haben Geleitschutz, aber der muss bezahlt werden.« Er rückte noch näher an Rupert heran und senkte seine Stimme. »Aber vielleicht kann ich Euch ja weiterhelfen.«
»Wenn Ihr uns Geleitschutz anbieten wollt, dann kann ich das nicht allein entscheiden.« Rupert deutete zum gegenüberliegenden Tisch hinüber, wo sich die anderen Händler bei einem Würfelspiel vergnügten.
»Nein, Geleitschutz kann ich Euch keinen anbieten, da auch mein Weg nach Böhmen führt. Aber warum nicht auf einen Schutzzauber vertrauen.«
Er zog ein kleines Bündel Zettel aus seiner Tasche und faltete einen von ihnen auseinander. Da Teresa kaum lesen konnte, hatte sie Mühe, die Buchstaben zu entziffern, die in schwarzer Schrift auf das zerknitterte Papier gedruckt waren. Doch ihr Gefühl sagte ihr, dass diesem Zettelzauber nicht zu trauen war. Sie stupste Rupert in die Seite, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber er reagierte nicht. Wie hypnotisiert las er den Text auf dem Papier.
»Ich überlasse Euch den Zettel für sechs Kreuzer. Für vier weitere erhaltet Ihr noch einen zweiten für Eure bezaubernde Begleitung. So manch tapferem Burschen hat der Zauber das Leben gerettet, das kann ich Euch sagen.«
Teresa bemühte sich, die Buchstaben zusammenzufügen, schaffte es aber nur bei einem Wort. »Teufel«, sagte sie laut und riss erschrocken die Augen auf. Rupert zuckte zusammen. Teresa schaute den Händler vorwurfsvoll an und begann, laut zu schimpfen: »Einen schönen Schutzzauber wollt Ihr uns da verkaufen, der mit dem Teufel zu tun hat.« Ihre Stimme ging jedoch im plötzlich aufwallenden Gegröle der anderen Gäste unter. Die Musik war verstummt, und die Tiroler Weinhändler begannen eine handfeste Prügelei mit einer Gruppe Ochsenhändlern, in die sich schnell Säumer, Tuchhändler und Glasträger einmischten. Stühle und Tische wurden umgerissen, Gläser und Flaschen zerschlagen. Die Frauen kreischten, während die Männer mit den Fäusten aufeinander losgingen. Teresa und Rupert sprangen auf und eilten, wie viele andere Gäste auch, zum Ausgang, vor dem ein Tiroler Weinhändler gerade einem am Boden liegenden Glasträger mit einem Schlag ins Gesicht die Nase brach. Ein weiterer Glasträger eilte seinem Freund zu Hilfe und zog dem Weinhändler ein Stuhlbein über den Kopf, was dem grobschlächtigen Kerl wenig auszumachen schien. Er drehte sich um, als wäre nichts gewesen, packte den schmächtigen Glasträger am Kragen, hob ihn wie eine Marionette vom Boden hoch und schleuderte ihn an die gegenüberliegende Wand. Teresa ließ im Gedränge die Hand ihres Bruders los. Sie sah nur noch fliegende Fäuste und verzerrte Gesichter. Rupert war verschwunden. Eine dickliche Frau, die direkt hinter ihr stand, schob sie mit aller Macht in den Flur, wo ein kleiner Bursche mit dem Diebstahl von Feuerholz beschäftigt war, während neben ihm ein aus einer Kopfwunde blutender Landsknecht an einem Becher Wein nippte. Teresa beeilte sich, auf den Hof hinauszukommen. Dort stützte sie sich, nach Luft japsend, an der Hauswand ab.
»Grundgütiger«, sagte sie zu der dicklichen Frau, die sich mit puterrotem Gesicht auf eine Bank vor dem Haus setzte. Sie begutachtete einen Riss in ihrem Kleid und antwortete:
»Das ist jetzt schon die dritte Schlägerei, die ich erlebe. Als hätten wir nicht andere Sorgen, als uns jeden Abend im Rausch die Schädel einzuschlagen.«
Immer mehr Menschen kamen nach draußen. Manche von ihnen taumelten, andere wurden getragen, einer wurde sogar durch die Tür geworfen. Hoffnungsvoll hielt Teresa nach Rupert Ausschau. Doch er tauchte nicht auf, was ihr Sorgen bereitete. Die dickliche Frau bemerkte ihre Unruhe. Aufmunternd tätschelte sie ihr den Arm. »Sind alle irgendwann rausgekommen.«
Keine Minute später torkelte ein Mann mittleren Alters an den beiden vorüber, und die Frau verabschiedete sich augenzwinkernd von Teresa.
»Was treibst du dich hier draußen herum?«, sprach plötzlich jemand von hinten Teresa an.
Teresa drehte sich erschrocken um. Mechthild, die Frau des Lederers Beppo, der mit ihnen zog, stand vor ihr.
»Wir Frauen sind alle in der Kammer, wie es sich gehört. Wenn du so weitermachst, wirst du noch als Hure enden.« Teresa verdrehte die Augen. Sie wusste, dass es sicherer war, in einer Gruppe zu reisen, doch besonders Mechthild brachte sie mit ihren ständigen Ermahnungen zur Weißglut.
Eine Gruppe junger Burschen rannte an ihnen vorbei. Einer strauchelte, verlor das Gleichgewicht und riss Mechthild zu Boden. Der Bursche rappelte sich erstaunlich schnell wieder auf und verschwand ohne ein Wort der Entschuldigung, während Mechthild mit schmerzverzerrter Miene sitzen blieb.
»Ich glaube, der Arm ist gebrochen«, jammerte sie.
Teresa konnte sich eine schadenfrohe Bemerkung nicht verkneifen, während sie Mechthild die Hand hinhielt, um ihr aufhelfen. »Hättest wohl besser in der Kammer bleiben sollen.«
Die Alte schlug Teresas Hand weg und erwiderte ruppig: »Ich komme schon zurecht.«
»So siehst du auch aus«, antwortete Rupert für Teresa. Wie aus dem Nichts stand er plötzlich hinter Mechthild und zog sie auf die Beine. Noch immer hielt sich die Alte den Arm, ihre Augen funkelten wütend.
»Fass mich nicht an, du Anhängsel dieser dahergelaufenen Hure«, giftete sie.
Teresa wich erschrocken zurück. Doch Rupert ließ sich von dem Gerede nicht einschüchtern. Schon lange war er wütend darüber, wie die Weiber der Händler seine Schwester behandelten. Jetzt platzte ihm endgültig der Kragen. »Halt endlich dein Schandmaul, Mechthild. Wenn du noch einmal meine Schwester als Dirne beschimpfst, dann breche ich dir auch noch den anderen Arm. Hast du mich verstanden?«
Mechthild zog den Kopf ein. Mit so einer forschen Antwort hatte sie nicht gerechnet.
»Danke fürs Aufhelfen«, murmelte sie eingeschüchtert, dann ging sie davon.
Verblüfft schaute Teresa ihr nach. »Anscheinend hast du den richtigen Ton getroffen.«
Rupert grinste. »Anders kennt sie es von Beppo doch auch nicht. Den ganzen Tag schreit er sie an.«
Teresa nickte, dann musterte sie ihren Bruder genauer. Er schien keine Blessuren davongetragen zu haben. Plötzlich bemerkte sie den Zettel in seiner Hand.
»Was hast du da?«, fragte sie, bereits ahnend, was es war.
Schnell versteckte Rupert den Zettel hinter seinem Rücken. »Ach, nichts weiter«, antwortete er ausweichend.
Teresa machte einen Schritt auf ihn zu. »Du hast doch nicht etwa einen dieser Zettel gekauft?«
Rupert wich ihrem Blick aus. Ihre Hände begannen zu zittern. »Dem Burschen kann man nicht trauen. Wir hätten es dem Händler gleichtun und weggehen sollen.«
»Du verstehst das nicht«, erwiderte Rupert. »Er hat recht mit dem, was er sagt. Die Katholische Liga ist auf dem Weg nach Böhmen, überall sind Räuberbanden, Marodeure und Diebe unterwegs. Es herrscht Krieg, und wir sind mittendrin. Dieser Zettel wird mir dabei helfen, uns zu beschützen – dich zu beschützen.«
In seine Augen traten Tränen, seine Stimme bebte. Teresa schaute ihren Bruder fassungslos an. So kannte sie ihn gar nicht.
»Dieser Zettel sichert unser Leben, auch wenn das bedeutet, dass ich für kurze Zeit einen Pakt mit dem Teufel schließen muss.« Er hielt das Stück Papier in die Höhe. »Einen ganzen Tag lang wird er mich vor Hieb und Stich schützen.«
Teresa konnte nicht glauben, was sie da hörte. »Gott wird uns beschützen, nicht irgendein falscher Zauber«, sagte sie mit Nachdruck. »Der Teufel verteilt keine Geschenke ohne Gegenleistung, das müsstest du doch wissen.«
Rupert ließ die Hand sinken. »Diese Gegenleistung wird er nicht bekommen«, erwiderte er.
Teresa machte einen Schritt auf Rupert zu. »Was möchte er denn haben?«
»Sollte ich doch an diesem Tag sterben, so gehört ihm meine Seele«, antwortete er und fügte eifrig hinzu: »Was aber nicht passieren wird, denn der Zauber schützt mich.«
Er umfasste Teresas Schultern und schaute ihr eindringlich in die Augen. »Ich bin nur ein einfacher Bauer und Spielzeughändler, kein Krieger und Held. Mit der Hilfe dieses Zettels werden wir sicher in Nürnberg ankommen. Das verspreche ich dir.« Teresa wollte etwas erwidern, doch er hob die Hand. »Der Zauber wird uns schützen. Das ist mein letztes Wort.« Er ließ sie los und ging über den Hof davon. Teresa schaute ihm nach und murmelte leise: »Ein Zauber, den der Teufel selbst erfunden hat.«
Kapitel 2
Am nächsten Morgen, das graue Licht des Tages kroch bereits in den Raum, lag Teresa neben ihrem Bruder, lauschte seinen Atemzügen und spürte seine Wärme. Erschöpft von den Ereignissen des Abends, waren sie aufs Lager gesunken, ohne den Zettel noch einmal zu erwähnen. Doch heute würde sie Rupert darauf ansprechen, denn einen Pakt mit dem Teufel sollte niemand schließen. Sie musterte ihn von der Seite. Bartstoppel zierten sein Kinn, sein braunes Haar hing ihm wirr in die Stirn. Sie lächelte. Wie sehr sie diese stillen Momente der Nähe genoss. Dann fühlte es sich ein wenig so an, als wären sie noch in Berchtesgaden unter dem Dach des alten Bauernhauses, auf ihrem Strohlager, das sie sich als Kinder geteilt hatten. Besonders im Winter hatten sie eng aneinandergekuschelt der Kälte getrotzt und aus der fensterlosen Dachluke auf die im Mondlicht schimmernden Berggipfel geblickt.
Auch jetzt war die kalte Jahreszeit nicht mehr fern. Der Geruch der kühlen Herbstnächte erinnerte Teresa an ihren Vater. Wenn es nach feuchten Blättern, nach Erde und Moos geduftet hatte und die Arbeit auf den Feldern getan war, dann war er in seine Werkstatt gegangen und hatte zu schnitzen begonnen. Auch im letzten Jahr war das so gewesen, dachte Teresa wehmütig. Das Laub hatte sich golden verfärbt, war zu Boden gefallen und vom Schnee zugedeckt worden.
Ihr Leben hatte sich durch den Tod des Vaters verändert. Wie sehr sie ihn vermisste. Er hatte sie oft auf seine Wanderungen mitgenommen, hatte ihr Geschichten von steinernen Riesen, Wichteln und Berghexen erzählt. Als Kind hatte sie sich vor ihnen gefürchtet, doch nach und nach waren die Märchen und Sagen ein Teil von ihr geworden, genauso wie der vertraute Anblick des Watzmanns mit seinem eindrucksvollen Gipfel, der jetzt weit weg war.
Teresa setzte sich leise auf. Ihr Bruder drehte sich grummelnd zur Seite. Liebevoll legte sie ihm die Decke über die Schultern, erhob sich und verließ den Stall. Draußen empfing sie ein nebliger Herbstmorgen. An die Stallungen grenzte eine kleine Weide, auf der Pferde grasten. Teresas Blick fiel auf einen Holzstoß, der neben der Eingangstür aufgestapelt und ihr am gestrigen Abend gar nicht aufgefallen war. Sie ging darauf zu und prüfte mit fachmännischem Blick die einzelnen Scheite. Nach einer Weile nahm sie ein etwas kleineres Stück Holz in die Hand und begutachtete es von allen Seiten. Es war Lindenholz, das sich besonders gut zum Schnitzen eignete. Sie blickte zur verschlossenen Eingangstür des Gasthofes. Das Holzstück war sehr klein, kaum der Rede wert. Sicher würde niemandem auffallen, dass sie es genommen hatte. Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Bewegung auf dem Hof wahr und drehte sich erschrocken um. Erleichtert atmete sie auf, als sie ein Tier wahrnahm. Eine kleine Katze, dachte Teresa im ersten Moment, doch als das Tierchen näher kam, war es besser zu erkennen. Ein Eichhörnchen mit braunen Knopfaugen schaute Teresa an, bevor es über den Holzstoß und aufs Hausdach kletterte und von dort aus auf die Äste des dahinterstehenden Kastanienbaums sprang. Fasziniert schaute Teresa dem Tier zu, dann blickte sie auf das Holzstück in ihrer Hand. Ein Eichhörnchen hatte sie noch nie geschnitzt. Sie ging über den Innenhof, setzte sich vor dem Schuppen auf eine Bank und zog ihren Umhang enger um sich. Die letzten Tage hatten stets klar und mit goldenem Licht begonnen, doch heute wirkten die mit Rauhreif bedeckten Wiesen wie eine bittere Vorankündigung des nahenden Winters. Sie griff in ihre Rocktasche, holte ihr Schnitzmesser hervor und begann, die Rinde des Holzes zu entfernen. In solchen Momenten kam es ihr oft so vor, als würde sie die Stimme ihres Vaters hören, seinen Geruch, seine Nähe wahrnehmen und seine Hand auf der ihren spüren, die sie leitete.
Langsam erwachte das Gasthaus hinter ihr zum Leben. Ein Hahn krähte, Rauch stieg aus dem Kamin auf, und irgendwo weinte ein Kind.
»Heute wird die Sonne noch durchbrechen«, sagte plötzlich jemand. Erschrocken sprang Teresa auf, das Stück Lindenholz und ihr Schnitzmesser fielen zu Boden.
Eine Frau, die einen kleinen Esel am Zügel führte, stand vor ihr. Sie war schmächtig, trug einen von Flicken übersäten, schwarzen Mantel und einen dunkelbraunen Leinenrock. Graue Strähnen durchzogen ihr geflochtenes braunes Haar. Ein breiter Filzhut war ihr in den Nacken gerutscht.
Sie bückte sich, hob das Stück Holz und das Schnitzmesser auf und hielt es Teresa hin.
»Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken.« Ein herzliches Lächeln umspielte ihre Lippen. Teresa entspannte sich und steckte ihr Schnitzmesser in die Rocktasche.
»Einem schnitzenden Mädchen begegnet man nicht alle Tage«, sagt die Frau anerkennend. »Normalerweise ist das doch Männersache.«
»Mein Vater hat mir das Schnitzen beigebracht«, antwortete Teresa.
»Er fehlt dir, nicht wahr?«
»Woher wisst Ihr das?«, fragte Teresa verdutzt.
»Sagen wir: Ich habe eine gute Beobachtungsgabe. Der Schmerz über seinen Verlust steht in deinen Augen. Es ist nie leicht, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber irgendwann wird der Kummer erträglich, das verspreche ich dir.«
Teresa wollte etwas erwidern, doch sie wurde jäh unterbrochen.
»Was treibst du dich hier herum, du elende Ketzerin. Scher dich fort, du Unglück bringendes Weibsbild, bevor ich die Hunde auf dich hetze.« Eine Magd kam, mit den Armen fuchtelnd, über den Hof gerannt. »Keiner will dich hierhaben, du elende Grubenheimerin. Verschwinde endlich in die Hölle, aus der du hervorgekrochen bist.«
Die Frau hob abwehrend die Hände. »Ist ja schon gut. Ich wollte keinen Ärger machen.« Sie schaute noch einmal zu Teresa, dann drehte sie sich um, zog den Esel auffordernd am Zügel und verschwand im Nebel, der sich bereits lichtete. Sie hat recht gehabt, dachte Teresa und blickte nach oben, wo bereits der blaue Himmel zu erkennen war. Bestimmt würde es ein schöner Tag werden. Nach Atem ringend, blieb die aufgebrachte Magd neben Teresa stehen und rief laut: »Und lass dich hier bloß nie wieder blicken.«
Mitleidig musterte sie dann Teresa von der Seite.
»In Eurer Haut möchte ich jetzt nicht stecken.«
»Warum?«, fragte Teresa verwundert.
»Na, weil die Grubenheimerin Unglück bringt. Wer ihr begegnet, ist des Todes, sagt man.«
Teresa erstarrte. Die Magd drehte sich um, ging zurück zum Haus und murmelte: »Der Herrgott möge uns allen beistehen.«
Einige Zeit später prüfte Teresa, ob ihre Ware auch gut an der Kraxe befestigt war, während die anderen Händler ihre Pferde von der Weide holten und vor ihre Wagen spannten. Der Bierbrauer Nikolaus lief mit einem mächtigen Brauereipferd an ihr vorüber. Teresa zuckte zurück. Vor dem hoch aufgewachsenen, stämmigen Mann mit dem breiten Kreuz hatte sie besonders viel Respekt, obwohl er noch nie mit ihr gesprochen hatte. Allerdings hielt sich seine Gattin Else nicht mit Anfeindungen zurück. Ein schnitzendes, in ihren Augen vorlautes Mädchen passte nicht in ihr Weltbild. Else folgte ihrem Mann, ein weiteres Pferd am Zügel, und blickte demonstrativ in die andere Richtung. Mechthild kletterte mit der Hilfe ihres Mannes auf das mit Fellen und gegerbtem Leder beladene Fuhrwerk. Ihr rechter Arm lag in einer Schlinge. Teresas Mitleid hielt sich in Grenzen. Keiner hatte Mechthild angeschafft, sich auf dem Hof herumzutreiben und andere Leute zu ermahnen.
»Ist alles gut befestigt?« Rupert riss sie aus ihren Gedanken. »Ja, alles gut«, erwiderte sie abwesend. Er folgte dem Blick seiner Schwester.
»Lass dich nicht von ihr ärgern. Du musst die Weiber nur noch bis Passau ertragen. Von dort fahren wir mit dem Schiff weiter. Kaspar kennt einen Fährmann, der uns mitnehmen könnte.« Er legte ihr die Hand auf den Arm. »Ich weiß, dass ich nicht gut im Handeln oder Schnitzen bin, aber ich werde uns sicher ans Ziel bringen, das verspreche ich dir.« Er atmete tief durch. »Du bist unserem Vater so viel ähnlicher als ich. Derselbe ehrgeizige Blick, das gleiche kantige Kinn. Wollen wir hoffen, dass unser Oheim dein Talent erkennt und es fördert. Es wäre Vaters Wunsch gewesen, dessen bin ich mir sicher.«
Teresa nickte, Tränen traten ihr in die Augen, eine lief über ihre Wange. Sanft wischte Rupert sie ab. Nur der Vater hatte gewusst, wie er Teresa beruhigen konnte, denn er hatte sie verstanden. Sie waren nicht nur Vater und Tochter, sondern auch Seelenverwandte gewesen. Er selbst suchte nicht nach Anerkennung, war ausgeglichen wie seine Mutter und mit kleinen Dingen zufrieden. Ihm genügte ein ruhiges Leben mit einem guten Auskommen. Er schaute auf seine Tasche, in der der Brief seines Oheims neben dem Zauberzettel steckte. Der Brief versprach eine Zukunft und der magische Zettel Sicherheit in einer auseinanderbrechenden Welt. Teresa holte ein Taschentuch aus ihrer Rocktasche, putzte sich die Nase und zwang sich zu einem Lächeln. Er zwinkerte ihr aufmunternd zu und strich eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht, die sich aus ihrem Zopf gelöst hatte. Wie sehr er seine Schwester liebte. Sie beide mussten es nach Nürnberg schaffen, wo sie ein neues und hoffentlich besseres Leben erwartete.
Hufgetrappel ließ ihn aufblicken. Eine große Gruppe Landsknechte kam auf den Innenhof des Gasthauses geritten. Sie sprangen von den Pferden und zogen ihre Schwerter. Die Knechte, die sich eben noch um die Pferde gekümmert hatten, suchten sofort das Weite. Der Wirt, der gerade auf den Hof gekommen war, um nach dem Rechten zu sehen, verschwand in der Gaststube, gefolgt von zwei laut kreischenden Mägden. Rupert griff hastig nach Teresas Hand, und sie liefen hinter Beppos Wagen, dann zog ihr Bruder sie zum Eingang der Scheune. Sie schlüpften durch die angelehnte Tür und durchquerten den von Dämmerlicht erfüllten Stall. Die Pferche standen leer. Heu stapelte sich in einer der Ecken, daneben lehnten Rechen und Sensen an der Wand. Der gellende Schrei einer Magd ließ Teresa erzittern. Sie konnte nur erahnen, was die Männer mit dem Mädchen machten.
Rupert schaute sich um. »Diese gottverdammte Scheune muss doch einen Hinterausgang haben«, fluchte er und zog Teresa mit sich in den hinteren Teil des Stalles, wo sie tatsächlich einen Ausgang fanden. Erleichtert liefen die beiden darauf zu. Doch kurz bevor sie das rettende Stalltor erreichten, stellte sich ihnen ein Landsknecht in den Weg. Jäh wichen sie zurück, aber dann erkannten sie, wer vor ihnen stand. Es war der Landsknecht, mit dem sie gestern Abend am Tisch gesessen hatten.
»Ach, Ihr seid es«, sagte Rupert erleichtert.
Auf den Lippen des Landsknechts breitete sich ein breites Grinsen aus. Teresa trat instinktiv einen Schritt zurück.
»Habe ich Euch nicht gesagt, dass die Zeiten unsicher sind«, sagte er und machte einen Schritt auf die beiden zu. »Doch besonders das Täubchen wollte nicht hören.« Er griff nach Teresa und zog sie zu sich. Sie spürte seinen nach Branntwein stinkenden Atem auf der Haut.
»Hört auf damit. Ihr seid betrunken.« Sie wollte sich losreißen, aber sein Griff wurde fester.
»Das sind die Soldaten der Liga, die nach Böhmen ziehen. Mutige Männer, leider ohne Manieren. Und ich bin einer von ihnen.«
»Lasst sofort meine Schwester in Ruhe«, befahl Rupert. Der Bursche lachte laut auf. Er zog Teresa noch näher an sich heran, presste seine Lippen auf ihre und schob ihr seine Zunge in den Mund. Sie biss zu. Mit einem Aufschrei wich er zurück. Teresa nutzte den Moment und floh hinter ihren Bruder.
»Das sollst du mir büßen, du gottverdammtes Biest«, rief der Landsknecht. Er wischte sich über die blutigen Lippen, zog sein Schwert und trat näher an die beiden heran. »Die Kehlen werde ich euch aufschlitzen, ganz langsam.«
Rupert schob Teresa ganz hinter sich. »Gar nichts werdet Ihr«, erwiderte er, griff in seine Tasche, holte einen Zettel hervor, steckte ihn in den Mund und schluckte ihn hinunter. Es ging so schnell, dass Teresa ihn nicht aufhalten konnte.
Der Landsknecht lachte laut auf. Er ahnte, was Rupert getan hatte. »Der Teufel kann dir jetzt auch nicht mehr helfen«, rief er.
Rupert zog seinen Dolch. Der Landsknecht machte einen Schritt auf Rupert zu und wich lachend wieder zurück, als Rupert nach vorn preschte.
»Ein einfacher Spielzeughändler, was für ein Gegner«, ereiferte sich der Landsknecht und umrundete Rupert, den die Kraxe auf dem Rücken in seiner Bewegungsfreiheit einschränkte. Teresa hielt den Atem an, während ihr Bruder immer wieder mit dem Dolch ins Leere stieß. Brandgeruch zog in den Stall. Der Landsknecht schaute zum Hof hinüber.
»Ich spiele gern. Aber jetzt wird es Zeit, es zu beenden.« Er machte einen Ausfallschritt und schlug Rupert mit seinem Schwert auf die Hand. Der Dolch fiel zu Boden. Teresa schrie auf. Rupert wollte sich rasch bücken, um den Dolch aufzuheben, doch da war der Landsknecht bereits über ihm, schubste ihn zur Seite und rammte ihm sein Schwert in die Brust. Rupert sackte in sich zusammen und ging zu Boden. Der Landsknecht zog die Klinge aus Ruperts Brust und drehte sich zu Teresa um.
»Der Teufel hat gewonnen«, sagte er mit einem breiten Grinsen. »Eine weitere Seele, die ich ihm geliefert habe.« Er richtete sein Schwert auf Teresa. »Er gewinnt immer, musst du wissen.«
Teresa stieß mit dem Rücken gegen einen herumstehenden Karren. Der Landsknecht hielt ihr die Spitze des Schwertes an den Hals. Sie spürte kurz das Metall auf ihrer Haut. Er ließ das Schwert sinken, machte einen schnellen Schritt auf sie zu, drückte sie gegen den Karren und küsste sie, heftig und leidenschaftlich. Eng drängte er sich an sie und versuchte, mit seinem Knie ihre Beine auseinanderzudrücken.
»Diesmal beißt du mich nicht, meine Schöne«, sagte er und griff mit einer Hand an ihre Brüste. »Schon gestern Abend wollte ich dich besitzen.«
Teresa spuckte ihm ins Gesicht. Lachend wischte er sich den Speichel von der Wange und öffnete mit einer Hand seine Hose, während er Teresa mit der anderen festhielt. Teresa griff in ihre Rocktasche. Fest umschlossen ihre Finger das Schnitzmesser. Genau in dem Moment, als der Landsknecht sie zu Boden zerrte, holte sie es heraus und rammte es mit ganzer Kraft in seinen Rücken. Er riss die Augen auf und starrte sie ungläubig an. Er wollte noch etwas sagen, doch nur noch ein Röcheln kam über seine Lippen, und alle Farbe war aus seinem Gesicht gewichen. Teresa rollte sich zur Seite. Er sackte neben ihr auf den Boden. Sie schloss für einen Moment die Augen, dann zog sie ihr Schnitzmesser aus seinem Rücken und eilte zu ihrem Bruder. Er lag in einer Blutlache, seine Augen waren erstarrt. Sie warf sich über ihn und begann zu schluchzen.
»Du darfst nicht tot sein, hörst du. Bitte, du musst wieder aufwachen. Wir müssen fort von hier. Bitte, so wach doch auf, du darfst nicht sterben, tu mir das nicht an. Du darfst nicht dem Teufel gehören. Deine Seele muss frei sein. Bitte, so hör doch! Wach wieder auf.« Ihre Tränen tropften auf seine Wangen. »Bitte, so wach doch auf«, murmelte sie verzweifelt. »Wir müssen weiterziehen nach Nürnberg. Ich verspreche, immer auf dich zu hören. Was soll nur ohne dich werden?«
Das Knarren des Stalltors und Stimmen holten sie in die Wirklichkeit zurück. Erschrocken richtete sie sich auf. Die Landsknechte, der Überfall. Panisch schaute sie um sich, dann wieder auf ihren toten Bruder. »Es tut mir so leid«, murmelte sie, berührte ein letztes Mal seine Wange, rannte zur Hintertür und zerrte an dem Riegel. Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, bis das Stück Holz endlich nach oben sprang und sich die Tür öffnete. Die Stimmen näherten sich, irgendwo schnaubte ein Pferd. Teresa rannte über die von Rauchschwaden erfüllte Pferdeweide zum nahen Waldrand. Sie stolperte über Wurzeln, fiel hin und rappelte sich wieder auf. Das Unterholz war hier dicht. Brombeergestrüpp zerriss ihren Rock, Äste zerkratzten ihre Wangen, sie spürte es kaum. Tränen verschleierten ihren Blick. Sie stolperte erneut über eine Wurzel, verlor das Gleichgewicht, fiel hin und rollte einen Abhang hinunter. Die Bäume, der Himmel, das Sonnenlicht, die Blätter und der Waldboden vermischten sich, während sie immer weiter den Hang hinabkugelte und irgendwann in einem Laubhaufen liegen blieb. Erleichtert atmete sie auf, doch dann drang plötzlich eine Stimme an ihr Ohr.
»Grundgütiger. Es regnet junge Mädchen.«
Kapitel 3
Teresa schaute auf einen von Flicken bedeckten Leinenrock und die Hufe eines Esels. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, doch die Stimme kam ihr bekannt vor. »Haben wir selten, dass es junge Mädchen regnet, nicht wahr, Burli? Geht es dir gut, kleine Schnitzerin?«
Teresa setzte sich auf. »Ich denke schon.« Sie zupfte sich ein Blatt aus den Haaren.
»Siehst aber nicht so aus«, erwiderte die Frau. »Hat dort oben Ärger gegeben, nicht wahr?« Sie deutete den Berg hinauf. »Hab ich im Gespür gehabt, aber auf mich will ja niemand hören.«
Teresa horchte auf. »Im Gespür gehabt?«, wiederholte sie. Die Frau half Teresa beim Aufstehen und musterte ihr Gesicht. »Nur ein paar Kratzer von den Zweigen, das vergeht.« Sie griff nach den Zügeln ihres kleinen Esels. »Komm. Hier kannst du nicht bleiben. Das Heer der Katholischen Liga liegt bei Salzweg im Wiesengrund. Sie rauben und plündern schon seit Tagen. Ich wollte den Wirt warnen, denn er ist ein kluger Bursche, jedenfalls manchmal. Aber seine Magd ist ein dummes und geschwätziges Ding. Hat es nicht besser verdient, wenn sie nicht wahrhaben will, was gut und böse ist.«
Teresa stolperte hinter der Frau den Waldweg entlang. Die Sonne schien durch die lichten Bäume, und unter ihren Füßen raschelte das Herbstlaub. Es wirkte alles so friedlich, und doch war ihr eben der Teufel persönlich erschienen, der alles zerstört hatte. Sie blieb stehen und schaute zurück. Vor ihrem inneren Auge tauchte das Gesicht ihres Bruders auf, sein lebloser Blick. Unerbittlich holte der Schmerz sie ein. Sie hatte ihren geliebten Bruder, auf dem Boden liegend und im Qualm der gefräßigen Flammen, zurückgelassen. Sie blickte wieder nach vorn. Die Frau ging – den Esel am Zügel – weiter. Bald würde sie aus ihrem Blickfeld verschwinden. Was würde dann aus ihr werden? Sie ballte die Fäuste. Warum nur hatte Rupert diesem zwielichtigen Burschen vertraut. Tränen traten ihr in die Augen. Die Frau blieb stehen und drehte sich zu ihr um. Teresa schüttelte den Kopf. Sie konnte Rupert nicht zurücklassen. Wenigstens in geweihter Erde musste er beerdigt werden, damit Gott ihm seine Sünde vergab. Sie musste für ihn beten und einen Pfarrer holen. Das war sie ihm schuldig. Sie schaute den steilen Abhang hinauf. Mücken tanzten im hellen Sonnenlicht, eine Amsel hüpfte von Ast zu Ast, eine weitere folgte ihr. Plötzlich legte sich von hinten eine Hand auf ihre Schulter.
»Du kannst nicht zurückgehen.« Teresa drehte sich um. Sie schaute in das Gesicht der Frau, das von dem breiten Filzhut beschattet wurde. Die Worte der Magd kamen ihr wieder in den Sinn. Sie hatte die Frau als Unglücksbringer, Ketzerin und Grubenheimerin beschimpft. Auch wenn Teresa mit dem letzten Wort nichts anfangen konnte, so musste es für die Abscheu der Magd einen triftigen Grund geben. Sie machte einen Schritt rückwärts. Die Hand der Frau rutschte von ihrer Schulter. Womöglich war das alles tatsächlich deswegen geschehen, weil sie mit ihr gesprochen hatte. Wäre sie doch nur bei Rupert im Stall geblieben, dann wäre niemals etwas passiert.
Sie hob abwehrend die Hände. »Fass mich nicht an. Am Ende hat die Magd recht gehabt. Du bist gekommen und hast das Unglück über uns gebracht. Mein Bruder ist tot, vielleicht nur wegen dir. Ich hab ihn verloren, hörst du!« Ihre Stimme wurde laut. Sie deutete den Hügel hinauf. »Er liegt dort oben in der verdammten Scheune, und ich kann ihm nicht helfen.« Tränen rannen über Teresas Wangen. »Verstehst du? Ich konnte ihm nicht helfen, konnte den Landsknecht nicht aufhalten.«
Die Frau ging auf Teresa zu und nahm sie in den Arm. Teresa wollte sie wegstoßen, die Umarmung nicht zulassen, doch der Griff der Frau blieb fest. Sie drückte Teresa an sich, bis deren Anspannung wich. Wut und Verzweiflung bahnten sich ihren Weg, und Teresa wurde von einem Weinkrampf geschüttelt. Lange verharrten sie in der Umarmung. Die Frau wusste, dass Wut und Trauer das Mädchen für lange Zeit begleiten und eine tiefe Narbe in ihrem Herzen hinterlassen würden.
Irgendwann löste sich Teresa aus ihren Armen und wischte sich die Tränen von den Wangen. »Es tut mir leid, ich wollte nicht …«
Die Frau winkte ab. »Dir muss nichts leidtun. Ich hätte mich von dieser dummen Dirne nicht vertreiben lassen dürfen.«
Teresa ging nicht auf ihre Worte ein.
»Er wollte mich beschützen, weil er doch jetzt das Familienoberhaupt ist. Er hat geglaubt, er müsste dem Landsknecht tapfer entgegentreten. Ein Mal war er mutig, doch er schaffte es nicht …« Ihre Stimme brach.
Die Frau legte Teresa die Hand auf die Schulter.
»In diesen Zeiten wollen oder müssen alle mutig sein. Aber die wenigstens sind es tatsächlich. Manch einer glaubt, er müsse in den Krieg ziehen, um sich und anderen zu beweisen, wie tapfer er ist. Viele von ihnen vergessen ihre Menschlichkeit und werden schlimmer als jedes Tier, das nur tötet, weil es sich ernähren oder seine Jungen beschützen muss. Ein Wolf würde niemals wegen Ruhm und Ehre sterben.«
Teresa schüttelte den Kopf. »Er wollte mich beschützen, deswegen ist er tot. Und was mache ich? Ich laufe davon und lasse ihn allein. Wir hatten doch nur noch einander. Keiner sollte den anderen zurücklassen, aber ich habe es getan.«
»Manchmal ist das Leben ungerecht«, sagte die Frau und wischte Teresa eine Träne von der Wange.
Teresa schniefte. »Wir wollten nach Nürnberg. Allein werde ich es niemals bis dorthin schaffen.«
Die Frau nickte bestätigend. »Das stimmt. Aber immerhin bist du jetzt nicht mehr allein, denn du hast mich. Irgendein Ausweg wird sich schon finden.« Die Frau zwinkerte Teresa aufmunternd zu. »Aber erst einmal musst du mir sagen, wie du heißt. Ich kann ja nicht immer Mädchen zu dir sagen.«
Jetzt musste sogar Teresa lächeln. Sie nannte ihren Namen. Die Frau griff nach den Zügeln des kleinen Esels. »Mein Name ist Annemarie, und das hier ist Burli.« Das Tier schüttelte seine graue Mähne, als ob es verstanden hätte, dass von ihm gesprochen wurde. Wolken schoben sich plötzlich vor die Sonne, und ein Windstoß wirbelte die trockenen Blätter in die Höhe. Besorgt schaute Annemarie zum Himmel. »Wir sollten sehen, dass wir weiterkommen. Das Wetter schlägt um. Sicher wird es bald Regen geben, und bis zu meiner Hütte ist es noch ein ganzes Stück. Dort können wir beratschlagen, wie es weitergeht.« Sie setzte sich, ohne eine Antwort von Teresa abzuwarten, in Bewegung. Der Wind rauschte über ihnen in den Baumwipfeln, und Teresa zog ihren Umhang enger um sich. Der Weg wurde abschüssig und ging in einen Wiesengrund über. Als sie diesen durchquerten, fielen die ersten Tropfen vom Himmel. Teresa blieb noch einmal stehen und schaute zum Waldrand zurück. Irgendwo hinter den vielen Bäumen war ihr Bruder. Seufzend schüttelte sie den Kopf. Nein, dort war er nicht mehr, sondern in der Hölle. Nur weil er sie beschützen wollte. Irgendwie würde sie einen Weg finden, seine Seele reinzuwaschen, denn das war sie ihm schuldig. Sie drehte sich um und beschleunigte ihre Schritte. Es regnete stärker, und der Wind schien in den Bäumen regelrecht aufzuheulen.
Teresa folgte Annemarie zu einer kleinen, im Schutz einer Felswand stehenden Hütte. Ihre Füße schmerzten, und sie war vollkommen durchnässt. Das Gelände war steil und unwegsam gewesen. Annemarie hielt nicht viel davon, auf den Hauptwegen zu laufen, auf denen sich, vor allem in der Dämmerung, Gesindel herumtrieb. Selbst auf den Nebenwegen hatten sie sich immer wieder im Unterholz versteckt, doch meistens waren es nur Tiere gewesen, die sie aufschreckt hatten. Oftmals Schweine, die die Bauern auf die sogenannte Waldweide trieben, damit sie Eicheln fressen konnten. Nur ein Mal war eine Gruppe böhmischer Säumer an ihnen vorbeigezogen, die Annemarie argwöhnisch beäugt hatte. Der Steig, auf dem sie sich befunden hatten, war einer der Schmugglerwege und nur wenigen bekannt. Sicher waren sie keine ehrlichen Burschen. Annemarie vermutete in ihren Fässern eher Branntwein als Salz.
Annemarie brachte den Esel in einem schäbigen Verschlag neben der Tür unter. Einen Stall schien es nicht zu geben. In der Hütte brauchte Teresa einen Moment, um sich an das Zwielicht zu gewöhnen. Eine forsche Stimme, die in dem hinteren Teil der Hütte ertönte, ließ sie zusammenzucken.
»Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ich hab schon gedacht, du hättest dich endgültig aus dem Staub gemacht. Ist kalt hier drin. Wolltest mich wohl erfrieren lassen.«
Annemarie legte einige Holzscheite unter einen Kupferkessel, der über einer offenen Feuerstelle in der Ecke hing.
»Ich habe einen Gast mitgebracht, Vater.« Sie ging nicht auf sein mürrisches Gerede ein. »Ein Mädchen, Teresa heißt sie. Vendelsberg ist überfallen worden.«
»Was geht mich das an«, antwortete er. »Überfallen haben sie uns auch. Hat uns irgendjemand geholfen? Sollen sich doch alle zum Teufel scheren.«
Teresa wich erschrocken zurück, doch Annemarie trat schnell zu ihr und raunte ihr eine Erklärung ins Ohr: »Gib nicht viel auf sein Gerede, er meint es nicht so.« Laut sagte sie: »Sollen wir dann auch nicht mehr barmherzig sein?« Sie zwinkerte Teresa zu, entzündete zwei Talgkerzen und stellte sie auf einen kleinen Tisch. Dann forderte sie Teresa auf: »Du solltest die nassen Sache ausziehen, damit ich sie übers Feuer hängen kann, sonst holst du dir den Tod.« Sie senkte ihre Stimme zu einem Flüstern. »Er ist blind.«
»Was murmelst du da? Ich kann dich hören«, erklang erneut die mürrische Stimme. Eine Gestalt trat näher. Teresa erkannte einen schmächtigen alten Mann, der sich an der Hüttenwand entlang bis zu einer Bank neben der Feuerstelle tastete und sich stöhnend setzte. Im Licht des Feuers wirkten seine Wangen eingefallen, seine Augen lagen in tiefen Höhlen, und sein graues, verfilztes Haar fiel bis auf seine hageren Schultern herab. Annemarie griff nach einer wollenen Decke und legte sie ihrem Vater fürsorglich über die Beine. Erneut ging sie nicht auf seine Frage ein.
»Gleich mache ich den Buchweizenbrei warm. Das wird dir guttun und auch unseren Gast stärken.«
Sie winkte Teresa näher heran. Unsicher machte Teresa einen Schritt auf den alten, nach Urin und Schweiß stinkenden Mann zu. Sie wollte angewidert den Kopf abwenden, doch sie riss sich zusammen. Auch wenn er verbittert schien und blind war, gebot es der Anstand, dass sie ihm Höflichkeit entgegenbrachte.
»Guten Abend. Ich werde Euch nicht zur Last fallen, das verspreche ich.«
Der alte Mann schnaubte verächtlich. »Aber das tust du doch schon. Mein Essen und meinen warmen Schlafplatz muss ich mit dir teilen, weil meine liebe Tochter mal wieder zu gutmütig ist.«
Annemarie legte ihren Beutel auf den Tisch und holte einige Äpfel und einen halben Laib Brot heraus.
»Die Unterleitnerin war heute Morgen so gütig und hat mir zum Dank für meine Warnung etwas zu essen geschenkt.« Sie blickte zu Teresa, die gerade ihr Mieder aus grobem Leinen aufschnürte. »Gibt auch kluge Leute, die mir zuhören.« Teresa senkte den Blick. Sie kam sich schäbig vor, obwohl sie gar nichts getan hatte. Aber vielleicht war ja ihre Untätigkeit der Fehler gewesen. Womöglich würde ihr Bruder noch leben, wenn sie sich eingemischt hätte, als die Magd Annemarie verscheucht hatte.
»Warum verjagen sie dich überhaupt?«, fragte Teresa und schlüpfte aus ihrem Rock. Annemarie nahm ihn ihr ab und hängte ihn an eine Stange.
Sie wollte etwas erwidern, doch ihr Vater kam ihr zuvor.
»Weil sie dumm und verbohrt in ihrem Glauben sind. Andersgläubige werden nicht geduldet, sondern verjagt, geächtet und verfolgt. Wir gehören den Böhmischen Brüdern an und sind Vertriebene, die als Ketzer beschimpft werden, nur weil wir nicht den katholischen Glauben annehmen wollen. In alten Höhlen und Hütten müssen wir uns verstecken, was uns den Namen Grubenheimer eingebracht hat. Doch bekehren tun sie mich nicht mehr und Annemarie auch nicht. Wir lassen uns nicht verbiegen, niemals!« Seine Stimme wurde laut, er begann zu röcheln und bekam einem Hustenanfall.
Annemarie schenkte eine Flüssigkeit in einen Holzbecher, eilte zu ihrem Vater und half ihm beim Trinken. Der Anfall ließ nach.
»Reg dich nicht so auf. Es ist eben, wie es ist. Ändern können wir es nicht.«





























