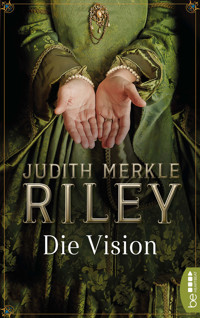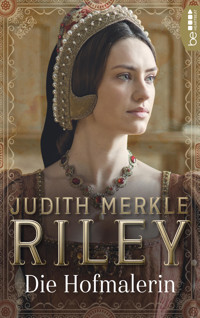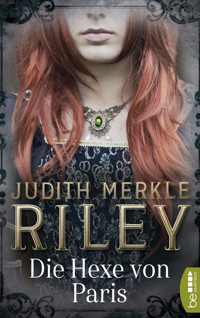
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau im Sog einer der skandalösesten Giftaffären aller Zeiten
Paris, Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Polizei deckt einen Zirkel von Hexen, Wahrsagerinnen und Magiern auf, der bis zum Hof von König Ludwig XIV. reicht. Mittendrin: die 15-jährige Geneviève Pasquier. Die junge Frau mit seherischen Fähigkeiten wurde von der Schattenkönigin Cathérine Montvoisin persönlich zur Hexe ausgebildet. Zurzeit der Ermittlungen ist sie eine gefragte Wahrsagerin in höfischen Kreisen und gerät ins Fadenkreuz des Polizeipräfekten La Reynie. Kann sie der Hexenjagd entkommen?
Ein farbenprächtiger und spannender historischer Roman über die Giftaffäre, eine skandalöse Serie von Morden und Hexerei. Von Judith Merkle Riley, Autorin der erfolgreichen "Margaret von Ashbury"-Trilogie.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 899
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Anmerkung zur Geschichte
Über dieses Buch
Eine Frau im Sog einer der skandalösesten Giftaffären aller Zeiten
Paris, Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Polizei deckt einen Zirkel von Hexen, Wahrsagerinnen und Magiern auf, der bis zum Hof von König Ludwig XIV. reicht. Mittendrin: die 15-jährige Geneviève Pasquier. Die junge Frau mit seherischen Fähigkeiten wurde von der Schattenkönigin Cathérine Montvoisin persönlich zur Hexe ausgebildet. Zurzeit der Ermittlungen ist sie eine gefragte Wahrsagerin in höfischen Kreisen und gerät ins Fadenkreuz des Polizeipräfekten La Reynie. Kann sie der Hexenjagd entkommen?
Über die Autorin
Judith Merkle Riley (1942-2010) promovierte an der University of California in Berkeley in Philosophie und war Dozentin für Politikwissenschaft in Claremont, California. Von 1988 bis 2007 schrieb sie sechs historische Romane, die allesamt zu Weltbestsellern avancierten.
Judith Merkle Riley
Die Hexe von Paris
Aus dem amerikanischen Englisch von Margarete Längsfeld
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1992, 2012 by Judith Merkle Riley
Translated from the English language: THE ORACLE GLASS
Published in the United States by Viking Penguin, New York
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 1992 by Ullstein Buchverlage GmbH, München und Leipzig
Erschienen im List Verlag
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Motives © Arcangel: Stephen Mulcahey
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3719-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel I
Bei meinem Eintritt in die Welt schien ich über kein besonderes Talent zu verfügen. Schon gar nicht über jenes ungewöhnliche, das mich in das geheime Reich führte, dessen größte Zierde ich einmal werden sollte. Meine ersten Schreie ertönten an einem grauen Wintermorgen zu Beginn des Jahres 1659 in Paris. Meine Mutter hatte zuvor einen Tag und eine Nacht in den Wehen gelegen, ohne den exzellenten Rat der beiden ärztlichen Gehilfen zu befolgen, die sie ermahnten: »Pressen, Madame, pressen!« Dabei drückten sie ihre Schultern auf die schmale Bettstelle, die man vor das Feuer gerückt hatte. Der berühmte Auguste-Philippe Brunet, Heilkundiger und Angehöriger der medizinischen Fakultät des Collège Saint-Côme, hatte bereits den langen Haken aus seinem Etui genommen, um damit wenigstens die Mutter zu retten. Da stieß die Hebamme, die ihm zur Seite stand, einen Schrei aus und zog doch noch mit ihrer Hand das schrumpelige Ergebnis der vorangegangenen Wehen hervor. Und als sie erschrocken das Blut betrachtete, das sich auf die Laken ergoss, rettete der berühmte Heilkundige meiner Mutter ein zweites Mal das Leben: Nachdem er ein kleines Schaf in das Schlafgemach hatte bringen lassen, gab er Befehl, sie in das frisch abgebalgte Fell zu hüllen. Auf diese Weise wurde ich ein Kind der modernen Wissenschaft, und alle jubelten, mit Ausnahme des Schafes.
»Madame Pasquier, es ist ein gesundes Mädchen«, verkündete der Heilkundige, die winzige Ursache seiner Bemühungen beäugend, als die Hebamme mich, frisch gewaschen, meiner Mutter zur Begutachtung übergab.
»Ach Gott, sie ist hässlich«, erwiderte meine Mutter, und damit drehte sie ihr hübsches Gesicht zur Wand und weinte vor Enttäuschung zwei Tage lang. Und so wurde ich noch in derselben Woche mit einer Fuhre brüllender neugeborener Pariser Erdenbürger fortgeschafft, um auf dem Lande bei Fontenay-aux-Roses aufgezogen zu werden. In den nächsten fünf Jahren sollte ich nicht zurückkehren. Ich war gerade lange genug zu Hause geblieben, um meinem Vater die Feststellung zu ermöglichen, dass meine Augen grau waren. Grau, die Farbe des Winterhimmels über den spitzen Schieferdächern der Stadt.
Wie ich an jenem Morgen zwischen den Sternbildern des Schützen und des Steinbocks geboren wurde, so stand ich auch just an der Konjunktion der Welten von Licht und Dunkel. Auserkoren zur Wanderung zwischen ebendiesen Welten von demselben Schicksal, das meinen Augen die Macht verlieh, das Orakelglas zu lesen. Und auf meinen Wanderungen zwischen der Welt der Vernunft und der uralten Welt der Mysterien und des Wahns begegnete ich Prinzen, Narren und Ungeheuern, zuweilen wahrhaftig alle in ein und derselben Menschengestalt vereint. Keine aber war größer als die strahlende und gefährliche Frau, die Paris aus dem Schatten beherrschte und die Mächte der Erde verhöhnte. Sie war es, die mein Leben veränderte, im Guten wie im Bösen, es zu dem machte, was es heute ist. Während ich schreibe, steht ihr Talisman auf meinem Pult, ein kleines Katzengesicht aus Bernstein. Wenn ich vom Blatt aufblicke, höre ich den Widerhall ihres hämischen Gelächters: »So, so, du schreibst über mich, kleines Närrchen? Dann schreibe recht.« Wer war sie, die Königin der Schatten? Keine, von der Ihr je gehört habt. Nur die größte Hexe, die je ein Königreich in ihrer Hand hielt.
Ich schmeichle mir nicht, wenn ich sage, dass ich ein vorzügliches Gedächtnis habe und schon in ganz jungen Jahren mehr begriff als die meisten Menschen, was mich zu einem wunderlichen, ernsten Kinde machte. Zum Beispiel sah ich rasch, dass Geld die Triebfeder fast aller menschlichen Handlungen ist, ungeachtet dessen, was einer behaupten mag. Und ich erkannte, dass manche Kinder sich verdienen müssen, was anderen durch ihre Geburt zusteht. Ich konnte nur hoffen, die Duldung meiner lebenslustigen, geistreichen Mutter mittels Gelehrigkeit, Aufgewecktheit und Nützlichkeit zu erringen. Denn sie, die Hässlichkeit in jeder Form verachtete, konnte es kaum ertragen, mit mir in ein und demselben Raum gesehen zu werden.
Mère Jeannot, die mich aufzog, schärfte mir ein, dass jeder eine schöne Seele haben könne. Doch dies widersprach der Tatsache, dass die anderen Dorfkinder sich sehr wenig darum scherten, wie das Innere beschaffen war; die Entstellung des Äußeren hatte in ihrem Urteil beträchtlich mehr Gewicht. Wenn dann die alte Frau zu ihrem Stock griff, um sie mir vom Leibe zu halten, wurde mir klar, dass, wenn es an Schönheit und Liebreiz gebrach, Gewalt einer schönen Seele überlegen war. Mère Jeannot war freilich zu derlei Erkenntnissen nicht fähig. Sie war vollkommen ungebildet, brachte Ursache und Wirkung oft durcheinander und missverstand das Prinzip, dass Geld die Triebfeder menschlichen Handelns ist, vollkommen. Wenn sie daher die Sprösslinge anderer Leute in Pflege nahm, machte sie ihnen nicht, wie unter Säuglingshüterinnen üblich, einfach den Garaus, um sich so die Mühe des Fütterns zu ersparen, sondern zog sie wie ihre eigenen auf. Das freilich war ihr Untergang.
»Brav sein und Gott lieben«, so ihre Devise, »dann geht alles gut.« Doch ich beobachtete, dass trotz ihrer schönen Seele bei ihr nie etwas gutging. Die Kinder aßen so viel, dass das hohe Strohdach ihrer Lehmhütte alt und leck wurde und die Ratten einzogen. Dann wurde ihr Ehemann krank, der Steuereintreiber holte die Betten ab, und ihr unnützer Neffe stahl das Geld aus Paris, das sie im Kästchen unter dem Bett verwahrte. Für ihre immense Brut von Pfleglingen gab es nur noch eine Mahlzeit am Tag, und zwar Hafergrütze. Ich aber gedieh trotz alledem, denn, wie Mutter mir oftmals sagte, Unkraut gedeiht am besten, und die schönsten Blumen gedeihen nur im Glashaus. Manchmal, wenn ich mich an die wogende Weide im Frühling hinter Mère Jeannots Häuschen erinnere, an die wildwachsenden, blühenden Kräuter, die die Erde mit Farben überzogen, dann denke ich, dass man Unkraut niemals unterschätzen soll.
Als ich gerade fünf geworden war, fuhr eine große, glänzendschwarze Kalesche mit goldenen Verzierungen und hohen roten Rädern in Fontenay-aux-Roses vor. In jenen Tagen, als Kaleschen sogar in Paris noch selten waren, hätte ein Elefant in dem kleinen Dorf nicht mehr Aufsehen erregen können. In allen Fenstern tauchten Köpfe auf, selbst der Dorfpriester kam herbeigelaufen. Die Kutsche wurde von zwei großen Braunen in messingbeschlagenem Geschirr gezogen. Auf dem Bock ein Kutscher mit einer langen Peitsche, dahinter drei Männer in blauer Livree mit blanken Messingknöpfen, eine Hausmagd mit schneeweißer Haube und Schürze sowie mein Vater, graugesichtig und sorgengebeugt. Er war gekommen, um mich heimzuholen. Er erkannte mich sogleich an meinem schlimmen Fuß und zeigte mit seinem Spazierstock auf mich, als ich zwischen den hüpfenden Kindern einherschlurfte, um wie sie die fremde Kutsche zu bewundern. Daraufhin sprang die Hausmagd heraus, wusch mich und zog mir feine Kleider an, und mein Vater gab der weinenden Mère Jeannot einen Beutel voller Geldstücke. Das letzte, was ich von ihr sah, war ihr tränenfleckiges Gesicht, als sie neben der Kalesche im Staub rannte und rief: »Lebe wohl, kleine Geneviève, vergiss nicht, sei brav!«
In der Kalesche war es heiß und unbequem. Die Ledersitze waren rutschig, die feinen Kleider steif, kratzig und eng. Meine Füße, die mein ganzes kurzes Leben unbeschuht gewesen waren, schmerzten nun furchtbar in den fest geschnürten neuen Schuhen. Und Mère Jeannot war fort. Der Herr in dem altmodischen grauen Reisehabit mit dem breiten Federhut saß mir ganz allein gegenüber und sah mich an. Seine Augen waren voller Tränen, und ich meinte damals, dass auch er Mère Jeannot vermisste. Schließlich sprach er.
»Und mir haben sie gesagt, du seist tot.« Er schüttelte bedächtig den Kopf, als könne er es nicht glauben. Ich betrachtete seine meergrauen Augen. Er trug sein eigenes Haar, denn Perücken waren noch nicht in Mode. Seine Haare waren dunkel, schulterlang, graumeliert. Mein Kopf dagegen, der noch vom Striegeln mit der ungewohnten Haarbürste kribbelte, war voller unbändiger schwarzer Locken. Vorsichtig befühlte ich meine Haare. Sie waren ganz gewiss kein bisschen grau. Meine kindliche, schon damals scharfe Logik zog daraus den Schluss, dass er sich geirrt und das falsche Kind ausgesucht hatte.
»Ich bin dein Vater, Geneviève. Kennst du mich denn nicht?«
»Ich kenne Euch«, erwiderte ich. »Ihr seid der gütigste Vater auf der ganzen Welt. Das hat Mère Jeannot mir gesagt.« Darauf liefen ihm die Tränen übers Gesicht, und er umarmte mich, selbst auf die Gefahr hin, die schöne Stickerei auf seiner langärmeligen Weste zu ruinieren. Und so entdeckte ich aufs Neue, dass Geld das Geheimnis ist, das alles bewegt. Denn hätte Mère Jeannots unnützer Neffe nicht das Geld aus dem Kästchen verbraucht, wäre er auch nicht auf den Gedanken verfallen, einen Brief an meines Vaters Bankier in Paris zu schreiben mit der Forderung, mein Vater möge mehr Geld für meinen Unterhalt schicken. Und so erst erfuhr mein Vater, dass ich nicht vor fünf Jahren auf dem Weg nach Fontenay-aux-Roses gestorben war.
»Ein kaltherziges kleines Ding habt Ihr mir da gebracht«, sagte Mutter. Sie saß im Lehnstuhl in ihrem Empfangssalon, angetan mit einem Gewand aus gelber Seide, und prüfte Stoffmuster ihres Damenschneiders. Ich stand auf der anderen Seite des Zimmers und sah sie lange an. Sie war sehr hübsch, aber ich erinnere mich, dass ich nicht den Wunsch hatte, sie zu berühren. Es brannte kein Feuer, und es war kühl in dem hohen, blau und weiß getäfelten Raum. Erst nach Jahren, als ich darauf hingewiesen wurde, bemerkte ich die helle Fläche im Parkettfußboden, wo der Teppich entfernt worden war, und die hellen Vierecke an der Wand, wo die Gemälde von Vouet und Le Sueur nicht mehr hingen.
Das Haus, in das mein Vater mich gebracht hatte, war ein mittelalterliches Herrschaftshaus im Quartier de la Cité, im Herzen von Paris. Im Stockwerk über dem Empfangssalon und dem Speisezimmer, die nach heutigem Geschmack neu gestaltet waren, drängten sich die engen, altmodischen Zimmer um einen Hof mit einem Turm an einer Ecke und einem Brunnen in der Mitte. Im Erdgeschoss gelangte man von Küche und Stall in den Hof. Dort streckten César und Brutus, die braunen Hengste, ihre langen Gesichter in die Sonne. Katzen und Hunde rekelten sich im Schlamm und suchten nach Abfällen, und die Köchin beschimpfte das Küchenmädchen, das schmutziges Wasser auf die Kopfsteine schüttete. Oben lag die elegante Etage, die Decke mit Nymphen bemalt, und von dort war Violinmusik zu hören, wenn Mutter Gäste hatte. Was dahinter lag, war mittelalterlich und planlos, eigentümliche Zimmer unterschiedlicher Größe, die nahezu willkürlich in Wendeltreppen übergingen, ein Irrgarten aus verbundenen Kammern, die man fast alle durchqueren musste, um in einen bestimmten Raum zu gelangen.
Die Straßenfront des Hauses – ein breiter, niedriger gotischer Bogen und eine schwere Türe – verriet wenig vom vielfältigen Leben im Inneren: Mägde auf den Knien, um die schweren Möbel abzustauben, während meine Mutter die mit Silber beladenen Buffets verschloss; der Hausdiener, der den Lüster herabließ, um ihn mit frischen Kerzen zu bestücken; meine ältere Schwester am Klavichord; Vaters Leibdiener, der mit einer Tasse Schokolade hinaufeilte; und hoch droben Großmutters trippelnder, kreischender Papagei, während die alte Dame in der »Gazette de France« die Gerichtsnachrichten las. Über der alles verbergenden Türe waren kleine gotische Grotesken, marmousets genannt, in den steinernen Bogen geschlagen, und diese hatten nicht nur dem Hause seinen Namen gegeben, sondern auch der schmalen gewundenen Straße, die von der Rue de la Juiverie direkt zum Kreuzgang von Notre-Dame führte und Rue des Marmousets hieß. Diese Straße hatte einen sonderbaren Ruf, und der Bäckerlehrling, die Köchin, die Mägde und unser Stalljunge schworen alle, dass dort Geister aus lange vergangenen Zeiten spukten. Es hieß, in einem florierenden Laden habe man Pasteten verkauft, die aus unseligen auswärtigen Besuchern hergestellt waren. Doch ich suchte vergebens nach der seltsamen Prozession von Männern in veralteter Kleidung, mit aufgeschlitzten Kehlen und hohlen Augen, die angeblich in mondlosen Nächten durch die Mauer wandelten. Zu meinem großen Bedauern sah die Straße für mich stets ganz alltäglich aus, und enttäuscht musste ich erfahren, dass das Anwesen mit dem berühmten Laden nun von dem überaus respektablen Haus der Advokatenfamilie Belut eingenommen wurde.
Auch Vater gehörte zu den Neureichen. Er, der arme Sohn einer einstmals vornehmen Richterfamilie, war financier geworden, einer von denen, die vom Einziehen von Steuern und von Beteiligungen an der Schatzkammer lebten. Er war unter der Protektion von Nicholas Fouquet, dem surintendant des finances, rasch aufgestiegen, hatte privates Vermögen angehäuft und meine Mutter geehelicht, die schöne Tochter einer untergegangenen Aristokratenfamilie. Als Fouquet aber an jenem schicksalhaften Tag im Jahre 1661 als Opfer seines Todfeindes Colbert, des contrôleur-général des finances, festgenommen wurde, befand sich unter den vielen belastenden Dokumenten im berühmten versiegelten Koffer des ruinierten surintendant auch ein Brief, der meinen Vater hinreichend kompromittierte: Vaters Gesicht wies noch die Blässe von der Bastille auf. Er ward gezwungen, seine Anteile zu verkaufen – ein bloßer Mangel an Beweisen hatte ihn nicht gerettet. Doch ihm blieb eine kleine Leibrente, und er konnte das vom Vater ererbte Haus behalten, ebenso die meisten Möbel, indem er sie auf den Namen seiner Mutter überschrieb.
Mutter ließ mehrere Horoskope erstellen, die auf die Rückkehr eines großen Vermögens hindeuteten, doch kehrte es ihr nicht rasch genug zurück. Es verdross sie noch immer, dass das königliche Pardon Vaters Vermögen nicht wiedergebracht hatte; es war vom Rachen des stets gierigen Colbert verschlungen worden. Der König, meinte sie, hätte in Betracht ziehen müssen, dass sie mütterlicherseits beinahe eine Matignon sei, und ihr eine Zuwendung aussetzen sollen.
»Immerhin«, verkündete sie, »ist es unvorstellbar, dass eine Familie wie meine, und sei sie auch noch so in Not, meine Heirat mit einem armen Mann Eures Namens arrangiert hätte, und nun hat mich Eure Misswirtschaft in eine höchst unangemessene Lage gebracht. Es ist geradezu ungehörig für eine Matignon, so zu leben. Überdies habt Ihr mir meinen Mittwoch verdorben.«
»Was ist ein Mittwoch?«, fragte ich die Küchenmagd Suzanne nicht lange nach meiner Ankunft. Die alten steinernen Küchenwände waren feucht vom stets vor sich hinköchelnden Suppentopf, der in einer Ecke der enormen Feuerstelle hing. In einem Käfig gackerten und kreischten zum Abendessen bestimmte Hühner. An der offenen Küchentüre auf den sonnigen Treppenstufen döste ein Diener, der dort postiert war, um die Hungrigen fernzuhalten.
»Ein Mittwoch?«, entgegnete Suzanne, die immer mit mir sprach wie mit einer Erwachsenen. »Oh, hier, hilf mir mal halten – ja, so ist’s recht –« Sie richtete das Gestell mit den Schnüren über dem Talg aus, aus dem bald Kerzen entstehen würden. »Ja, Mittwoch ist, wenn die vielen feinen Herren kommen, um Lügen zu erzählen und Karten zu spielen. Sie speisen und trinken zu viel! Wein – viel zu viel, meine ich. Doch wer fragt mich schon? Aber ich muss sagen, sie sind etwas seltener geworden, seit – du weißt schon –«
Ich kletterte die Stiege von der Küche zu Großmutters Stube hinauf. Sie war immer da. Nie verließ sie das große Bett mit den schweren grünen Vorhängen. Dort »empfing« sie einmal in der Woche. Dann fand sich eine Prozession uralter Verehrer aus vergangenen Zeiten ein, zitternde Herren und Damen, die ihren verstorbenen Gatten gekannt hatten, und ihr Wundarzt, der regelmäßig kam, um den Zustand ihrer Gedärme zu untersuchen. Sie vertrat die Theorie, wenn die Tätigkeit der Gedärme erhalten werde, könne das Leben bis in die Unendlichkeit verlängert werden. Folglich verbrachte sie viel Zeit damit, diese wichtige innere Tätigkeit entweder zu erwarten oder zu analysieren. Nur skandalöse Neuigkeiten in geschmuggelten Flug- und Schmähschriften, libelles genannt, interessierten sie ebenso sehr wie die Neuigkeiten vom Nachtstuhl. Wenn ich an die Türe klopfte, wiederholte Großmutters Papagei ihr »Herein!«, trippelte mit seinen gelben Füßen auf der Stange hin und her und sah mich über seinen krustigen gelben Schnabel hinweg mit schwarzen Äugelchen an. Mit einem rosa Gesicht statt eines grünen und mit einem Häubchen auf dem Kopf hätte er Großmutter nicht unähnlich gesehen.
»Ah, bringst du mir mein Zichorienwasser? Komm her, setz dich aufs Bett und erzähle mir, was unten vorgeht.« Die Wände des Zimmers waren in altmodischer Manier bemalt, dunkelrot, in der Farbe von getrocknetem Blut, die Umrandungen in geometrischen Mustern in Gold gehalten. Die Fenstervorhänge waren stets zugezogen; Großmutter hielt die Sonne für ungesund.
»Großmutter, was ist ein Mittwoch?«
»›Mittwoch‹, ha! Das ist der Nachmittag, an dem meine verhurte Schwiegertochter ihren Busen vor aller Welt zur Schau stellt und mit Fremden liebäugelt. Sie nennt es ihren ›Salon‹ und verlangt, dass man sie mit ›Amérinte‹ anredet statt mit ihrem Taufnamen. So ein vornehmes Getue – nichts wie Karten und Hofklatsch, und dann und wann ein schlechter Poet, der sich an einem besseren Ort keinen Namen machen kann. Oh, der unselige Tag, als diese mit Armut geschlagene Parasitenfamilie sich an meinen Sohn heftete! Gib mir die Bibel von der Nachtkonsole, Geneviève, dann lese ich dir von Isebel, und was mit verruchten Weibern geschieht.« Und ich hörte etwas sehr Interessantes, Schauerliches aus der Bibel, von den Hunden, die Isebel auffraßen bis auf ihre Hände und Füße. Großmutter war nämlich Hugenottin gewesen, bis ihre Familie zur Konvertierung gezwungen wurde, und zum Ärgernis der restlichen Familie behielt sie den protestantischen Brauch des Bibellesens bei.
Auf dem Rückweg nach unten durchquerte ich das Zimmer, in dem Onkel schlief, und sah nicht einen, sondern zwei Köpfe unter der Bettdecke hervorlugen. Onkels Gesicht war aufgedunsen, seine Augen waren gerötet; das Gesicht des Mädchens war völlig von ihren Haaren bedeckt, und sie hatte keine Nachtmütze auf. Onkel wurde von vielen als gutaussehend bezeichnet, aber sein schmales, fuchsartiges Gesicht und die überheblichen, hellen Augen über schrägen Wangenknochen hatten etwas, das mir nicht gefiel. Er besaß eine lasterhafte Zunge, die als witzig galt, und überdeckte mangelhaften Verstand, indem er jede Situation mit Redensarten würzte. Sein Lieblingssprichwort lautete: »Sofort handeln, nur Feiglinge müssen überlegen.« Die Frauen fanden ihn verwegen.
Onkel erblickte mich, als er sich aus einer Karaffe auf seiner Nachtkonsole Branntwein einschenkte. Er wandte sich an seine Gefährtin und sagte laut: »Siehst du das? Hässliche Mädchen haben keinen Grund zu leben.« Und das Mädchen lachte, als er sie küsste. Mir war nicht danach zumute, ihn nach einem Mittwoch zu fragen. Onkel, der Bruder meiner Mutter, Jean-Baptiste de Saint-Laurent, nannte sich Chevalier de Saint-Laurent. Großmutter sagte, der Titel sei so falsch wie er selbst, aber was könne man schon von einem Wurm erwarten, der seinen Unterhalt durch Sündigen an den Spieltischen und Geldleihen bei Frauen bestritt. Er kehrte aus der Schlacht zurück und zog im Hause ein, während Vater in der Bastille war, und jetzt war es unmöglich, ihn wieder hinauszuwerfen. Er machte das Haus zu seinem Hauptquartier, wo Männer von zweifelhaftem, dem seinen gleichenden Charakter ihm ihre Aufwartung machten.
So spähte ich mittwochs hinein, in der Hoffnung, etwas interessantes Sündiges wie Isebel mit den Händen und Füßen zu sehen, aber ich sah nur Erwachsene, die sich mit anmaßenden Namen anredeten, einander hitzige Dinge sagten und aus den guten Gläsern tranken, während Mutter ihr silbriges kleines Lachen lachte, das sie dem Mittwoch vorbehielt. Sie trug ihr enges Kleid aus violetter Seide, vorne sehr tief ausgeschnitten, und ihre goldenen Armbänder mit Diamanten. Es war dies die Zeit, da sie die Herren unter ihren Wimpern hervor von der Seite ansah; die Herren priesen ihre grünen Augen und rezitierten einen improvisierten Vers, der ihre Nase oder ihre Lippen verherrlichte. Es waren wenige Damen zugegen, keine so hübsch wie sie selbst, und zahlreiche Herren, die sich wie mein Oheim in Pluderhosen mit Spitzengeriesel an den Schienbeinen, bestickte Wämser und kurze Röcke ganz aus Seide kleideten. Sie redeten viel vom Glück beim bassette oder hoca – und darüber, wen der König am vergangenen Freitag angeblickt hatte. Sie gaben vor, von Mutter betört zu sein, bis auf ein Zeichen von ihr meine große Schwester Marie-Angélique errötend hereinschwebte. Fortan war sie die einzige, die sie ansahen. Alle wussten, dass sie aus der Klosterschule nach Hause kommen musste, als Vater kein Geld mehr hatte – oder es vielmehr sparen musste, damit mein Bruder am Collège de Clermont bleiben und Advokat werden konnte, um die Familie wieder reich zu machen. Aber Marie-Angélique war so schön, dass alle sagten, Mutter werde sie ohne Mitgift vermählen.
»Zurschaustellung der Ware« nannte Vater das, wenn er sich mittwochs in seinem Studierzimmer einschloss und über die Römer las. Das tat er fast immer, wenn er zu Hause war. Dabei schnupfte er Tabak aus einem Silberdöschen, das Monsieur Fouquet ihm einst geschenkt hatte. Eigentlich wollte er nie mit jemandem reden, höchstens zuweilen mit mir.
»Warum die Römer, Vater?«, fragte ich ihn eines Nachmittags.
»Weil sie, mein Kind, uns lehren, Leid in einer ungerechten Welt zu erdulden, wo aller Glaube tot ist«, erwiderte er. »Siehst du, hier? Epictetus zeigt, dass Vernunft die Welt regiert, da sie mit Gott identisch ist.« Er zeigte auf eine Stelle in dem Buch, das er las.
»Ich kann das nicht lesen, Vater.«
»Ach ja, natürlich«, erwiderte er auf seine geistesabwesende Art. »Niemand hat sich um deine Bildung gekümmert. Ich werde wohl selbst dafür sorgen müssen. Die moderne Erziehung ist ohnehin nichts als Geschwätz und taugt nur dazu, den Geist zu versklaven. Sieh dir nur deine Schwester an – ein hohlköpfiger Fratz. Sie stickt, klimpert ein wenig auf dem Klavichord und weiß zwei Dutzend Gebete auswendig. Ihr Verstand ist ausschließlich durch das Lesen von Romanzen geformt. Und dein Bruder prägt sich juristische Präzedenzfälle ein. Er lernt Präzedenzen statt Logik und Gesetze statt Tugenden. Nein, da ist es viel besser, von den Römern zu lernen.« Und so wurde ich nach dem ausgeklügelten Plan meines Vaters von einer Reihe hungerleidender Abbés und mittelloser Studenten unterwiesen, die mit Mahlzeiten entgolten wurden, bis ich über genügend Wissen verfügte, um mit ihm über die Römer und insbesondere über seine geliebten Stoiker zu diskutieren. Die meisten meiner Tutoren verliebten sich in meine Schwester und waren nur unter großen Mühen von ihr fernzuhalten, aber davon merkte Vater nichts.
Bald schon gestalteten sich meine Tage zu einem angenehmen, wenngleich für ein Kind ungewöhnlichen Verlauf. Vormittags studierte ich, was immer meinen gegenwärtigen Tutor interessierte: Bruchstücke von Descartes, der sagte, unser Denken müsse methodisch sein, die Beweisfrage in der Geographie, die Vorstellung der Epikureer, dass wir immer das Glück anstreben sollen, oder die Idee, Gott habe die Welt präzise wie eine Uhr geschaffen, dann sei er fortgegangen und habe sie vergessen.
Nachmittags schmeichelte ich mich bei meiner Mutter ein, indem ich vertrauliche Botengänge für sie besorgte. Sie schenkte mir drei Unterkleider, aus denen meine Schwester herausgewachsen war, einen alten Kamm sowie das Versprechen eines neuen Kleides zu Weihnachten, wenn ich ihre Geheimnisse für mich behielt. Bei meinen nachmittäglichen Besorgungen erfuhr ich, dass unsere Köchin bei dem Parfümeur, der die Faltensalbe meiner Mutter zusammenrührte, Liebestränke kaufte. Ich entdeckte, dass das Gold in Mutters Haar aus einem grünen Fläschchen stammte und dass sie heimlich mit dicken wächsernen Petschaften versehene Briefe empfing. Ich fand heraus, wo es die besten verbotenen Flugschriften für Großmutter zu kaufen gab und wie man falsche von echten Münzen unterschied. Ich lernte Wechselgeld zählen und mir den Weg durch das Maraisviertel zu bahnen, ohne von Kutschen zermalmt zu werden, und mich in der Menge unsichtbar zu machen, so dass ich nicht verfolgt werden konnte. Es war keineswegs eine Erziehung, wie sie einer jungen Dame aus guter Familie anstand, die außer Haus niemals ohne Begleitung gesehen werden sollte. Aber mein missgestaltetes Äußeres und meine ungezügelten Manieren nahmen mich von allen Regeln aus, so wie sie mich auch nicht in den Genuss der Vergünstigungen meiner Geburt kommen ließen.
Abends, wenn Mutter den ergötzlichen Monsieur Courville oder den göttlichen Marquis de Livorno, den charmanten Chevalier de la Rivière oder einen anderen Wichtigtuer zu Gast hatte, diskutierte ich mit Vater über die Römer. Ich liebte es, wie er mit seiner ruhigen, tiefen Stimme vorlas und dann über seine kleine Lesebrille lugte, um eine Bemerkung über den Text zu machen. Danach zeigte ich ihm das wenige, was ich am Vormittag gelernt hatte, und wurde mit seinem schmallippigen, ironischen Lächeln belohnt. Es war ein wunderbarer Tageslauf; ich wollte kein anderes Leben.
Kapitel II
Mademoiselle, hast du das Fläschchen aus der Galerie auf meine Frisiertoilette gestellt?« Mutter hielt ihren Morgenempfang. Nichts Großartiges nach höfischem Ermessen, denke ich, dennoch warteten ihr heute mehrere Bediente in ihrem Schlafgemach auf, dazu mein neuester Tutor sowie ein Mann, den sie beauftragt hatte, Marie-Angéliques Porträt en miniature zu malen. Ich erinnere mich gut an diesen Tag. Es war einer der ersten sonnigen Tage im Frühjahr 1671; ich war im Winter gerade zwölf geworden.
»Ja, Mutter, ganz hinten, beim Spiegel. Seht Ihr es?« Mutter sah argwöhnisch zu der Stelle hin und drehte sich so plötzlich um, dass die Zofe, die ihr die Haare bürstete, die Bürste fallen ließ.
»Und das Wechselgeld? Hast du alles mitgebracht?« Ich gab es ihr, und sie zählte es sorgfältig nach, bevor sie es in der Schublade ihrer Frisiertoilette verschloss. Ich sagte ihr nicht, dass ich das Parfüm gestern Nachmittag auf dem Heimweg ausprobiert hatte. Längst konnte ich eine Phiole wieder so versiegeln, dass man nicht erkannte, dass sie geöffnet worden war. Mutter würde »Affenhände« sagen, wenn sie es gewusst hätte. Die Frau in der Parfümerie der Galerie du Palais führte alle möglichen Utensilien, die Mutter benötigte: Haarfarbe, Wangenrot und nun einen neuen Duft mit einer besonderen Ingredienz, die im Zusammenhang mit Beschwörungsformeln die Trägerin unwiderstehlich machen sollte. An wem ließe sich das besser erproben als an mir, dachte ich. Es braucht nicht viel, um eine hübsche Person unwiderstehlich zu machen, aber ein hässliches Mädchen, das nicht richtig gehen kann und dürr und klein ist wie ein Affe – da könnte es seine Wirksamkeit beweisen. Also hatte ich mich damit besprengt und mich den Rest des Tages vor meiner Mutter versteckt.
Zunächst war ich ins Turmzimmer gegangen, wo alte Kleider, von Mäusen zerfressene Kissen und reparaturbedürftige Möbel aufbewahrt werden, und hatte mein geheimes Buch hervorgeholt. Ich trug das Datum ein: 18. April 1671, und daneben: Unwiderstehliches Parfüm – Erprobung Numero 1. Danach schlüpfte ich für den Nachmittag aus dem Haus, was meiner Schwester niemals gestattet wurde; aber Vater bemerkte meine Abwesenheit nie, bis es an der Zeit war, über die Römer zu diskutieren. Und Mutter fragte nie nach mir; ich glaube gar, sie hoffte insgeheim, dass mir etwas zustoßen und ich nie zurückkommen würde. Für mich aber bedeutete die Vernachlässigung eine gewisse glückliche Freiheit, und durch mein ungezügeltes Aufwachsen mit den Dienstbotenkindern und verwahrlosten Lehrbuben, von denen es in der Nachbarschaft und im Hofe des Hauses Marmousets wimmelte, hatte ich gelernt, den Gassenjargon der unteren Klassen von Paris ebenso fließend zu sprechen wie die vornehme Sprache, deren meine Mutter und meine Schwester sich im Salon bedienten.
Ich betrat die Rue des Marmousets, wie man in einen Fluss steigt. Ich ließ mich treiben und tauchte auf und ab in der Menge der Kaufleute und Straßenbengel, den kleinen Gruppen achtbarer Frauen, die, gefolgt von ihren beladenen Bedienten, Einkäufe machten, dem vereinzelten Advokaten oder Notar, der mit seiner Ledermappe unter dem Arm dem Palais de Justice zu eilte. Hier und da schaukelte eine Sänfte im Strom, deren Insasse über die schwitzenden Rücken der Träger hinweg ins Weite starrte. Der Fluss vereinte sich mit der Hauptströmung, die sich in Richtung Pont-Neuf ergoss, und ich schlich unbemerkt, ein blasses, buckliges kleines Mädchen, das seitwärts humpelte wie ein Krebs, zwischen den Menschenmassen. Es war ein guter Tag für einen wissenschaftlichen Versuch; auf der Brücke drängten sich Bettler, Spieler, Straßenverkäufer um kleine Buden, wo billiger Tand und verbotene Schriften feilgeboten wurden.
Als erstes erstand ich bei einem Verkäufer von frommen Traktaten, der die besten Sachen unter seinem Umhang verborgen hielt, eine höchst befriedigende libelle für Großmutter, ein Gelegenheitskauf, frisch aus Holland eingeschmuggelt, wo man die besten verbotenen Pamphlete druckte: »Das skandalöse Leben von Ludwig, König der Franzosen«, worin erklärt wurde, es sei nur natürlich, dass der König wiederholt das heilige Band der Ehe zerriss, sei er doch tatsächlich der natürliche Sohn des Kardinals Mazarin, der eine Affäre mit der Königin gehabt habe. Ich versteckte es natürlich, denn die Lektüre war nahezu so gesetzwidrig wie die Veröffentlichung oder der Verkauf, und gesellte mich zu der Menge der Zuschauer und Taschendiebe um eine improvisierte Bühne. Mehrere Schauspieler mit Masken plärrten schmutzige Witze, während ein Mann, der den Liebhaber der Ehefrau darstellte, dem gehörnten Ehemann eine Lederkeule über den Schädel hieb. Ich ging weiter, als Geld gesammelt wurde, denn ich hatte keins mehr. Ein Scharlatan mit einem zerbeulten Filzhut pries singend den Inhalt einer Kiste mit Arzneien:
»Pocken, Schüttelfrost und Pestkurier’ ich euch aufs allerbest’.Leute kauft, seid klug und weise,dass lange währ’ des Lebens Reise.«
Er hatte ein Äffchen an einer Leine, in Satin gekleidet wie ein kleiner Mann. Es kam zu mir, berührte mit seiner braunen Hand die meine und sah mich mit seinen traurigen, glitzernden Augen an.
Fazit Numero 1: Das unwiderstehliche Parfüm zieht Affen an.
Ich spürte ein Zupfen hinten an meinem Umhang. Ich zog ihn so eng um mich, dass die große Hand des Diebes mich wahrhaftig in die Luft hob. Aber ich ließ nicht los; ich schrie: »Hilfe, Mörder, Räuber!«
»Gemach, gemach.« Ein junger Stutzer in einem kurzen Umhang mit mindestens einem Dutzend Bänderschleifen und einem breiten grauen Hut mit weißer Feder stieß sein Schwert gegen das Wams des Räubers. Der Grobian ließ mich fallen und floh mit der Drohung, mit seinen Freunden zurückzukommen.
Fazit Numero 2: Das unwiderstehliche Parfüm zieht Räuber an.
»Was tut ein kleines Mädchen wie du ohne Begleitung hier? Weißt du nicht, dass du getötet werden könntest? Komm, ich bringe dich nach Hause. Habe ich dich nicht aus der Maison des Marmousets kommen sehen?«
Fazit Numero 3: Das unwiderstehliche Parfüm zieht Mitgiftjäger an.
»Hihi«, lachte der blinde Bettler am Ende der Brücke. »Ich habe alles gesehen, sehr komisch, wirklich sehr komisch, Monsieur Lamotte.«
Fazit Numero 4: Das unwiderstehliche Parfüm macht Blinde sehend.
Vater hatte mir erklärt, dass ein disziplinierter Geist das Wichtigste ist, was ein Mensch besitzen kann. An diesem Abend ruhten wir von den Stoikern aus und lasen Descartes’ Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs.
»Beginne, wo wir aufgehört haben, im vierten Kapitel«, sagte Vater, »und dann erkläre, was gemeint ist.«
»›Alsbald aber machte ich die Beobachtung, dass, während ich so denken wollte, alles sei falsch, doch notwendig ich, der das dachte, irgendetwas sein müsse, und da ich bemerkte, dass diese Wahrheit ich denke, also bin ich so fest und sicher wäre, dass auch die überspanntesten Annahmen der Skeptiker sie nicht zu erschüttern vermöchten, so konnte ich sie meinem Dafürhalten nach als das erste Prinzip der Philosophie, die ich suchte, annehmen‹«, las ich. »Das bedeutet«, sagte ich, »dass im Einklang mit der geometrischen Beweismethode –«
»Schnf, schnf – was ist das für ein abscheulicher Geruch? Hier drinnen riecht es wie in einem Hurenhaus.«
»Ich habe keine Ahnung, Vater.«
Fazit Numero 5: Das unwiderstehliche Parfüm hat keine Wirkung auf Menschen mit klarem Verstand.
Ich beendete den Eintrag in mein geheimes Buch beim Licht eines Kerzenstummels. Dieses Parfüm eignet sich gut für Mutter, aber ich werde es nicht wieder benutzen. Am nächsten Morgen diskutierte ich mit meinem neuesten Tutor, einem hungerleidenden Studenten der Medizin, der in meine Schwester verliebt war, über die neue Theorie des Engländers Harvey: Das Blut werde vom Herzen, in Wirklichkeit schlicht eine Pumpe und keineswegs der Sitz der Gefühle, durch den Körper bewegt. Das zog sich bis zum Nachmittag hin, als Mutter die Zofe entließ – ein untrügliches Zeichen für einen weiteren vertraulichen Botengang.
»Meine Liebe, ich weiß, dass ich dir vertrauen kann.« Mutter wischte eine Träne fort, die auf ihrer Wimper zitterte.
»O ja, natürlich, Mutter.« Es war sichtlich ernst. Gewöhnlich verschwendete sie keine solche Zuneigung an mich.
»Kennst du den Damenschneider in der Rue Courtauvilain?« O ja, das ist der, bei dem eine Frau mit zu wenig Bargeld ein Darlehen auf ein Seidenkleid bekommen kann. Ein weiter Weg.
»Ich habe befohlen, die Pferde anzuschirren. Du wirst die Kutsche nehmen, und falls jemand fragt, du bringst diese Kleidermuster zurück. Ich möchte, dass du dies hier in dein Kleid steckst, wo es niemand sieht.« Sie hielt acht silberne Löffel vom Buffet in die Höhe – Großmutters Löffel. »Ich wünsche, dass du sie beleihst und mir das Geld so rasch wie möglich bringst. Der gute Hauptmann Legrand muss zu seinem Regiment zurück, und an wen könnte er sich wenden?« Wieder eine Träne. »Dein Vater war in alten Zeiten ein großzügiger Mann. Er hätte einen Edelmann niemals abschlägig beschieden. Aber heutzutage achtet er so scharf auf meine wohltätigen Ausgaben – dieser grässliche Leibdiener –, du verstehst, wenn er es wüsste, es würde ihm das Herz brechen. Wir dürfen ihn nicht an seine Tragödie erinnern. Kein Wort, verstehst du?« Ihre Stimme gemahnte an den stählernen Klang eines Rapiers, das aus der Scheide gezogen wird.
Ich verstand. So begab ich mich in die Rue Courtauvilain zum Geschäft des Damenschneiders Mathurin Vigoreux, wo ich im Hinterzimmer mit seiner Frau wegen der Löffel verhandelte.
»Ich bringe sie zu Jeanne in der Rue Montmartre, gegen zweiundzwanzig Francs; sie kann das Geld abholen lassen«, sagte La Vigoreux, indem sie die Löffel an ihrer Schürze rieb und ins Licht hielt.
»Sie braucht das Geld sofort.«
»In diesem Fall muss ich damit zu jemand anders, und ich kann nicht so viel bieten«, sagte sie, wog die Löffel abermals in ihrer Hand und legte sie dann auf die schmierige Schürze über ihrem ungeheuer geräumigen Schoß. Als ich nach einem kleinen Disput das Geld weggesteckt hatte, sah sie mich an und sagte: »Du bist ein merkwürdiges Mädchen. Genau wie ein altes Weib. Soll ich dir wahrsagen? Deine Mutter wird die paar Sous nicht vermissen.«
»Ich glaube nicht an Wahrsagerei«, erwiderte ich.
»Nein? Glaubst du denn nicht, dass Gott für jedermann Pläne hat? Möchtest du sie nicht erfahren?« Ihr Ton war schmeichelnd, als spreche sie zu einem dummen Kind und nicht zu einer etwas klein geratenen Philosophin.
»Gott ist, um genau zu sein, nicht an einzelnen Fällen interessiert. Er ist der primum mobile, der die Naturgesetze schuf. Er erlaubt diesen Gesetzen, alleine zu wirken. Die Entdeckung der Abfolge von Ereignissen ist somit der geometrischen Analyse unterworfen. Gemäß des Engländers Harvey Entdeckung vom Kreislauf des Blutes –«
»Mein Gott, du bist ein kleines Ungeheuer. Dann glaubst du wohl auch nicht an den Teufel?«
»Natürlich nicht. Der Teufel ist eine Phantasiegestalt, die Priester erfunden haben, um die Unwissenden zu ängstigen.« Wie mein Vater verachtete ich abergläubische Weiber.
La Vigoreux lachte. »Nicht lange, Kleine, und du wirst etwas Anderes entdecken.«
Hiernach schien es mir nur recht und billig, zwei Francs als meinen Anteil an den Löffeln, die Großmutter mir vererbt haben würde, einzubehalten. Als die Kutsche eingestellt war, ging ich zur Galerie du Palais, nicht weit von unserem Haus, und kaufte am Stand eines Schreibwarenhändlers ein weiteres kleines rotes Notizbuch. Er verkaufte mir zudem aus einer gut versteckten Schachtel eine vorzügliche libelle, für ihr Geld recht umfangreich, mit dem Titel »Die schauerlichen Geheimnisse der päpstlichen Giftmischer«. Hier waren im Detail sämtliche Methoden aufgezählt, deren sich die ehrgeizigen Italiener in alten Zeiten bedienten, um sich ihrer Rivalen zu entledigen, und es wurde erklärt, wie die italienische Königin sie nach Frankreich gebracht hatte. In Holland gedruckt, allerbeste Qualität. Ich kaufte sie für Großmutter.
An diesem Abend schrieb ich in mein Büchlein:
Im Laufe des Sommers wurde Mutter immer unruhiger. Ihre Haare wurden gelblich, oft ging sie mit einer Schmiere von seltsamer Farbe im Gesicht zu Bett. Vater ging häufig zum Palais de Justice, und das nicht nur, um Luft zu schnappen. Wenn er zurückkam, mochte er nicht einmal über die Römer sprechen. Onkel brummte und wütete und verschwand wochenlang in den Spielsälen der Palais im Marais. Mutters Mittwoch wurde spärlicher besucht, ungeachtet der Reize von Marie-Angélique, die von Schäferinnen handelnde beliebte Weisen darbot. Nur Großmutter war glücklich; sie saß im Bett und las wieder einmal von der Zerstörung von Sodom und Gomorrha.
»Vergiss nicht, Geneviève, so werden die Ruchlosen bestraft. Mit Feuer und Schwefel.« Ihre kleinen schwarzen Augen blitzten vor Vergnügen, ihr Papagei krächzte: »Feuer! Feuer! Feuer und Schwefel!« und wippte mit seinem grünen Kopf.
Nachdem Mutter die zuversichtlichen Verheißungen der kleinen Hutmacherin, die ihre Horoskope erstellte, erschöpft hatte, beschloss sie endlich, eine Spezialistin zu konsultieren. Sie verschaffte sich bei dem Parfümeur in der Galerie du Palais eine Referenz für die vornehmste Wahrsagerin von Paris. Und an einem heißen Augusttag in meinem zwölften Lebensjahr ließ sie die Pferde anschirren und fuhr mit uns beiden über den Pont-Neuf, an den Hallen und dem Cimetière des Innocents vorbei, an den äußersten Rand von Paris, unmittelbar unter den Festungswällen bei der Porte St. Denis. Wir gelangten in ein Viertel namens Villeneuve-sur-les-Gravois, das hauptsächlich aus anmutigen, von großen Gärten umgebenen Villen bestand. Ungeachtet des schönen Ambientes lagen nahebei berüchtigte Bordelle und Spielsäle, die den Ruf der Nachbarschaft verunglimpften. Mutter hieß den Kutscher in der Rue Beauregard anhalten, wo wir eine maskierte Dame beobachteten, die aus einem Haus zu einer wartenden Kutsche schlich. Acht Pferde, Bedienstete in voller Livree. Die Malerei auf dem Wagenschlag sah von weitem wie ein herzogliches Wappen aus. Die Dame erteilte Befehle, und die Kutsche fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon, um ein Haar eine Gruppe lungernder Träger verfehlend, die neben zwei leeren Sänften auf weitere Kundinnen der Wahrsagerin warteten. Mutter blickte selbstzufrieden drein: Sie liebte es, zur eleganten Kundschaft zu gehören. Und so überschritt sie, ohne sich dessen bewusst zu sein, die unsichtbare Grenze zum Reich der Schatten.
Nach kurzer Wartezeit in einem Vorzimmer, wo Mutter in der Hitze saß und sich fächelte, während das Gelb aus ihren feuchten Haaren an ihrem Hals hinunterrann, wurden wir von einem gutgekleideten Stubenmädchen in das Empfangszimmer der Wahrsagerin geführt. Wände und Decke waren schwarz gestrichen; flackernde Kerzen vor einer Gruppe von Gipsheiligen in einer Ecke gaben ein trübes Licht. Die Blendläden waren geschlossen, um die Hitze abzuhalten, aber die schwarzen Vorhänge waren zurückgezogen. In einer anderen Ecke stand eine Statue der Madonna im blauen Gewand. Vor ihr brannte eine dicke Kerze, und von einer Vase mit Blumen ging ein süßlicher Geruch aus. In einer offenen Vitrine neben einem Schrank stand eine Reihe verschiedener Porzellanengel. Das trübe Licht ließ ihre Gesichter bedrohlich aussehen. Ein dicker Teppich bedeckte den Fußboden. In der Mitte des Raumes stand ein kleiner, erlesen geschnitzter Tisch mit einem Lehnstuhl für die Wahrsagerin auf der einen Seite und einem gepolsterten Schemel für die Klientin auf der anderen. Wir setzten uns erwartungsvoll auf Stühle, die unter den Porzellanengeln angeordnet waren.
»Sie wird eine Vettel sein«, flüsterte Marie-Angélique mir zu. Ihre blauen Augen waren geweitet, ihr hochaufgetürmtes goldenes Haar bildete einen schimmernden Heiligenschein über ihrem schönen Antlitz. »Ganz bestimmt. Und ach, was soll ich Père Laporte sagen? Er heißt Wahrsagerei nicht gut.« Und ich heiße nicht gut, einen Beichtvater zu haben statt eines Gewissens. Ich war sehr stolz auf mein Gewissen, das durch die Entdeckung der Gesetze der Tugend anhand des Vernunftgebrauchs geprägt worden war.
Doch die Frau, die das Stubenmädchen durch die Innentüre führte, war ganz und gar nicht, was Marie-Angélique erwartet hatte. Sie sah wie eine Dame aus, in smaragdgrüner Seide über einem schwarzen, bestickten Unterkleid. Ihr schwarzes Haar war nach der neuesten höfischen Mode zu Locken frisiert und mit Brillanten geschmückt. Ihr Gesicht war blass und edel, mit breiter Stirn, langer, klassischer Nase und einem schmalen, zierlichen Kinn. Sie hatte ein seltsames, schmallippiges Lächeln, spitz zulaufend wie ein V. Ich spürte, dass ihre Erscheinung Mutter und Marie-Angélique zusagte. Sie verdient viel Geld in diesem Gewerbe, dachte ich.
Ich betrachtete sie sehr genau, als sie Platz nahm, denn einer meiner Tutoren hatte mir erklärt, dass man als gebildeter Mensch den Charakter von Personen aus ihren Gesichtszügen und ihrer Haltung herauslesen könne. Die Hellseherin war wohl an die dreißig Jahre alt, ihre Miene war selbstsicher, und ihre ernsten, schwarzen Augen schienen allwissend. Ihre gesamte Erscheinung hatte eine kraftvolle Aura, und als sie sich auf ihren mit Brokat gepolsterten Lehnstuhl setzte, war ihre Haltung majestätisch, als sei sie die Königin dieser geheimen Welt, die ab und an Bittsteller von einem geringeren Ort einließ. Wir wollen sehen, was sie zu sagen hat, dachte ich. Wir werden sehen, wie klug sie ist.
»Guten Tag, Madame Pasquier. Ihr seid gekommen, um zu erfahren, welches Eheglück Euren Töchtern beschieden sein wird.« Mutter schien beeindruckt. Ihr Fächer hielt in der Bewegung inne. Ein logischer Schluss, wenn eine Frau mit zwei Töchtern im Schlepptau daherkommt, dachte ich. Die Frau ist gerissen. Nach Austausch einer Reihe von Schmeicheleien und Artigkeiten wurde Marie-Angélique vorgeschoben, um am Tisch unmittelbar gegenüber der Wahrsagerin Platz zu nehmen. Die berühmteste Hellseherin von Paris nahm ihre Hand.
»Eure Familie hat Unbilden erlitten«, sagte sie, während ihre Finger über den Handteller meiner Schwester fuhren. »Ihr seid nach Hause geholt worden, aus – ah, ja –, aus einer Klosterschule, aus Geldmangel. Die Mitgift ist – ah – geschwunden. Aber Ihr werdet den größten Traum Eurer Mutter erfüllen. Ein Liebhaber von höchstem Stand – ein Vermögen. Aber hütet Euch vor dem Mann im himmelblauen Rock. Vor dem, der eine blonde Perücke trägt.« Bravo, gut gemacht. Die Hälfte der elegantesten Herren von Paris dürfte einen himmelblauen Rock und eine blonde Perücke haben.
Mutter lächelte triumphierend, doch Marie-Angélique brach in Tränen aus. »Seht Ihr keine Heirat für mich, keine Kinder? Ihr müsst besser hinsehen, oh, seht noch einmal hin!« Schlau, dachte ich. Zuerst diejenige zufriedenstellen, die bezahlt. Aber wie will sie dieses Problem umgehen?
»Ich sehe nicht immer das vollständige Bild«, sagte die Wahrsagerin mit einschmeichelnder Stimme. »Ein Kind? Ja. Ich denke schon. Und nach dem Mann im himmelblauen Rock könnte es eine Hochzeit geben. Aber ich kann nicht über ihn hinaussehen. Vielleicht solltet Ihr mich in ein paar Monaten noch einmal konsultieren, wenn die fernere Zukunft deutlicher wird.« Sehr gerissen. Marie-Angélique würde vor Weihnachten heimlich wiederkommen, mit jedem Sou, den sie erbetteln oder borgen konnte, ungeachtet aller Ermahnungen von Père Laporte.
Mutter war jetzt so ungeduldig, ihr eigenes Schicksal zu erfahren, dass sie Marie-Angélique beinahe von ihrem Sitz stieß. In vertraulichem Ton flüsterte die Hellseherin, was eigentlich nicht für meine Ohren bestimmt war. »Euer Gemahl versteht Euch nicht. Ihr ergreift tausend Sparmaßnahmen für sein Glück, und er erkennt nicht eine an. Er ist ohne Ehrgeiz und weigert sich, bei Hofe um die Gunst zu ersuchen, welche Euer Glück erneuern könnte. Fürchtet Euch nicht, Euch lachen neue Freuden.« Ein freudiger Ausdruck huschte über Mutters Gesicht. »Wenn Ihr dieses Glück beschleunigen wollt«, die Wahrsagerin dämpfte die Stimme, »jugendlicher –«, verstand ich und sah sie eine kleine Phiole aus der Tischschublade nehmen. Mutter verbarg sie in ihrem Korsett. Ausgezeichnet, dachte ich. Wann hatte Mutter je ein Mittel zurückgewiesen, das die Wiedererlangung ihrer schwindenden Jugend verhieß? Wenn all diese Salben tatsächlich wirkten, müsste, gemessen an der Anzahl Leute, die sie verkauften, ganz Paris Gesichter haben, so glatt wie Kinderpopos. »Wenn er hart und gleichgültig bleibt – bringt mir sein Hemd – eine Messe für Sankt Rab boni –« Faszinierend. Ein einziger Besuch vervielfacht sich zu mehreren, mit der entsprechenden Vergütung.
»Und nun zu meinem Kreuz, das ich täglich zu tragen habe«, sagte Mutter. Damit stand sie auf und schob mich nach vorn. »Sagt uns, was aus einem Mädchen wird, dessen Herz so entstellt ist wie sein Körper. Versichert mir, dass sie in der Salpêtrière enden wird.« Mutter stieß ein leises Lachen aus, um zu zeigen, dass dies ein Scherz von ihr sei. Es war aber kein Scherz. Sie sagte mir ständig, dass ich dort enden würde. Zuweilen hatte ich sogar Alpträume, denn sie hatte mich zur Warnung einmal mitgenommen, damit ich eine Fuhre mit eingekerkerten kahlgeschorenen Prostituierten sähe. Es war ein abstoßendes Gebäude, ein »Spital«, wo Bettler, Diebe und weibliche Irre eingesperrt wurden, um die Straßen sauber zu halten. Und nach Aussage eines meiner klatschsüchtigen Tutoren statteten sonntags Geistliche mit glitzernden Augen den Insassen Besuche ab, um sie zur Rückkehr in ein tugendhaftes Leben zu ermahnen. Nicht gerade das, was mir für meine Tochter vorschweben würde, wenn ich eine hätte.
Die Hellseherin betrachtete zuerst Mutter, dann mich mit abschätzendem Blick. »Was Ihr wirklich wissen wollt«, äußerte sie kühl, »ist, ob das Kind Geld erben wird – im Ausland verstecktes Geld.« Das hatte ich nicht erwartet. Ich sah der Wahrsagerin ins Gesicht. Sie musterte mich eindringlich, als ob sie Maß nähme. Dann inspizierten ihre dunklen Augen meinen schwitzenden Handteller.
»Das ist ungewöhnlich«, sagte sie, und Mutter und Marie-Angélique rückten näher, um es zu sehen. »Seht Ihr die Linie, die hier aus Sternen gebildet ist? Einer bedeutet Vermögen. Drei – das ist ganz außergewöhnlich. Es ist ein sehr machtvolles Zeichen.« Selbst die Wahrsagerin schien beeindruckt. Es war sehr erfreulich.
»Ein Vermögen, ein ungeheures Vermögen«, zischte Mutter. »Ich habe es gewusst. Aber ich muss es genau wissen. Erbt sie es? Aus dem Ausland?«
»Sternengebilde auf dem Handteller lassen nie die Art des Vermögens erkennen, nur dass es große Veränderungen mit sich bringt und dass am Ende alles gut wird. Ihr benötigt eine genauere Weissagung, um Eure Frage zu beantworten – eine Weissagung durch Wasser. Für die Bereitung des Wassers wird eine Extragebühr erhoben.« Mutters Mund schloss sich fest wie ein Portemonnaie. »Nun gut«, sagte sie mit gereizter Miene. Die Wahrsagerin klingelte mit einem Glöckchen, und als das Stubenmädchen erschien, beriet sie sich mit ihr. »Die Gabe der Wasserweissagung ist sehr selten und gewöhnlich nur bei jungfräulichen Mädchen zu finden – und daher währt sie in dieser verruchten Welt nicht lange, nicht wahr?« Ihr sarkastisches Lachen wurde von Mutters silbrigem »Salon«-Lachen ergänzt. Ich wünschte, wir könnten jetzt gehen. Ich hatte genug.
Das Stubenmädchen kehrte mit einem gläsernen Rührstab und einer mit Wasser gefüllten runden Kristallvase auf einem Tablett zurück. Sie wurde von einem adrett gekleideten Mädchen in meinem Alter begleitet, mit streng zurückgekämmten braunen Haaren und mürrischer Miene. Die Tochter des Hauses.
Die Wahrsagerin rührte das Wasser mit dem Stab, wobei sie etwas sang, das wie »Mana, hoca, nama, nama« klang. Dann sagte sie zu mir: »Leg deine Hände um das Glas – nein, nicht so. Ja, gut. Jetzt nimm sie fort.« Das kleine Mädchen spähte in die von meinen Handabdrücken verschmierte Vase, und das Wasser wurde wieder ruhig.
Sie hatten etwas sehr Interessantes mit dem Wasser angestellt. Ein winziges Bild schien sich aus der Tiefe zu lösen, deutlich und hell wie das Spiegelbild eines unsichtbaren Gegenstandes. Es war ein Gesicht. Das liebreizende Gesicht eines Mädchens von etwa zwanzig Jahren. Graue Augen starrten mich an, schwarze Haare umwehten ein blasses Antlitz, der Wind peitschte einen dicken grauen Umhang, den das Mädchen eng um sich raffte. Es lehnte an der Reling eines Schiffes, das auf einem unsichtbaren Meer schaukelte.
Die Wahrsagerin sprach zu ihrer Tochter: »Nun, Marie-Marguerite, was siehst du?«
»Das Meer, Mutter.«
»Wie habt Ihr das gemacht, dass das kleine Gesicht erschien?«, fragte ich, ohne zu überlegen. Die unergründlichen Augen der Wahrsagerin betrachteten mich eine Ewigkeit, wie mich dünkte.
»Das Vermögen kommt aus dem Ausland«, wandte sich die Wahrsagerin an Mutter. »Aber erst in vielen Jahren.«
»Aber was bedeutet das Gesicht?«, unterbrach Marie-Angélique.
»Nichts. Sie hat nur ihr Spiegelbild gesehen, weiter nichts«, sagte die Wahrsagerin unwirsch.
»In vielen Jahren?«, erklang Mutters silbriges Lachen. »Ich werde es gewiss viel früher aus ihr herauspressen. Liebes kleines Tröpfchen«, setzte sie bedachtsam hinzu und versetzte mir mit ihrem Fächer einen spielerischen Klaps, damit jeder wisse, dass alles nur Scherz war.
Spät am Abend schrieb ich in mein Büchlein:
12. August 1671. Cathérine Montvoisin, Rue Beauregard, Wahrsagerin, Versuch Numero 1.
Marie-Angélique – ein reicher Liebhaber, Achtung vor Mann in himmelblauem Rock und blonder Perücke, vielleicht ein Kind.
Mutter – Jugendsalbe. Linien über die nächsten drei Wochen beobachten. Bald große Freude.
Ich – Geld im Ausland.
Ein Gedanke: Schöne Frauen fürchten das Alter mehr als hässliche. Wenn ich alt bin, kaufe ich Bücher, keine Faltensalbe.
Nachdem ich am Abend mit Vater über Seneca diskutiert hatte, fragte ich ihn, was er von Wahrsagerinnen halte.
»Meine liebe Kleine, sie sind die Zuflucht der Leichtgläubigen und Abergläubischen. Ich würde gerne sagen, der Frauen, aber es laufen auch viele Männer zu ihnen. Sie alle sind Dummköpfe.«
»Das meine ich auch, Vater.« Er nickte erfreut. »Aber sagt mir, ist es möglich, Bilder im Wasser zu sehen, wie es beschrieben wird?«
»O nein. Es sind nur Spiegelbilder. Manchmal können sie es mit Hilfe von Spiegeln so aussehen lassen, als würden sie aus dem Wasser oder einer Kristallkugel oder was auch immer hervorscheinen. Wahrsagerei ist fast nur Geschicklichkeit mit den Händen, wie bei den Zauberern auf dem Pont-Neuf.«
»Ja, das leuchtet ein. Es überrascht mich, dass die Menschen so leichtgläubig sind. Aber wie kommt es, dass sie die Geheimnisse und die Handschrift der Leute zu kennen scheinen?«
»Es klingt, als hättest du gut nachgedacht. Es freut mich, dass du das Licht der Vernunft auf das Dunkel von Schurkerei und Aberglauben richtest. Doch als Antwort sollst du wissen, dass Wahrsagerinnen eine verschlagene Brut sind. Sie unterhalten ein Netz von Zuträgern, so dass sie über das Kommen und Gehen ihrer Kundschaft unterrichtet sind. Damit setzen sie die Einfältigen in Erstaunen.«
»Das erklärt alles, Vater. Aber ich habe noch eine Frage, die ich mit Hilfe der Römer zu lösen versucht habe. Ist es besser, klug zu sein oder schön?« Vater sah mich lange an.
»Klug natürlich, meine Tochter, denn Schönheit vergeht geschwind, und ihr Besitz lohnt nicht. Die Römer glaubten, dass eine tugendhafte Frau keine andere Zierde nötig hat.«
»Aber Vater, so hieß es von Cornelia, deren Söhne ihre Edelsteine waren; denkt Ihr denn nicht, sie musste wenigstens ein bisschen hübsch sein, um überhaupt zu heiraten und die Söhne zu bekommen? Ich meine, bleibt Tugend bei einem unansehnlichen Mädchen nicht ziemlich unerkannt?«
»Mein liebes, liebes Kind, vergleichst du dich wieder mit deiner Schwester? Sei versichert, für mich bist du viel schöner. Deine Gesichtszüge sind wie die meinen, der einzige Beweis, den ich für meine Vaterschaft habe.« Die Verbitterung in seinem Gesicht erschütterte mich.
Doch noch Tage danach sang mein Herz: »Nicht hübsch, aber etwas Besonderes. Vater hat mich von allen am liebsten.« Mein Geheimnis. Nichts konnte es mir nehmen. Ich musste nicht einmal in mein Büchlein schreiben.
Kapitel III
Komm her, Geneviève, schau, da draußen steht er wieder.« Marie-Angélique hob den Vorhang in ihrer Schlafkammer und winkte mich herbei. Ich legte meinen Skizzenblock beiseite, und gemeinsam spähten wir in den dunstigen Frühlingsmorgen hinaus. Gegenüber hoben Obstbäume mit dicken Knospen, kurz vor der Blüte, ihre Äste über die Gartenmauer. Und dort, in einem Torweg auf der anderen Straßenseite, erblickte der Mann unsere Gesichter und starrte hinauf, als wolle er sich die Szene einprägen. »Er kommt jeden Tag. Was glaubst du, was er will?« Marie-Angéliques Gesicht war freudig gerötet. Ich sollte aussprechen, was sie längst dachte.
»Er ist wohl in dich verliebt.« Der Ärmste. Hunderte kamen vor ihm. Der schwere Duft der Narzissen in der Vase an Marie-Angéliques Bett füllte das Zimmer mit Frühlingsahnung. Neben der Vase lag auf der kleinen Nachtkonsole ein Exemplar von »Clélie« mit einem bestickten Lesezeichen. Marie-Angélique liebte Romanzen. Sie waren der Maßstab ihres Lebens; eine Szene in der Wirklichkeit wurde danach beurteilt, wieweit sie jener Szene entsprach, in der Aronce Clélie seine Liebe erklärt oder Cyrus Mandane auf sein Luxusschiff entführt. »Angenommen, Marie-Angélique, Cyrus hatte ein schäbiges kleines Boot, was würdest du dann denken?«, hatte ich sie einmal gefragt. »Ach, Geneviève«, erwiderte sie, »Mademoiselle Scudéry hätte sich so etwas Unpoetisches nicht einmal vorstellen können.« Sie hatte missbilligend geschaut, und dann hatten ihre Züge sich aufgehellt. »Es sei denn natürlich, er war nur verkleidet und gab sich dann in seinem sagenhaften Juwelenpalast zu erkennen, so wie sie vorher erklärt hatte, sie werde ihn niemals lieben, weil ihr Herz Cyrus allein gehöre. O ja, das wäre auch wundervoll.« Arme Wirklichkeit – sie kam immer zu kurz im Vergleich mit den albernen Sachen, die Marie-Angélique las. Ich las damals mit meinem Vater Herodotos.
»Oh, glaubst du wirklich, er ist verliebt?«, fragte sie entzückt. »Wie lange steht er schon da? Drei Tage?«
»Nein, fast eine Woche.«
»Oh, das ist schrecklich poetisch. Sag, sieht er nicht nett aus?« Das muss der Frühling sein, dachte ich. Im Frühling verliebt sich jedermann in Marie-Angélique. Ich spähte abermals für sie hinaus. Er trug hohe Stiefel, ein kurzes, mit Bändern geschmücktes Wams, einen Degen mit einem bestickten Gehänge und einen kurzen Umhang, den er theatralisch zurückgeschlagen hatte. Sein Hut saß im kecken Winkel über seinem hageren Gesicht, aber sein Schnurrbart sah trotz der stark gewichsten Spitzen aus, als sei er der allererste, der ihm je gewachsen war. Er hatte zuvor älter ausgesehen, an dem Tag, als er mich nach Hause begleitet hatte und ich Mutters Parfüm trug. Heute aber schien er meinem erfahrenen fünfzehnjährigen Auge allerhöchstens neunzehn zu sein. Der Mitgiftjäger. Stutzerhaft wie eh und je, nun aber hoffnungslos verliebt.
»Wer mag es wohl sein?«, fragte Marie-Angélique verträumt. »Er trägt gar keine Spitzen – oh, sehe ich da einen Ring? Nein – aber vielleicht hat er sich verkleidet.« Marie-Angélique war stets zuversichtlich.
»Ich habe ihn einmal gesehen, als ich mit Vater im Jardin du Luxembourg war. Er hat gelesen«, sagte ich.
»Ach, ein Student.« Marie-Angélique klang enttäuscht. »Aber vielleicht ist er ein Prinz, der Verantwortung zu tragen lernt, bevor er sein Amt antritt.«
»Ich glaube, sein Name ist Lamotte.«
»O nein«, erwiderte Marie-Angélique. »Lass den Vorhang lieber sogleich herunter, Geneviève. Mutter leidet es nicht, wenn wir fremde Männer anstarren.« Ich ließ den Vorhang fallen und griff zu meinem Skizzenblock. Und zwischen die pflichtschuldigst kopierten Blumen, die mir mein Zeichenlehrer aufgegeben hatte, zeichnete ich Lamottes junges Profil. Darunter schrieb ich: »Du sollst keine fremden Männer ansehen«, und zeigte es Marie-Angélique, die in Lachen ausbrach.
»Schwester, was soll ich nur mit dir machen? Du wirst niemals Anstand und Schicklichkeit lernen!« Ich lächelte, weil ich sie so fröhlich sah.
»Kommt, kommt, Mesdemoiselles, worauf wartet ihr?« Mutter eilte in ihrem Umhang herbei, einen Korb mit Kuchen, Obst und kleinen Törtchen am Arm. »Ich habe schon nach einer Kutsche geschickt, sie muss gleich hier sein. Ihr seid keine Kinder mehr – es wird höchste Zeit, dass ihr christliche Verantwortung lernt.« Nein, wir waren keine Kinder mehr; es war das Frühjahr 1674. Ich war fünfzehn geworden, und Marie-Angélique war neunzehn, alt genug zu heiraten, wenn sie eine anständige Mitgift hätte. Mutter sah geschäftig aus. Wohltätigkeit war ihre neueste Marotte. Nun stattete sie den armen Kranken im Hôtel-Dieu, dem Wohlfahrtsspital am Platz nahe der Kathedrale Notre-Dame, allwöchentlich Besuche ab und brachte ihnen Almosen. Dies war der letzte Schrei, und Mutter liebte es, mit der Mode zu gehen. Zudem konnte man Damen der höchsten Stände begegnen, die in den Steinsälen des Hôtel-Dieu Wunden verbanden und Süßigkeiten verteilten; es kam beinahe einem Besuch in St. Germain oder Versailles gleich und war weitaus bequemer.
Die Wohltätigkeitsmarotte war aufgekommen, kurz nachdem Vaters Gläubiger sich unserer Kutsche und Pferde bemächtigt hatten. Anfangs schien es mir gar nicht zu Mutter zu passen, die über Bettler die Nase rümpfte und sehr spärliche Trinkgelder gab. Doch schließlich war es große Mode, und sie ging ihre Wohltätigkeitsmissionen mit derselben energischen Hartnäckigkeit an, die sie in ihrem Salon walten ließ. Um die Gerüchte von einem schwindenden Vermögen zum Schweigen zu bringen, wollte sie nicht zu Fuß angetroffen werden, und sie achtete darauf, dass die Damen der Familie Pasquier gut gekleidet, mit vollgepackten Körben, Segenswünsche murmelnd, von Bett zu Bett gehend, mit den anderen aristokratischen Engeln der Barmherzigkeit gesehen wurden.
Jede von uns fand etwas Lohnendes in diesen Ausflügen. Noch Tage später ergötzte sich Marie-Angélique in Gedanken an die schönen Bänder der Marquise von Soundso oder der neuen Frisur der Comtesse Von-und-zu, und ich machte Einträge in mein Büchlein. Ich überprüfte zu jener Zeit die Gültigkeit der Religion durch Anwendung der geometrischen Methode, um die Wirksamkeit von Gebeten zu bewerten. Zuerst schrieb ich die Krankheiten derer auf, die wir besuchten, sowie die Wahrscheinlichkeit ihrer Genesung. Dann versuchte ich anhand eingehender Befragungen zu ermitteln, wie viele Gebete in jedem Fall verrichtet worden waren. Dies tat ich, indem ich die Anzahl der Verwandten mit einer Zahl zwischen eins und fünf multiplizierte, je nachdem, wie beliebt die Person bei ihrer Familie war. Danach schrieb ich auf, ob die Person die Voraussage überlebte oder nicht. Das Unterfangen befriedigte mich vollkommen. Schließlich ist der Gebrauch des geordneten Denkens zur Entdeckung der Wahrheit die erhabenste Beschäftigung der Menschheit.
Es tat Mutter gut, wohltätig zu sein; es machte sie ruhiger. An dem Tag, als uns die Kutsche genommen wurde, war sie kreischend durchs Haus gerast, hatte gegen die offene Türe von Vaters Studierstube geschlagen, wo er und ich über Epictetus diskutierten, und ihn mit Beschimpfungen überhäuft. Er sah zu ihr auf, wie sie vor seinem Lehnstuhl stand, und seine Augen bewegten sich sehr, sehr langsam, mit einem Blick, den ich nie vergessen werde
»Madame, ich überlasse Euch Euren Treulosigkeiten, überlasst Ihr mich meinen Philosophen.«
»Eure – Eure Dummheiten, Euer Mangel an Ehrgeiz, Eure Weigerung, Euch bei Hofe sehen zu lassen, meine Petitionen vorzutragen – Eure Römer haben mich erniedrigt. Sie haben mich in diese Lage gebracht, das ist mehr, als ich ertragen kann.«
Vater sprach mit äußerster Ruhe: »Der Tag, an dem ich bei Hofe erscheine, wird der sein, an dem ich den König ersuche, Euch für Euer skandalöses Leben in ein Kloster zu sperren. Geht, Madame, und stört mich nicht länger.« Er schlug Epictetus an der Stelle wieder auf, die er mit seinem Lesezeichen markiert hatte.
Mutter stand still, ganz weiß, die Augen halb geschlossen. »Ihr langweilt mich ungemein«, sagte sie kalt und entfernte sich, die Schleppe ihres blassgrünen seidenen Morgenrocks mit der Hand anhebend.
Danach fuhr sie für den Rest des Tages in einer Mietsänfte davon. Doch nicht lange danach entdeckte sie die Wohltätigkeit, und alles war wieder ruhig. Nur ihr Mittwoch schien noch ausgelassener denn je. Und Marie-Angélique war dort jetzt der Mittelpunkt. Manchmal spielte sie auf dem Klavichord, und manchmal beteiligte sie sich am Gespräch, während die Herren ihr Komplimente zollten. Einmal erspähte Mutter mich an der offenen Türe, als ich Marie-Angélique beim Spielen zuhörte, und wies mit ihrem geschlossenen Fächer auf mich.
»Mein lieber Chevalier«, hörte ich Mutter sagen, als sie charmant den Kopf neigte, »manche Männer halten Hunde; mein Ehemann aber hält sich einen Affen.« Und ihr silbriges Lachen erklang hell über dem tiefen männlichen Gelächter. Ich hatte gedacht, jemand in meinem Alter könne über dergleichen nicht mehr weinen, aber das war ein Irrtum. Zum Glück war Großmutter wach, und sie las mir von den Leiden der Jungfrau vor, die mit meinem Fall nicht viel gemein hatten, aber zumindest eine Ablenkung waren.