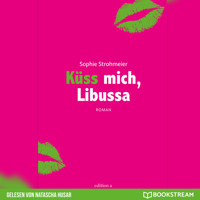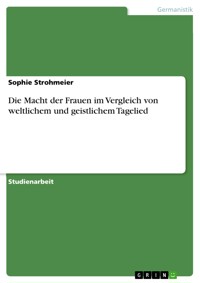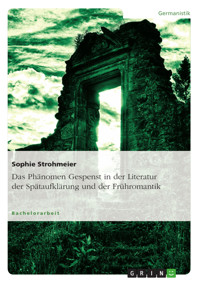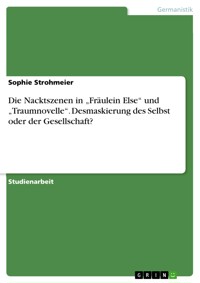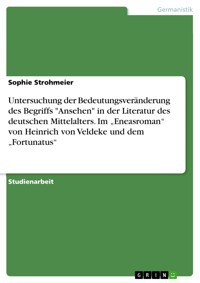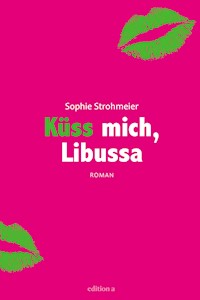Die Hilfe der Götter im Vergleich der Eneas-Erzählungen von Vergil und Heinrich von Veldeke E-Book
Sophie Strohmeier
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,0, Ludwig-Maximilians-Universität München, Sprache: Deutsch, Abstract: Vergils „Aeneis“, Heinrich von Veldekes „Eneas“ und dessen französische Vorlage der „Roman d’Eneas“ waren zu Ihrer jeweiligen Erscheinungszeit richtungsweisende Werke für die Literatur ihrer Kulturen sowohl der römischen, als auch dem europäischen Mittelalter. Die Intention, von Vergil sein 12-bändiges Hauptwerk in Anlehnung an Homers „Ilias“ und „Odyssee“ zu schreiben, ist uns heute bekannter als die Hintergründe der beiden Eneas-Romane des Mittelalters. Vergils Werk gilt nicht nur als Inbegriff der antiken Klassik zur Zeit von Kaiser Augustus, ist Geschichte und Sicherung des Machtanspruchs der Herrscherfamilie zugleich, sondern auch seine Tradierung war Epochen und Kulturen übergreifend. Vielleicht war das auch einer der Gründer für den anonymen französischen Autor diesen kanonischen Stoff auszuwählen, in seine Volkssprache zu übertragen und damit eines der ersten und wichtigsten weltlichen Bücher zu erschaffen, dessen Stoff sich kurze Zeit später auch Heinrich von Veldeke bediente, um im deutschsprachigen Raum ebenfalls Maßstäbe für die entstehende weltliche Literatur zu setzen. Bei der Aneignung des antiken Stoffen wurde, wie im Mittelalter üblich, die antike Welt der eigenen, d.h. der der Autoren und des adligen Laienpublikums, angepasst. Eneas und seine Mitstreiter, sowie seine Feinde hätten sich etwa hundert Jahre später ebenso gut im Umkreis der Tafelrunde aufhalten und die ritterlichen Tugenden verbreiten können. Genauso wegweisend für spätere Literatur sind die vom französischen Autor erweiterten und neueingeführten Minneepisoden. Wie bereits angesprochen, bereiten also die beiden mittelalterlichen Werke sowohl inhaltlich, als auch formal den Weg für eine neue weltliche, unterhaltende und belehrende Literatur. Doch so klassisch die „Aeneis“ von Vergil auch nachwirken mag, die Adaption im Mittelalter hat den Autoren doch merkliche Schwierigkeiten bereitet. Die Geschichte von Eneas ist auch außerhalb der einschlägigen Literatur weit verbreitet und spaltet sich bereits in zwei Lager. Das Problem der Wahrnehmung, vor allem der des Helden Eneas, war die historische Wahrheit der Geschichte, die bereits bei Homer stark angezweifelt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
A) Adaption des Eneas-Stoffes im höfischen Roman
B) Hilfe der Götter als Hindernisse für Eneas
I. Eneas‘ Flucht aus Troja
II. Eneas‘ Beziehung zu Dido
III. Anspruch auf Italien
IV. Hilfe von Euander
V. Rüstung von Vulcan
VI. Die ungewollte Flucht von Turnus
C) Vergleich ausgewählter Textstellen des Eneas-Roman von Veldeke und dem „Roman d’Eneas“
I. Der Kuss von Ascanius
II. Vorwurf der Sodomie an Eneas
D) Intentionsunterschiede des antiken und des mittelalterlichen Eneas-Romans
E) Literaturverzeichnis
A) Adaption des Eneas-Stoffes im höfischen Roman
Vergils „Aeneis“, Heinrich von Veldekes „Eneas“ und dessen französische Vorlage der „Roman d’Eneas“ waren zu Ihrer jeweiligen Erscheinungszeit richtungsweisende Werke für die Literatur ihrer Kulturen sowohl der römischen, als auch dem europäischen Mittelalter. Die Intentionen von Vergil sein 12 bändiges Hauptwerk in Anlehnung an Homers „Ilias“ und „Odyssee“ zu schreiben, sind uns heute bekannter als die Hintergründe der beiden Eneas-Romane des Mittelalters. Vergils Werk gilt nicht nur als Inbegriff der antiken Klassik zur Zeit von Kaiser Augustus, ist Geschichte und Sicherung des Machtanspruchs der Herrscherfamilie zugleich, sondern auch seine Tradierung war Epochen und Kulturen übergreifend. Vielleicht war das auch einer der Gründer für den anonymen französischen Autor diesen kanonischen Stoff auszuwählen, in seine Volkssprache zu übertragen und damit eines der ersten und wichtigsten weltlichen Bücher zu erschaffen, dessen Stoff sich kurze Zeit später auch Heinrich von Veldeke bediente, um im deutschsprachigen Raum ebenfalls Maßstäbe für die entstehende weltliche Literatur zu setzen. Bei der Aneignung des antiken Stoffen wurde, wie im Mittelalter üblich, die antike Welt der eigenen, d.h. der der Autoren und des adligen Laienpublikums, angepasst.[1] Eneas und seine Mitstreiter, sowie seine Feinde hätten sich etwa hundert Jahre später ebenso gut im Umkreis der Tafelrunde aufhalten und die ritterlichen Tugenden verbreiten können. Genauso wegweisend für spätere Literatur sind die vom französischen Autor erweiterten und neueingeführten Minneepisoden. Wie bereits angesprochen, bereiten also die beiden mittelalterlichen Werke sowohl inhaltlich, als auch formal den Weg für eine neue weltliche, unterhaltende und belehrende Literatur.[2]
Doch so klassisch die „Aeneis“ von Vergil auch nachwirken mag, die Adaption im Mittelalter hat den Autoren doch merkliche Schwierigkeiten bereitet. Die Geschichte von Eneas ist auch außerhalb der einschlägigen Literatur weit verbreitet und spaltet sich bereits in zwei Lager. Das Problem der Wahrnehmung, vor allem der des Helden Eneas, war die historische Wahrheit der Geschichte, die bereits bei Homer stark angezweifelt wurde.[3] Er und Vergil wirken besonders in einer christlichen Welt sehr unglaubwürdig, obwohl die Gründung des römischen Reichs und die historische Existenz von Eneas nicht angezweifelt wurden, nur eben die Art der Geschichte, wie sie Homer und Vergil erzählen. In späteren mittelalterlichen Adaptionen der Geschichte von Trojas Untergang wurde vor allem den Aufzeichnungen von, heute als eindeutig fiktiv geltenden, Augenzeugenberichten der Schlacht um Troja, Dares und Dictys Glauben geschenkt und auch viele mittelalterliche Chroniken übernahmen deren Ansichten. Dort etabliert sich vor allem die Tradition des Verräters Eneas, der sein Geschlecht, die Aeniden, über die in Troja herrschende Familie der Priamiden triumphieren sehen will und deswegen mit seinem Bruder Antenor den Griechen hilft.[4] Außerdem gibt es mehrere Zeugnisse, nach denen Eneas ein ungerechter Herrscher gewesen sein soll und natürlich wird er besonders von christlicher Seite häufig als Feigling und gewalttätiger Usurpator verteufelt.[5]
Dieses Bild steht im Mittelalter dem des „pius Eneas“ aus der Antike gegenüber, er kann nicht mehr der makellose Held sein, als den Vergil ihn dargestellt hat.[6] Auf diesen Kontrast scheinen die beiden mittelalterlichen Autoren referieren zu müssen, zudem ergeben sich noch weitere Probleme mit dem Eneas-Stoff, für den eine Lösung gefunden werden musste. Die Erneuerung, die von beiden Autoren in unterschiedlichen Maße vorgenommen wurde und hier untersucht wird, bezieht sich sowohl auf die Darstellung Eneas‘, als auch auf das wohl offensichtlichste Problem der mittelalterlichen Aneignung der „Aeneis“: Die Rolle der antiken Götter.
B) Hilfe der Götter als Hindernisse für Eneas
Die antike Götterwelt in Vergils „Aeneis“ ist sowohl Initiator, als auch Lenker der ganzen Handlung. Über allem steht Eneas‘ Fatum, dass er um jeden Preis erfüllen muss. Dieser Preis sind in allen Versionen des Romans die Taten, die seinen Ruf als Helden im Text, sowie beim Publikum gefährden, beispielweise die Flucht aus dem zerstörten Troja oder das Verlassen von Dido. Wie bereits erwähnt, tragen genau diese nicht gerade heldenhaften Handlungen, zu denen Eneas wegen des Fatums gezwungen ist, zu seinem schlechten Ruf im Mittelalter bei. Im antiken Epos jedoch wird Eneas von Anfang an und ohne große Mühe des Autors immer wieder rehabilitiert: Es ist der Wille der Götter, der Eneas‘ Handlungen lenkt. Er kann nicht zur Verantwortung gezogen werden, denn er ist, obwohl natürlich auserwählt, nur Werkzeug der himmlischen Mächte.