
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ich leide mit dir! Für Ella ist das nicht nur eine Redewendung, sondern harte Realität. Die Fähigkeit Schmerzen geliebter Menschen zu übernehmen sorgt dafür, dass sie vor einer voreingenommenen Regierung fliehen muss und auf Blake Island landet. Dort trifft sie auf weitere Jugendliche, die im Besitz ähnlicher Fähigkeiten sind und als Gemeinschaft zusammenleben. Als Ella Liam kennenlernt, fühlt sie sich sofort zu ihm hingezogen. Doch Liam hat ein Geheimnis, so tief und dunkel, dass er nicht mit ihr zusammen sein kann. Sie beginnen eine Freundschaft, die zum Scheitern verurteilt ist, denn keiner der beiden kann die Anziehungskraft des anderen ignorieren. Herausgerissen aus ihrem normalen Leben findet Ella Liebe, Freundschaft und Freiheit. Für eines dieser Dinge muss sie sich entscheiden, die anderen gehen für immer verloren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für die Version von mir, die den Mut hatte, dieses Buch zu veröffentlichen
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Epilog
Prolog
24. Dezember 2041
Kalt. Es fiel mir schwer an etwas anderes zu denken, außer an die Kälte, die sich von meinen Fingerkuppen über meine Arme und meinen ganzen Körper bereits ausgebreitet hatte. Meine Augen fühlten sich schwer an - ich war müde und schwarze Wimperntusche brannte in meinen Augen. Aber vielleicht war auch das nur eine Nebenwirkung der Kälte.
Ich kauerte schon seit Stunden hier. Unfähig mich zu bewegen und weiterzugehen. Das lag aber nicht nur an meinem körperlichen Zustand oder daran, dass ich schon mehrmals das Bewusstsein verloren hatte. Warum sollte man den Mut haben sich aufzuraffen, wenn man nicht wusste wohin man gehen sollte? Und genau das wusste ich nicht. Immer wieder wurde ich ohnmächtig. Wenn ich wieder aufwachte, glaubte ich oft, ich befände mich noch in einem Traum, nur um dann festzustellen, dass es leider keiner war.
Ich lag am Hafen auf einer Bank am Weihnachtsabend. Allein, mutterseelenallein. Schnee fiel unablässig und die Temperaturen waren weit unter null Grad. Seit Stunden hatte ich nur den einen Blick auf den Platz vor meiner Parkbank. Der Weg war unberührt und kein Fußabdruck war darauf zu sehen. Es war niemand da, der mir helfen konnte, oder auch nur wollte. Meine Brust schmerzte, als würde ein Messer darin stecken. Jeder Atemzug brannte in meinem Hals, wenn ich die eisige Luft tief einsog.
So lag ich also da und wartete darauf endlich nicht mehr aufzuwachen. Vor meinen Augen wurde es erneut unscharf und sie fielen langsam zu. Ein knirschendes Geräusch ließ sie nochmals flattern. Ein paar schwarze Schuhe standen vor meiner Bank und der Schnee darunter hatte das Geräusch verursacht. Nun hatten sie mich also doch gefunden. Eine Hand fasste nach meiner und wurde bei der Berührung sofort wieder zurückgezogen. War ich vielleicht schon tot?
Eine Weile später wurde ich von meinem Sterbebett hochgehoben und fortgetragen. Dann verlor ich erneut das Bewusstsein.
Eins
Für die Welt war es ein ganz normaler Tag vor Weihnachten. Unsere Nachbarn waren damit beschäftigt, die letzten Vorbereitungen für den Weihnachtsabend zu erledigen. Dekoration wurde aufgehängt und Plätzchen gebacken, Weihnachtsbäume über die schneebedeckte Einfahrt geschleppt und im warmen Wohnzimmer aufgebaut. Ja, die Welt freute sich darauf im Kreis der Familie das Weihnachtsfest zu feiern.
Ich liebte Weihnachten. Die Stille, die Besinnlichkeit und den Schnee, wenn er gerade frisch gefallen war und noch kein Auto ihn beschmutzt hatte. Aber für mich war es dieses Jahr kein normales Weihnachten. Es war zusätzlich der Tag vor meinem 18. Geburtstag. Morgen, am 23. Dezember, würde ich 18 Jahre alt werden.
Meine Mutter hatte mir einst erzählt, dass sich vor vielen Jahren die Jugendlichen auf diesen Tag gefreut hatten. Er bedeutete damals Volljährigkeit und Freiheit. Nun, die Sache mit der Volljährigkeit hat sich bis heute nicht geändert. Die mit der Freiheit ist schwieriger zu beantworten.
Jeder kannte die Geschichte, von dem Jungen, der vor zwanzig Jahren in der Nacht zu seinen 18. Geburtstag in einem Pub feierte. Als er und seine Freunde um Mitternacht den Countdown heruntergezählt hatten und die Uhr Null schlug, fing der Junge an zu schreien und fasste sich an den Unterarm. Dort erschien das Branding einer Flamme - eingebrannt in seine Haut. Im selben Moment begann alles, was der Junge anfasste, zu brennen. Zuerst war da nur ein Funke und dann eine große Flamme. Er wurde festgenommen und behandelt. Niemand weiß, was aus ihm geworden ist. Der Zwischenfall wurde als eine unbekannte tropische Krankheit deklariert und zu den Akten gelegt. Leider nur nicht sehr lange. Keine Woche später geschah es bei dem nächsten Jugendlichen - auch um Mitternacht an seinem 18. Geburtstag. Jeder dieser Jugendlichen hatte eine andere Fähigkeit. Die einen waren haptisch und man konnte sie anfassen und sehen, die anderen waren kognitiv. Vom Gedankenlesen über das Schmelzen von Eis war alles dabei. Alles war möglich und nichts mehr undenkbar.
Die meisten Jugendlichen kamen aus Nordamerika, aber auch auf den anderen Kontinenten gab es solche Vorkommnisse. Die Regierung wollte herausfinden, warum das geschah und verurteilte die Jugendlichen zu Versuchskaninchen.
Damit kein Jugendlicher der Regierung entwischen konnte, mussten alle 17-jährigen die Nacht zu ihrem 18. Geburtstag in einem extra für diesen Zweck erbauten Labor verbringen. Wenn bis zum Morgengrauen kein Branding erschienen war, konnte man unbehelligt gehen und sein Leben weiterleben. Als wäre nichts gewesen. Sollte man zu den Wenigen gehören, die mit solch einer Fähigkeit aufwachten, … naja ich kann nicht sagen, was mit diesen Jugendlichen passierte. Nie hat man einen von ihnen wiedergesehen. Von zehn Jugendlichen, welche die Nacht dort verbringen, kommen etwa neun wieder raus. Aber diese besonderen Jugendlichen, die normalerweise noch das ganze Leben vor sich hatten, waren eine Bedrohung für die Gesellschaft. Keiner konnte ihre Fähigkeiten kontrollieren, auch sie selbst nicht. So hat man es uns gelehrt.
Die Jugendlichen, auch Sparks, benannt nach dem ersten Jugendlichen, der entdeckt wurde, wurden nicht toleriert und die Gesellschaft musste vor ihnen beschützt werden. Meiner Meinung nach wurde das Thema nicht ausreichend diskutiert. Es schien mir, als hätten die Menschen Angst vor allem Neuem, aber das Neue musste doch nicht unbedingt schlecht sein? Keiner der Jugendlichen hatte jemals jemanden verletzt. Aber die eigene Meinung zählte hier nicht, sondern nur die der Allgemeinheit und die der Regierung. Und diese lautete, dass die Sparks gefährlich waren und weggesperrt werden mussten.
Es war mir also nicht zu verdenken, dass ich, als ich an diesem 22. Dezember die Augen aufschlug, keine Freudensprünge gemacht habe.
In meinem Zimmer war es schon hell. Ich hatte keine Jalousien und liebte das Gefühl der Morgensonne auf meiner Haut. So lag ich noch eine Weile da, spürte die Wärme auf meinem Gesicht und hörte den Nachbarskindern beim Schlittenfahren zu.
Wir wohnten schon seit drei Jahren in Seattle. Als mein Vater noch lebte, hatten wir ein Haus in Texas Hill County. Nach seinem Tod, wollte meine Mutter einen Neuanfang für uns und wir sind in die Nähe meiner Großeltern gezogen. Ich vermisste mein altes Zuhause, vor allem die Wildblumenteppiche, die von März bis zum Spätsommer die Highways verschönerten. Riesige Wiesen voller Wacholdersträucher, Süßhülsenbäume und Eichen.
Meine alte Schaukel im Garten und der Wind, der durch meine Haare flog. Endlos weit. Ich sog die Erinnerung auf und beruhigte mich damit.
»Ella! Frühstück ist fertig, komm runter!« Meine Mutter Elisabeth war immer vor mir auf und wuselte dann schon durch das komplette Haus. Seit dem Tod meines Vaters vor drei Jahren, schien sie mir noch rastloser zu sein. Sie bestand stets auf ein gemeinsames Frühstück und Abendessen. Das hieß für mich natürlich, dass ich aus meiner Komfortzone raus musste.
Ich schwang meine Beine aus dem Bett und stellte mich vor den Spiegel. Meine kleine blaue Kommode stand gegenüber meinem Bett, direkt neben dem Fenster. Hier befand sich alles, was ich brauchte, um mich zurecht zu machen. Meine Haarbürste und meine Wimperntusche lagen neben diversen Zopfgummis. Ich war noch nie um mein Aussehen bemüht gewesen. Meine haselnussbraunen Haare lagen wellig um mein Gesicht bis unter die Schulterblätter. Mit meinen knapp 1,65 cm war ich nicht sehr groß und nicht sehr klein. Ich war zwar schlank, aber nicht sportlich. Alles an mir schien weich zu sein. Ich war von Kopf bis Fuß durchschnittlich, was mir aber nichts ausmachte. Ich war am liebsten allein unterwegs. Diese Gespräche unter Mädchen nervten mich und ich interessierte mich nicht annähernd für die Dinge, die Mädchen meines Alters normalerweise taten. Das einzige Thema, welches es bei meinen Klassenkameradinnen gab, waren Jungs. Natürlich gab es Jungs, die ich attraktiv fand, aber irgendetwas fehlte immer. Ich konnte nie sagen was es war, hoffte aber es zu erkennen, wenn dieses Etwas irgendeiner mal haben sollte. Am liebsten saß ich Zuhause und spielte oben in der Galerie auf meinem Klavier. Dabei fühlte ich mich frei von allem und konnte die Welt um mich herum vergessen.
»Ella Stone! Wenn du nicht in zwei Minuten hier unten bist, komme ich rauf!« Das war die letzte Warnung meiner Mutter, das wusste ich. In Windeseile bürstete ich meine Haare und zog meine abgewaschene Lieblingsjeans und meinen azurfarbenen Kapuzenpullover an.
Auf dem Küchentisch standen schon meine Cornflakes und eine Tasse Tee. Meine Mutter versuchte mir immer wieder ihren heiß geliebten Kaffee schmackhaft zu machen. Ich kann nicht sagen, dass ich Kaffee überhaupt nicht mochte. Ich liebte den Geruch von Kaffee am Morgen und das heimelige Gefühl, das er verströmte. Trinken mochte ich ihn jedoch nicht. Ich blieb bei meinem Tee.
Meine Mutter war mir sehr ähnlich. Sie hatte die gleiche Haarfarbe wie ich und war ebenfalls schlank. Nur die Augen unterschieden sich von meinen. Während meine türkis waren, strahlten ihre dunkelblau. Auch wirkten ihre Gesichtszüge etwas runder als meine. Sie sagte immer, dass ich meinem Vater sehr ähnele. Sie hielt sich tapfer nach seinem Krebstod und ich vermutete immer, dass sie stark für mich sein wollte. Sie war immer sehr in sich gekehrt, aber nie so sehr, dass sie nicht bemerkt hätte, wenn es mir schlecht ging. Ihre eigenen Gefühle behielt sie für sich, aber im Laufe der Jahre hatte ich gelernt, sie hin und wieder zu durchschauen - so wie ich es heute tat. Meine Mutter versuchte mich anzulächeln und mir damit sagen zu wollen: »Alles ist gut - du musst dir keine Sorgen machen!« Was jedoch dahinter steckte, war die blanke Angst. Ihr Lächeln berührte die Augen nicht und ihre Stimme brach während der belanglosen Gespräche immer wieder ab. Ich hätte sie gerne aufgemuntert, aber es gab kein Versprechen, das ich ihr geben konnte, welches ihr auf irgendeine Art und Weise weitergeholfen hätte. Also sagte ich nichts.
Der Tag schleppte sich von Stunde zu Stunde. Wir taten, was alle Welt tat. Schmückten den Baum, während eine moderne Weihnachts-CD im Recorder lief, und sahen uns einen Weihnachtsfilm an. Die meisten Mädchen in meinem Alter fanden solche Tage öde und belanglos. Für mich gab es nichts Schöneres. Ich liebte den Geruch der Plätzchen im Ofen und die dunkelblaue weiche Decke auf dem Sofa, in die ich mich schön einkuscheln konnte.
Mittags ging ich in die Galerie und setzte mich an mein Klavier. Schon im Alter von fünf Jahren hatte ich begonnen zu spielen. Seit wir hierhergezogen waren, war die Galerie mein Zufluchtsort. Die Wände waren anders als der Rest des Hauses – bis zum Boden verglast. Ich konnte von hier über die komplette Straße sehen und über die Dächer hinweg die große Kirchenuhr. Hier hatte ich die Kontrolle. Das Klavier stand mitten im Raum. Ich hatte es von meinem Vater zu meinem 13. Geburtstag bekommen und es war mir ein ganz besonderes Andenken an ihn. Hier war ich sicher. Und so spielte ich den ganzen Nachmittag mit geöffnetem Fenster. Die Nachbarn hatten sich noch nie über die Musik beschwert und ich vermutete, dass sie mein Spiel mochten. Notenlesen war einfach, doch am liebsten spielte ich mit geschlossenen Augen. Dann konnte ich jeden einzelnen Ton vor meinem inneren Auge sehen. Ich bestimmte über jeden Ton und wenn ich spielte, fühlte ich mich, als stände ich im Regen und lächelte dem Himmel entgegen. Unbeschwert und frei.
Mein Spiel wurde von den Schlägen der Kirchenuhr unterbrochen. Es war sieben Uhr abends. Die einzelnen Schläge der Glocke, ließen mich innerlich erschaudern. Was, wenn ich eine dieser Jugendlichen war? Panik überkam mich und meine Hände begannen zu zittern. Schweiß trat mir auf die Stirn und Tränen in meine Augen. Ich wollte nicht weg, wollte keine Bedrohung für die anderen Menschen sein und vor allem wollte ich nicht sterben. So saß ich da und sah hinaus in die Dunkelheit, die sich ganz still und heimlich über die Welt gezogen hatte, mit dem Gedanken an meinen eigenen Tod.
Mechanisch packte ich meine Schlafsachen in meine Tasche und verließ mit meiner Mutter das Haus. Das Gebäude, in das wir uns einfinden mussten, lag in Fort Lewis. Dies war früher ein altes Militärgelände und lag direkt am Waldrand, vorbei am Hafen der Stadt. Hier stand weit und breit kein anderes Haus. Es gab keine Nachbarn und keine Kinder, die Schlitten fuhren. Im Dunkel vor unserem Auto erhob sich ein einziger großer Komplex. Als wir die diversen Zäune und Sicherheitskontrollen passiert hatten, musste ich mich von meiner Mutter verabschieden. In meinem Blick musste Verzweiflung gelegen haben, denn sie nahm mich in den Arm und es fühlte sich an, als würde sie mich vor dem, was mir bevorstand, beschützen können. Sie hielt mich auf Armlänge von sich weg: »Mach dir keine Gedanken, mein Liebling! Es wird alles gut!« Sie flüsterte diese Worte mit solch einer Überzeugung, dass ich ihr fast geglaubt hätte.
Doch als ihr Auto das Gelände wieder verließ und ich allein am Eingang stand, war der Mut, den sie mir zugesprochen hatte, wieder weg. Schweigend und mit einem Kloß im Hals sah ich ihr nach, wie ihre Rücklichter langsam von der Dunkelheit verschlungen wurden.
Die Schiebetür hinter mir ging auf und eine großgewachsene Frau in einem weißen Hosenanzug bat mich, ihr zu folgen. »Schön, dass sie da sind. Wir haben auf sie gewartet. Das andere Mädchen ist bereits da und Edward Cunningham möchte seine Begrüßung an sie beide vorverlegen, da er danach noch einen weiteren Termin hat.« Nett! Über mein künftiges Leben sollte heute Nacht entschieden werden und er hatte noch einen Termin. Edward Cunningham war der Leiter der Abteilung Jugendanalyse. Schöner Name für die Aussortierung von Sparks. Seine Aufgabe bestand darin, vor der Presse gut auszusehen und die Jugendlichen am Abend ihrer Ankunft im Labor zu begrüßen.
Die Dame führte mich durch einige hell erleuchtete Gänge. Nach einer endlos langen Zeit und etwa einem Dutzend Sicherungstüren, die per Fingerabdruck geöffnet wurden, waren wir in einem Schlafzimmer. Dort befanden sich zwei Betten. Auf dem einen saß bereits ein Mädchen mit langen blonden Haaren und einer Zahnspange. Ihr blasses Gesicht hob sich kaum von den Wänden ab. Für mich sah sie noch nicht aus wie achtzehn, sondern eher wie fünfzehn. Die Haare hatte sie zu zwei Zöpfen geflochten und der Pyjama, den sie trug, wies eine große Anzahl kleiner Kätzchen auf. Ihre Augen waren gerötet und ich vermutete, dass sie den ganzen Tag geweint hatte. In diesem Moment schwor ich mir, dass egal wie diese Geschichte für mich enden sollte, ich mich nie erniedrigen lassen würde.
Ich setzte mich auf das andere Bett und wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie tat mir leid, aber wieder wusste ich nicht, mit welchen Worten ich es besser gemacht hätte. Und so saßen wir da. Sie schniefte und ich versuchte weder sie, noch die Frau am Eingang zu beobachten, die sich wie eine Wache davor positioniert hatte. Stattdessen versuchte ich mich mit dem Zimmer vertraut zu machen. Es hatte einen weißen Fliesenboden und weiße Fliesen an den Wänden. War alles in diesem Komplex weiß? Am hinteren Ende des Raumes befand sich eine Tür mit der Aufschrift »Badezimmer«. Vor allem fielen mir aber die zahlreichen Kameras auf. Vermutlich befand sich sogar auf der Toilette eine. Bei diesem Gedanken musste ich unweigerlich das Gesicht verziehen. Ich würde wohl erst wieder Zuhause auf die Toilette gehen. Oder nie, flüsterte mir meine kleine innere Stimme zu.
Als hinter ihr die Tür aufging und ein großgewachsener, korpulenter Mann mit blondem Haar und braunen Augen das Zimmer betrat, wusste ich, dass es Cunningham war. Er trug einen dunkelblauen Anzug, der im Kontrast zu dem Weiß in diesem Gebäude stand. Lächelnd sah er uns an, als wären wir die Ehrengäste auf seiner Party und er hätte schon stundenlang sehnsüchtig auf uns gewartet. »Willkommen! Ich freue mich außerordentlich, dass sie beide heute den Weg zu uns gefunden haben und sich damit ihrer Bürgerpflicht zum Wohl der Gemeinschaft stellen.« Er trat einen Schritt näher und schien das verweinte Gesicht des Mädchens neben mir überhaupt nicht wahrzunehmen. Es ist erstaunlich, wie schnell ein Mensch beschließen kann, den Anderen nicht zu mögen. So ging es mir zumindest mit Cunningham.
»Die kommende Nacht werden sie beide hier verbringen. Sie werden rund um die Uhr von meinen Mitarbeitern überwacht -
Sie müssen sich also keine Sorgen machen. Es passiert Ihnen nichts.« Ein Lächeln huschte ihm über das Gesicht, als fände er die Ironie, in diesem vermutlich täglich gesagten Satz, immer noch witzig. »Um Mitternacht kommt ein Ärzteteam und untersucht sie auf eventuelle Veränderungen an ihrem Körper. Anschließend können sie in Ruhe weiterschlafen. Fühlen sie sich ganz wie Zuhause. Morgen früh, werden sie dann wieder von ihren Eltern abgeholt. Haben sie noch Fragen?« Das Mädchen blickte mich fragend an und ich schüttelte nur den Kopf. Natürlich hatte ich Fragen, aber ich wusste, dass keine davon wahrheitsgemäß beantwortet werden würde. Also konnte ich sie mir genauso gut sparen. »Wunderbar. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht! Und denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind. Auf der ganzen Welt gibt es Jugendliche, die in diesem Augenblick in Ihrer Haut stecken.« Mit diesen Worten verließen er und die Dame den Raum. In der Tür knackten Raster und es hörte sich an, als würden zehn Sicherungsbolzen den Ausgang verriegeln. Im nächsten Moment wurde das Licht gedimmt. Wohl ein Zeichen dafür, dass man von uns erwartete, schlafen zu gehen.
»Mein Name ist Mandy!« Das Mädchen mit der Zahnspange schenkte mir ein Lächeln, packte eine Tüte Chips aus und bot mir welche davon an. Da ich beim Abendessen kaum etwas runtergebracht hatte, nahm ich das Angebot nur zu gerne an. Sie erzählte mir von ihrem kleinen Bruder, der bitterlich geweint hatte, als sie fahren musste und erkundigte sich nach meiner Familie. Als ich ihr vom Tod meines Vaters erzählte, sah sie ehrlich betroffen aus - obwohl sie mich nicht kannte. Als sie nach einer Weile wieder anfing zu weinen, gab ich mir einen Ruck und setzte mich zu ihr ans Bett.
»Mach dir keine Gedanken. Ich bin mir sicher, dass du morgen früh wieder bei deiner Familie bist!«, sagte ich und hoffte, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnte.
Stunde um Stunde vergingen und die Ziffern auf meiner Armbanduhr bewegten sich immer mehr Richtung Mitternacht. Unweigerlich musste ich an Cunninghams Worte denken. Es war richtig, dass in diesem Augenblick Jugendliche in der ganzen Welt mit mir zitterten. Trotz all der Jahre Forschung und dem Fortschritt der Wissenschaft konnte nicht ermittelt werden, warum einige Jugendliche Fähigkeiten hatten und andere nicht. Es war nicht erblich und es lag nicht an der geografischen Lage, denn Kinder in aller Welt waren betroffen. Pharmaunternehmen machten einen Haufen Geld mit angeblich präventiven Tabletten entgegen der Mutation. Ich hielt das alles für Volksverdummung. So hing ich meinen Gedanken nach, bis es soweit war.
Wir saßen beide wie gebannt auf dem Bett. Starr vor Angst und unfähig uns zu bewegen. Meine Finger krallten sich um die Bettdecke. Die Uhr an der Wand zeigte Mitternacht an. Gebannt wartete ich darauf, etwas zu spüren. Ein Brennen, einen Schmerz, irgendetwas. Ich scannte meinen Körper. Suchte ihn ab nach einem Branding. Jede einzelne Zelle war dazu bereit, sich in der nächsten Sekunde vor Schmerzen zusammenzuziehen. Ich fühlte mich wie jemand, der genau wusste, dass er von hinten eins übergebraten bekommt. Doch es geschah nichts. Weder bei mir noch bei Mandy. Die Minuten vergingen und ich konnte mir nur vorstellen, wie die Menschen auf der anderen Seite der Kamera uns beobachteten.
Dann wurde plötzlich das Licht eingeschalten und vier in, wer hätte es gedacht, weiß gekleidete Ärzte betraten den Raum. Zwei von ihnen nahmen sich meiner an und untersuchten jeden Millimeter meines Körpers. Das gleiche geschah mit Mandy auf ihrem Bett. Nach einer gefühlten Stunde nahm einer der Ärzte seinen Mundschutz ab und erklärte, dass wir morgen früh wieder nach Hause fahren durften. In diesem Moment fiel eine Last von meinen Schultern, die tief in mir geschlummert hatte. Mandy hüpfte und tanzte auf ihrem Bett auf und ab und es war unmöglich sich nicht von ihrer Freude anstecken zu lassen.
Die restliche Nacht plapperte sie wie ein Wasserfall und erzählte mir von dem Adventsbasar, den sie am Weihnachtsmorgen besuchen würden und bat mich, sie zu begleiten. Eigentlich waren solche Veranstaltungen nichts für mich. Aber ich fühlte mich mit Mandy verbunden. Die letzten Stunden hatten wir die gleichen Ängste ausgestanden und ich hatte angefangen sie zu mögen. Also stimmte ich zu. Wir verabredeten uns für den Weihnachtsmorgen auf dem Markt neben der Schule. »Versprich mir, dass du mitkommst!«, sprach sie leise und ihre Augen vielen bereits zu. »Versprochen!«, beteuerte ich. Danach schliefen wir beide erschöpft ein.
Als ich das Gebäude verließ, sah ich, dass es die ganze Nacht geschneit haben musste. Es lagen mindestens zehn Zentimeter Neuschnee und die Welt sah aus wie in Watte gepackt. Als das Auto meiner Mutter in Sichtweite kam, und sie ausstieg um mich zu begrüßen, fiel ich ihr vor Freude in die Arme. Die Angst sie nie mehr sehen zu können, hatte mich doch mehr belastet, als ich mir selbst eingestanden hatte. Sie streichelte mir über das Haar und lächelte mich an.
»Nun ist es vorbei!«, schniefte ich.
»Ja, das ist es«, erwiderte sie lächelnd, doch das Lachen erreichte nicht ihre Augen. Dies registrierte ich aber nur flüchtig, da im gleichen Augenblick Mandys Familie ankam und sich schluchzend in die Arme fiel. Bevor wir fuhren, erinnerte mich Mandy nochmal an unser Treffen. Zum Abschied winkte ich ihr und wir fuhren los. Nach Hause. Im Nachhinein kam es mir lächerlich vor zu glauben, dass ein durchschnittliches Mädchen wie ich jemals solch eine besondere Eigenschaft haben sollte. Durchschnittlich zu sein hatte immer mehr Vorteile. Ein Lächeln umspielte meine Augen und den Rest des Weges schaute ich aus dem Fenster.
Wir fuhren am Hafen vorbei und in der Ferne konnte ich die Outremer sehen. Diese kleinen Inseln vor Seattle, die nicht bewohnt waren, faszinierten mich immer wieder. Spät abends, wenn ich am Hafen joggen ging, glaubte ich manchmal ein Licht auf einer der Inseln zu sehen. Aber da ich nicht die Sportlichste war, konnte es auch sein, dass mir meine dehydrierten Sinne einen Streich spielten.
»Schokoladenkuchen! Danke, Mum!« Zuhause wartete ein riesiger Geburtstagskuchen auf mich. Meine Mutter wusste, wie sehr ich Schokoladenkuchen mochte. Zusammen aßen wir je ein Stück davon. Wieder beschlich mich das Gefühl, dass sie sich nicht so freute, wie es sein sollte. Aber ich machte mir klar, dass die letzte Nacht nicht einfach für sie gewesen sein musste. Vermutlich hatte sie sich vorgestellt, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht wiedergekommen wäre und der Kuchen unberührt hier auf unserem Küchentisch stehen würde. Allein die Vorstellung verursachte mir einen Kloß im Hals. Ich wusste, dass meine Mutter mich brauchte. Sie hatte nur noch mich und ich hatte nur noch sie. So saßen wir in der kleinen Küche und frühstückten meinen Kuchen.
Ich hatte bis dahin schon viele Geburtstage gefeiert, aber an keinem hatte ich mich freier gefühlt wie heute. Ich spielte den ganzen Tag an meinem Klavier und überlegte das erste Mal, wie ich mir meine Zukunft vorstellte. Alle Möglichkeiten standen mir offen. Vielleicht könnte ich professionelle Pianistin werden. Glücklich und erschöpft von der vergangenen Nacht schlief ich früh am Abend ein in Erwartung meines neuen Lebens am nächsten Tag.
Zwei
Feuer. Ich träumte von Feuer. Ich stand in einem Wald und um mich herum war ein Feuerring. Es war heiß und meine Haut brannte unter der Hitze. Außerhalb des Rings hörte ich jemanden nach mir rufen.
»Ella!«
Es war weniger ein Rufen, als vielmehr ein Schreien. Der Schrei meiner Mutter. Ich rannte auf das Feuer zu, durch den Feuerring hindurch. Das Feuer musste mich an der Hüfte erwischt haben, denn den Schmerz, den ich empfand, war stärker als alles andere, was ich je gespürt hatte. Er brannte sich in mein Becken und fühlte sich an, als würde ein Messer darin stecken und sich bei jeder Bewegung drehen. Ich schrie. Tränen liefen mir über das Gesicht.
Als ich meine Augen wieder öffnete, war der Feuerring weg und meine Mutter beugte sich über mich. Ich war in meinem Zimmer.
»Es war ein Traum. Nur ein Traum!«, versuchte ich mich zu beruhigen. Aber der Schmerz an meiner Hüfte war noch immer da. Zwar nicht mehr so stark, aber noch deutlich spürbar. Immer noch benommen sah ich, dass meine Mutter Tränen in den hellwachen Augen hatte.
»Mum, es ist alles OK! Ich habe nur schlecht geträumt.« In meinem Zimmer brannte meine Nachttischlampe und erhellte den Raum ein wenig, die Uhr zeigte 00:03. Meine Mutter sah mich an: »Du hast geschrien und dir an den Hüftknochen gefasst.« In ihrer Stimme schwang eine Angst mit, die ich nicht verstehen konnte.
Viele Kinder hatten Albträume und nachdem, was ich gestern mitgemacht hatte, fand ich, war mir das in meinem Alter noch gestattet.
»Ja, ich habe geträumt ich hätte mich an der Stelle verbrannt.« Meine Mutter verengte die Augen, griff mit ihren zierlichen Händen nach der Decke und schob sie beiseite. Dann hob sie mein Shirt und krempelte den Bund meiner Shorts etwas herunter.
»Nein, nein, nein! Das kann nicht sein!«, flüsterte ich. Auf meiner Haut zeichnete sich deutlich ein Branding ab. Zwei Hände, die aneinander lagen und in der Mitte ein blutendes Herz hielten. »Das kann nicht sein! Das ist unmöglich. Ich bin schon 18. Das muss ein Fehler sein!« Ich sprang auf und lief in meinem Zimmer hin und her.
Minutenlang sprach ich mir zu und versuchte, mir einen Reim darauf zu machen, was passiert war. Ich wurde untersucht. Ich konnte keine Sparks sein. Als ich aufsah, bemerkte ich, dass meine Mutter noch immer an meiner Bettkante saß und auf die Stelle starrte, auf der ich eben noch gelegen hatte.
»Mum?« Ich ging langsam zu ihr, setzte mich und nahm ihre Hände in meine. Auch das hatte ich von meiner Mutter. Wir hatten beide unglaublich zierliche Hände. Es war das Einzige, was mir an meinem Körper gefiel. Sie sahen elegant und feminin aus. Und so saßen wir da. Sie blickte auf das Bett und ich auf unsere Hände.
»Weißt du, in der Nacht, in der du geboren wurdest, lag genauso viel Schnee wie heute.« Meine Mutter starrte aus dem Fenster und ihre Augen blinzelten nicht ein einziges Mal während sie sprach. Sie schien ganz woanders zu sein. Irgendwo in einer Erinnerung, die nur sie kannte.
»Dein Vater und ich waren hier deine Großeltern besuchen und hatten ein Hotelzimmer am Hafen genommen. Als dann die Wehen am späten Abend einsetzten, wollte dein Dad mich sofort in das Krankenhaus bringen. Aber ich bestand darauf im Zimmer zu bleiben. Dein Dad wusste natürlich warum.« Sie sah mich an und an meinem verständnislosen Blick muss sie erkannt haben, dass ich vermutlich nicht so schlau wie mein Dad war. Ich fand es aktuell nur unpassend, um über die Wehen zu reden, die sie in meiner Schwangerschaft hatte.
»Wären wir in ein Krankenhaus gefahren, wäre der Tag, die Stunde, die Minute und die Sekunde deiner Geburt aufgezeichnet worden. Aber wenn wir allein waren und es als Sturzgeburt bezeichneten, könnten wir an deinem eventuellen Los drehen.«
»An meinem Los?« In meinem Kopf begann es zu rattern und langsam wurde mir klar, was sie meinte.
»Ich hatte gestern nicht Geburtstag«, hauchte ich. Meine Mutter schüttelte in Zeitlupe den Kopf und eine Haarsträhne blieb an ihrer tränennassen Wange kleben.
»Ich brachte dich um 00:02 Uhr am 24.12.2023 zur Welt. Du bist also seit knapp zehn Minuten 18 Jahre alt.« Die Gewissheit traf mich wie ein Blitz. Ich war eben erst 18 geworden und ich hatte plötzlich ein Branding, welches ich vor dem Schlafengehen definitiv noch nicht hatte. »Ich bin eine von ihnen. Ich bin eine der Sparks!«, schluchzte ich.
Meine Mutter nahm mich in den Arm und erzählte mir, dass sie nach meiner Geburt in das Krankenhaus gefahren waren und behauptet hätten, dass ich am 23.12. um 23:45 Uhr zur Welt gekommen wäre. Da ich ein Neugeborenes war, und nicht auf die Stunde genau festgestellt werden konnte, wann ich geboren wurde, musste man ihnen glauben. Meine Eltern schworen sich, dass sie niemals ein Wort darüber verlieren würden - auch zu mir nicht. Die Gefahr, dass es jemand erfahren könnte, war zu groß.
»Als dein Vater im Sterben lag, musste ich ihm versprechen, auf dich aufzupassen, wie wir es geplant hatten.« Sprachlos hörte ich zu, ohne dass ihre Worte meinen Verstand zu erreichen schienen. Konnte es sein, dass mein komplettes bisheriges Leben eine Lüge war? Eine Träne kullerte über meine Wange und landete lautlos auf der Bettdecke, während es draußen erneut zu schneien begann.
Wir lagen uns in den Armen bis die Sonne aufging. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Meine Mutter dachte vermutlich an meinen Vater und daran, dass er nicht hier war um uns zu helfen. Ich dachte an mich. Vielleicht klingt das egoistisch, aber ich fragte mich, welche Gefahr ab sofort von mir ausging. Konnte ich Dinge in Brand stecken?
»Was nun?«, fragte ich, wie ein kleines Kind, in der Hoffnung, von der Mutter alle Antworten zu bekommen, die ich brauchte.
»Nun machen wir weiter als wäre nichts gewesen! So hatten dein Vater und ich es besprochen. Du darfst dein Branding niemandem zeigen. Keiner wird davon erfahren. Wenn wir wissen welche Fähigkeit du hast, wirst du lernen sie zu kontrollieren.«
»Mum, man kann das nicht kontrollieren. Das haben die Beispiele der Vergangenheit gezeigt!«
»Man kann alles kontrollieren. Man muss nur den Mut, den Willen und die Möglichkeit haben es zu versuchen. Und all das hast du jetzt! Wir schaffen das zusammen!« In ihrer Stimme schwang eine Überzeugung mit, die mich mitriss. Konnte es wirklich sein, dass ich ein ganz normales Leben führen konnte? In diesem Augenblick, der voller Hoffnung war, wussten wir beide noch nicht, wie absolut falsch wir lagen.
Das Frühstück verlief wie immer und war aus exakt diesem Grund unnatürlich. Es schien als wären wir beide immer auf der Hut. Auf der Hut vor mir. Als es dann kurz vor zwölf war, fiel mir ein, dass ich mit Mandy verabredet war. Meine Mutter war gerade einkaufen und ich schrieb ihr einen Zettel. »Hi Mum, ich bin mit Mandy auf dem Adventsmarkt verabredet. Bin gegen Abend wieder da. Mach dir keine Sorgen…« Ich hängte den Zettel mit einem der großen Magneten an unseren Kühlschrank und verließ das Haus.
Es schneite wieder und fühlte sich kälter an als gestern. Mit meinen Winterstiefeln stapfte ich zu meinem Auto und überprüfte nochmal die Schneeketten an den Rädern, die ich fast den ganzen Winter darüber hatte. Mein Auto war ein alter Chrysler und hatte die besten Jahre schon hinter sich. Seine dunkelblaue Farbe blätterte an den Türen ab und zum Vorschein kam der Rost, der sich vermutlich schon durch das komplette Fahrwerk zog. Für mich war es aber mehr als genug. Zumindest musste ich nicht mit dem Bus oder der U-Bahn fahren. Ich hasste es U-Bahn zu fahren. Es schien mir immer, als käme man damit nie an das Ziel. An jeder Ecke war eine Haltestelle an der gestoppt wurde. Menschen drängten sich an andere und der Geruch vom Schweiß der Arbeiter und der Alkoholfahne anderer Mitfahrer mischte sich zu einem explosiven Cocktail, der in meiner Nase unerträglich war. Also fuhr ich Auto, so oft es ging. Nur hin und wieder, wenn es zu glatt draußen war, bestand meine Mutter darauf, dass ich die U-Bahn nahm.
Als ich geparkt hatte und auf den Adventsmarkt zulief, sah ich Mandy schon an einem Glühweinstand stehen.
»Da bist du! Ich freue mich so!« Sie fiel mir in die Arme und begrüßte mich, als wären wir schon seit Ewigkeiten Freunde. Ich mochte sie sehr. Zusammen spazierten wir über den Markt und das erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich wie ein normales Mädchen, das mit einer Freundin unterwegs war. Ich musste mir eingestehen, dass ich es gar nicht schlimm empfand, wie ich immer dachte. Vor dem Tod meines Vaters war ich geselliger gewesen und hatte einige Freundinnen. Doch als er starb und ich eine Weile nicht weggehen wollte, hatte ich das Gefühl den Anschluss verpasst zu haben. Zu Beginn hatten alle versucht mich aus dem Haus zu locken. Ohne Erfolg. Irgendwann hatten sie es aufgegeben.
Ich denke, dass Teenager nur eine begrenzte Geduld für Menschen haben, die trauern und sich nicht am lockeren und ausgeglichenen Leben beteiligen. Später zogen wir dann weg und ich habe nie wieder etwas von ihnen gehört.
»Lass uns Lebkuchen essen gehen!« Mandy zog mich zu einer kleinen Hütte, aus der es köstlich nach dem süßen Gebäck duftete.
»Eine Tüte Lebkuchen bitte!«, bestellte ich und gemeinsam standen wir an einem Stehtisch und beobachteten die Schneeballschlacht, die sich weiter hinten gebildet hatte. Der Markt war noch nicht so überlaufen wie es heute Abend der Fall sein würde, wenn die Lichter den Platz in einen weihnachtlichen Schein tauchen würden. Hier und da waren Familien an den Ständen. Kinder fuhren Karussell und etwas weiter hinten sang ein Chor ein traditionelles Weihnachtslied.
»Oh! Dass muss weh getan haben!«, quickte Mandy und riss mich aus meinen Beobachtungen. Ein Junge in unserem Alter hatte einen Schneeball direkt ins Gesicht bekommen. Da es sehr kalt war, vermutete ich, dass der Schnee vereist war.
»Oh ja, das glaube ich auch. Der liegt am Boden und hält sich nur noch die Wange!« Schallend lachte sie, bis ihr die Tränen kamen. Der Junge musste das mitbekommen haben, denn als nächstes griff er sich einen Schneeball und warf ihn mit der Wucht eines Baseballspielers so schnell auf Mandy zu, dass ich nicht mehr die Möglichkeit hatte, sie zu warnen.
Der eisige Ball traf sie am Hinterkopf und der Aufprall machte das dumpfe Geräusch eines Basketballs, der auf dem Hallenboden gedribbelt wurde. In diesen Sekunden passierten drei Dinge.
Der Ball klatsche an Mandys Kopf.
Sie fasste sich mit der Hand an die getroffene Stelle und hatte Blut an den Händen, zuckte jedoch nicht mit der Wimper.
Im gleichen Moment durchfuhr mich ein Schmerz an meinem Hinterkopf, der mich zusammensacken lies.
So lag ich da. Der Junge musste angenommen haben, dass er Mandy nicht richtig getroffen hatte und warf den nächsten Ball, der mitten in ihrem Unterleib landete. Der Ball prallte an ihrer Jacke ab und sie blieb immer noch stillstehen als wäre nichts passiert. Ich hingegen bekam Schmerzen in der Magengrube, die mich an meine Blinddarmentzündung in der vierten Klasse erinnerte.
Damals hatte ich schon den ganzen Abend Bauchschmerzen gehabt und in der Nacht waren sie so schlimm geworden, dass ich geschrien hatte.
So schrie ich heute. Mein Kopf dröhnte, mein Magen drehte sich um und mir wurde übel. Einige Erwachsene kamen herbei und knieten sich zu mir auf den Boden. Ich hielt mir immer noch den Bauch und konnte mich nicht richtig bewegen, nicht atmen. Was war nur los? War ich etwa auch von einem Schneeball getroffen worden? Mandy sah von oben auf mich herab. Sie sah immer wieder von ihrer blutigen Hand zu mir und versuchte, genau wie ich, zu verstehen was los war.
»Mein Bauch! Er tut weh!«, schrie ich und bereute es sofort. Die Budenbesitzerin packte meine Jacke, öffnete den Reisverschluss und schob meinen Pullover hoch, um mir zu helfen. Nur, dass sie damit das genaue Gegenteil tat.
Plötzlich wurde es still um mich herum. Ein Raunen ging durch die Menge und ich wusste, was sie gesehen hatten. Mein Branding. Da es verboten war sich Brandings machen zu lassen, konnte meines nur eines bedeuten. Ich war eine Spark.
Mandy war erstarrt und blickte mich mit ungläubigen Augen an, als plötzlich ein Mann rief: »Wir müssen sofort die Polizei verständigen!«
Das schien Mandy aus ihrer Erstarrung zu befreien. Sie griff mit ihrer blutverschmierten Hand nach meiner und zog mich auf die Beine. Sie hielt mich an der Schulter fest, sah mir in die Augen und flüsterte: »Lauf!«
Mandy drehte mich um und gab mir einen kleinen Schubs in die Richtung, in der keiner der Leute stand.
Ich tat was sie sagte. Ich lief. Ich lief um mein Leben. Einige Menschen rannten mir hinterher und versuchten mich einzuholen.
Je weiter ich vom Ort des Geschehens entfernt war, desto besser wurden die Schmerzen. Ich rannte über den Adventsmarkt, vorbei am Chor, der unbehelligt weiter sang. An Karussellen mit kleinen Pferdchen vorbei und an einem Konzert der Sternsinger.
Es war schon dunkel, als ich mein Auto erreichte und die Zündung drehte. Der Motor ratterte und erstarb. Nein, nicht jetzt. Ich drehte den Schlüssel erneut und versuchte zu starten. Der Motor erstarb nach einigen Versuchen wieder. »Verdammte Karre!« Im Rückspiegel sah ich die Budenbesitzerin auf mein Auto zukommen. In ihrer Begleitung waren zwei bewaffnete Polizisten. »Oh nein, oh nein, oh nein!« Panisch und mit zitternden Fingern drehte ich den Schlüssel nochmal um. Ich wusste, mehr als diesen einen Versuch hatte ich nicht mehr, denn das hustende Geräusch meines Motors machte die drei auf mich aufmerksam und sie näherten sich mit schnellen Schritten. »Komm schon!« Meine Haut spannte über meinen Fingerknöchel. Plötzlich schnurrte der Motor wie gewohnt und ich trat auf das Gas. Im Rückspiegel sah ich die Budenbesitzerin und die Polizisten zurückbleiben.
Was war da nur passiert? Konnte es wirklich sein, dass ich den Schmerz von Mandy empfunden habe, obwohl sie getroffen wurde? Und es war offensichtlich, dass sie getroffen wurde, denn sie hatte stark geblutet. War das meine Fähigkeit? Aber warum hatte ich den Schmerz des Jungen nicht gespürt, der den Ball in das Gesicht bekommen hatte? Stand er zu weit weg? Ich erinnerte mich zurück an den Moment, in dem ich den Schneeball auf Mandy zufliegen sah. Ich hatte Angst um sie, weil ich sie mochte. Das unterschied sie von dem Jungen. Er war mir egal, aber ich wollte nicht, dass sie verletzt wurde.
Ich hielt in einer Seitenstraße an und umklammerte das lederne Lenkrad.
»Soll es das sein? Ich kann nichts in Brand stecken? Ich kann keine Gedanken lesen? Ich muss den Schmerz von geliebten Menschen ertragen? Soll das meine außergewöhnliche Fähigkeit sein?«
Ich drehte meinen Kopf in Richtung Himmel, als ob ich von dort eine Antwort erhalten würde. Nichts. Es blieb still. Die nächsten Minuten erlaubte ich mir, mich in Selbstmitleid zu baden. Immer wieder fragte ich mich warum. Aber darauf hatte die ganze Welt keine Antwort. Warum gab es diese Fähigkeiten? Warum nur bei Jugendlichen? Warum zum 18. Geburtstag? All diese Fragen konnten nie geklärt werden. Es war Zufallsprinzip und konnte jeden treffen.
Ich legte den Gang wieder ein und fuhr nach Hause. In der Küche brannte Licht und ich wusste nicht, wie ich meiner Mutter beichten sollte, dass alles, wofür sie und mein Dad die vergangenen 18 Jahre gekämpft hatten, von mir in nur wenigen Stunden vernichtet wurde.
Ich stieg die Stufen zu unserem Haus hinauf und betrat das Wohnzimmer. Der Weihnachtsbaum stand darin und leuchtete. Aus der Küche kam der Duft von unserer Gans und meine Mutter sang ein Weihnachtslied mit, das gerade im Radio gespielt wurde.
Ich betrat die Küche. Elisabeth drehte sich um und verstummte in der Liedzeile, als sie mich sah.
»Mum! Ich habe es verbockt«, brachte ich hervor. Sie ließ den Löffel fallen, mit dem sie eben noch in der Füllung gerührt hatte, und nahm mich in den Arm.
Ich erzählte ihr unter Tränen was passiert war. Als ich fertig war, stieß sie sich von der Anrichte ab und eilte die Treppe hinauf.
»Mum!« Ich stolperte ihr hinterher. Sie lief in mein Zimmer, nahm den Rucksack, der in meinem Zimmer lag, und fing an Kleider darin zu verstauen. »Mum, was tust du da?«, stammelte ich.
Unbeirrt packte sie weiter: »Du kannst nicht hierbleiben. Sie werden dich holen kommen!«
»Nein Mum. Sie kennen mich nicht und Mandy wird ihnen nichts verraten. Sie können mich nicht finden!«
»Ach ja! Und das Nummernschild? Ella denk doch nach! Mandy hat auch Familie und die Regierung wird nicht zögern die zu bedrohen. Sei nicht dumm!«, zischte sie. »Sie werden schon auf dem Weg hierher sein. Du musst sofort weg!« Sie sah mich an und mir kamen die Tränen. Ihr Gesichtsausdruck wurde etwas weicher. Sie zog mich in ihre Arme und streichelte mir über das Haar.
»Ella, es ist nicht deine Schuld. Es ist meine Schuld. Ich hätte nicht verlangen dürfen, dass du tust, als wäre alles wie zuvor. Du musst jetzt stark sein und mutig!« Sie blickte mich an, schob mich wieder von sich weg und ging in ihr Schlafzimmer. Kurz darauf kam sie mit einem Bündel Geldscheine wieder heraus.
»Nimm das. Geh und nimm dir ein Hotelzimmer. Sag mir nicht wo!«, drängte sie. Sie zog mir die dünne Winterjacke aus und stülpte mir mehrere Pullover übereinander darüber. Dann zog sie mir die Jacke wieder an. Ich fühlte mich wie eine Puppe, unfähig mich zu bewegen. Mum nahm mein Gesicht in ihre Hände: »Lauf zum Hafen. Nimm das nächste Schiff und verlass Seattle. Die Bahnhöfe und Flughäfen werden sie überwachen. Geh nicht zum Bahnhof, hörst du mich!« Ich nickte wie in Trance.
»Ich liebe dich mein Schätzchen. Sobald es sich beruhigt hat, werde ich mich auf die Suche nach dir machen. Halte immer die Augen nach mir offen. Wir werden bald wieder zusammen sein!« Tränen traten in ihre Augen. Ich umarmte sie und wollte nie wieder loslassen.
»Bitte schick mich nicht weg. Bitte komm mit. Bitte lass mich nicht allein!«, bettelte ich, während sie mich die Treppe herunterführte.
»Ich komme dir nach, mein Schätzchen, sobald ich sie davon überzeugt habe, dass du tot bist!« Ich blickte sie an und der Schock stand mir ins Gesicht geschrieben.
»Sie werden nie aufhören mich zu suchen, wenn sie nicht denken ich wäre tot«, stellte ich fest, den Blick auf meine Schuhe gerichtet.
»Ja, so ist es!« Mum blickte mich an. »Nun geh. Nimm nicht den Wagen. Geh nicht auf der Hauptstraße, sondern nimm die Nebenstraßen. Die letzte Fähre für heute geht in einer Stunde und«, sie stockte mitten im Satz. Vor dem Haus hörten wir ein Auto parken. »Geh hinten raus! Ich liebe dich!«
Sie schob mich zur Hintertür raus. Schloss sie ab, blickte mich noch ein letztes Mal durch das Fenster in der Tür an und ging dann zur Haustür. Ich beobachtete, wie sie sich von mir abwandte und es fühlte sich an, als würde ich sie nie wiedersehen. Ich stand in unserem Garten und schaute auf unser Haus. Oben in meiner Galerie brannte ein kleines Licht und durch die Glasscheiben konnte ich mein Klavier sehen. Schmerz erfüllte mich und ich schluckte einen Kloß herunter, als ich mich umdrehte und zwang nicht zurückzublicken.
Ich ging mit schnellem Schritt durch unsere Straße und bog in die nächste Seitengasse Richtung Hafen ab. Ich musste mich beeilen. Bis zum Hafen waren es zu Fuß gut 45 Minuten und ich musste noch ein Ticket kaufen. Instinktiv umklammerte ich mit meiner Hand das Geld in meiner Jackentasche. Mein Weg führte mich an duzenden Häusern vorbei, immer darauf bedacht nicht aufzufallen. Der Schnee verursachte bei jedem Schritt ein knirschendes Geräusch unter meinen Schuhen. Jedes Auto, das an mir vorbeifuhr, erfüllte mich mit Panik.
Doch die Autos hielten nicht an. Vor einem kleinen Häuschen blieb ich auf dem Gehweg stehen und schaute vom Gartenzaun aus wie gebannt durch die große Fensterscheibe ins Wohnzimmer. Darin saß eine Familie mit zwei kleinen Kindern im Grundschulalter. Sie aßen das köstliche Essen und lachten gemeinsam. Im Hintergrund war der Weihnachtsbaum zu sehen und ein Feuer brannte im Kamin. Ich stand hier draußen. Es war eisig kalt und trotz der vielen Schichten, die meinen Körper warmhalten sollten, fror ich. Ich hatte Hunger. Hier draußen wurde mir bewusst, was ich in den letzten zwei Stunden alles verloren hatte. Ich war völlig allein.
Und so stand ich da, während mir der Schnee auf die Haare fiel. Ich weiß nicht mehr wie lange ich dort stand, aber ich wurde aus meiner Erstarrung durch die Kirchenuhr geweckt. Sie schlug viertel vor acht. In einer viertel Stunde legte die letzte Fähre ab und ich hatte noch gute zwei Kilometer zu laufen. Also rannte ich los. Ich rannte um mein künftiges Leben und mit jedem Schritt ließ ich mein altes hinter mir.
Ich konnte schon die Lichter des Hafens sehen und als ich um die letzte Ecke bog, blieb ich abrupt stehen. Was ich gesehen hatte, waren nicht nur die Lichter des Hafens, sondern auch die Blaulichter der Polizeiwagen, die jeden einzelnen Passagier der die Fähre betreten wollte durchsuchte. Ich zog mich wieder in die Gasse zurück und beobachtete die Szene. Mindestens zehn Polizisten hielten nach etwas Ausschau. Nicht nach etwas. Nach jemandem. Mir wurde klar, dass ich keine Chance hatte unerkannt das Schiff zu betreten. Ich schaute auf die Uhr. Acht. Es war zu spät. Ich sah wie die Fähre ablegte und damit meine letzte Chance hier weg zu kommen.
Der Wind pfiff durch mein Haar und ich lehnte mich an die mit Graffiti beschmierte Wand. Was sollte ich jetzt tun? Langsam kauerte ich mich hin scherte mich nicht mehr darum, ob man mich gleich finden würde. Ich war durchgefroren und mir war kalt. Ich wollte nur, dass das alles endlich vorbei war. Nach einer Weile hörte ich den Schnee unter Autoreifen knarren und beobachtete, wie die Polizei davonfuhr.
Der Hafen war verlassen und in fast komplette Finsternis gehüllt. Nur einzelne Straßenlaternen erleuchteten einige Stellen. Der Wind frischte auf und kämpfte sich durch meine Kleiderschichten hindurch. Ich setzte meine dunkelblaue Wollmütze auf und ging hinunter ans Ufer zu einer Parkbank. Ich legte mich hin und schaute auf das Wasser zu den Outremer.
Wieder hatte ich das Gefühl, dass dort ein Licht war. Am ganzen Körper zitternd, rollte ich mich wie ein Kind im Mutterleib zusammen. Sollten sie mich finden, würde ich mich nicht wehren. Ich hatte nichts mehr und wusste nicht, was mit meiner Mutter passieren würde. Ausgesprochen hatte sie es nicht, aber sie ahnte genau wie ich, dass sie mehrere Fragen beantworten werden müsste, wenn die Polizei ankam.
Was sie jetzt wohl gerade tat? Der Wind pfiff über meinen Körper und ich begann meine Finger nicht mehr zu spüren. Das war der Augenblick, in dem ich das erste Mal das Bewusstsein verlor.
Drei
Ich träumte von meiner alten Schaukel in Texas County.
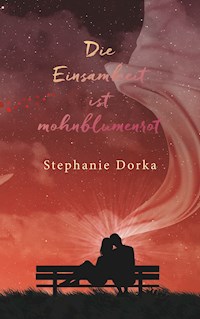














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













