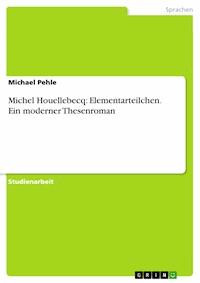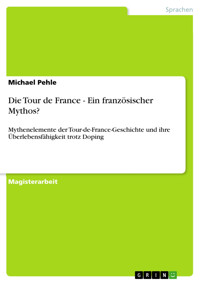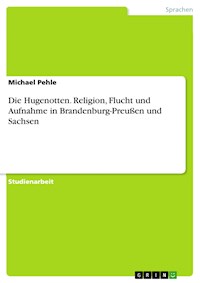
Die Hugenotten. Religion, Flucht und Aufnahme in Brandenburg-Preußen und Sachsen E-Book
Michael Pehle
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Französische Philologie - Linguistik, Note: 1,0, Technische Universität Dresden (Institut für Romanistik), Veranstaltung: Le francais dans le monde au 18ème siècle, Sprache: Deutsch, Abstract: Ausgehend von einer kurzen Einführung in die Religion der Hugenotten spiegelt die Arbeit die Vertreibung, Flucht und Ansiedlung der Hugenotten in Brandenburg/Preußen und Sachsen wieder. Nach dem Widerruf des Ediktes von Nantes durch Ludwig XIV am 18. Oktober 1685 flüchteten ca. 160 000 Franzosen protestantischen Glaubens, viele davon nach Brandenburg/Preußen und einige nach Sachsen. Sowohl die Flucht, als auch die Aufnahmebedingungen, die Integration und die sprachliche Hinterlassenschaft der Emigranten wird in dieser Arbeit beschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
1 Einleitung
2 Die Religion der Hugenotten – Reformierte Kirchen
3 Der Widerruf des Edikts von Nantes
3.1 Die Lebensumstände der Hugenotten zur Zeit des Widerrufs des Edikts von Nantes
3.1.1 Die Zeit Ludwigs XIII.
3.1.2 Die Zeit Ludwigs XIV.
3.2 Das Edikt von Fontainebleau 1685
3.2.1 Außen- und innenpolitische Folgen für Frankreich
3.2.2 Die Folgen für die Hugenotten in Frankreich
4 Flucht der Hugenotten
4.1 Situation in Deutschland zur Zeit des Edikts von Fontainebleau
4.2 Die Hugenotten in Brandenburg-Preußen
4.3 Sprachliche Hinterlassenschaft der Hugenotten
5 Die Hugenotten in Sachsen
5.1 Hugenottische Kaufleute in Leipzig
5.2 Hugenottische Künstler und Handwerker in Dresden
5.3 Integration der Hugenotten in die sächsische Gesellschaft
6 Die Vertreibung der Hugenotten als Akt europäischer Verständigung
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
„Meine lieben Kinder […] wir verlassen unser Vaterland und alles, was uns wert und teuer ist, um euretwillen und des Heiles eurer Seele willen. Aber die Gefahr ist groß. Ihr müsst wissen, was uns bevorsteht, wenn wir ertappt werden. Der Vater kommt auf die Galeere, der Mutter wird von Henkers Hand der Kopf geschoren, und sie kommt auf Lebenszeit ins Gefängnis, die Kinder aber kommen ins Kloster und ihr Vermögen wird eingezogen. Bittet daher Gott mit mir, daß er uns glücklich entweichen lasse aus Babylon, wo wir so vieles erduldet haben und wo wir endlosem Leid ausgesetzt wären, wenn unsre Flucht mißlingen sollte.“[1]
So wie Susanne Madelene Morizot im Jahr 1749 erging es vielen Hugenotten, die von der Gründung ihrer reformatorischen Glaubensbewegung an, bis zum Jahr 1787 enormen Verfolgungen ausgesetzt waren. In diese Zeit und in diesen Kontext fallen Ereignisse wie die Bartholomäusnacht 1572, in der mehrere Tausend Hugenotten in einer Nacht in Paris ermordet wurden, das Toleranzedikt von Nantes 1598 durch Heinrich IV., dessen Aufhebung 1685 durch Ludwigs XIV. im Edikt von Fontainebleu, und schließlich 1787 das Toleranzedikt von Versailles, mit dem die zum Teil extrem grausame Hugenottenverfolgung nach knapp 300 Jahren der Unterdrückung ein Ende fand. In dieser Zeit verließen Hugenotten zu hunderttausenden ihre Heimat Frankreich fanden in ganz Europa Zuflucht.
„Lebt wohl denn ihr Freunde, lebe wohl Metz, du meine Vaterstadt, lebe wohl, Frankreich, mein Vaterland, du Land, wo Milch und Honig fließt, für uns aber nur Kummer und Tod zu finden ist. Leb’ wohl du armes Volk, das man in Aberglauben und Irrtum versinken läßt, dem man die heiligen Bücher entzieht unter dem Vorwand, sie seien ihm unverständlich, das man die Knie beugen läßt vor Menschenwerk, vor Silber, Steinen und Holz […]
Wen sie mit Gewalt nicht zwingen kann, der muß das Land verlassen mit Verlust seiner Güter, seiner Ruhe, seines Glückes. Du armes Frankreich, kein einziger Ort ist innerhalb deiner Grenzen zu finden, wo man Gewissensfreiheit und Schutz vor Qual und Verfolgung genießen kann.“[2]
Diese Arbeit soll ausgehend von einer Klärung der Religion der Hugenotten einen Überblick über die Lebensbedingungen der Hugenotten in Frankreich zur Zeit Ludwigs XIV. und die anschließende Vertreibung aus dem Heimatland Frankreich liefern. Des Weiteren wird auf die Aufnahmebedingungen in Deutschland, beziehungsweise in Brandenburg/Preußen und in Sachsen eingegangen und die Hinterlassenschaft der Hugenotten in den Aufnahmegebieten dargestellt. In einem letzten Punkt wird die These aufgestellt, inwieweit die Vertreibung der Hugenotten trotz ihrer Grausamkeit zur europäischen Völkerverständigung beigetragen hat.