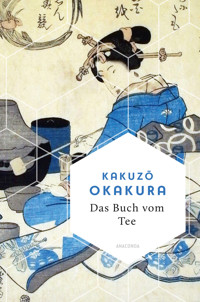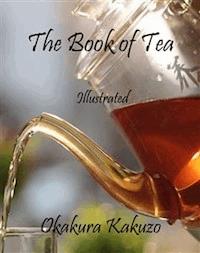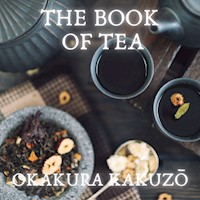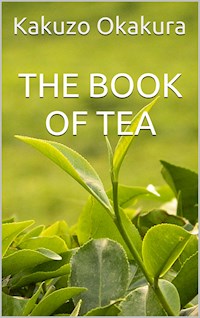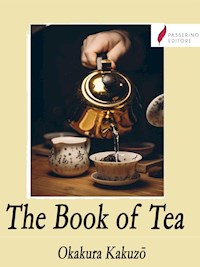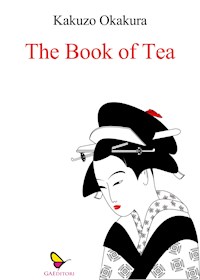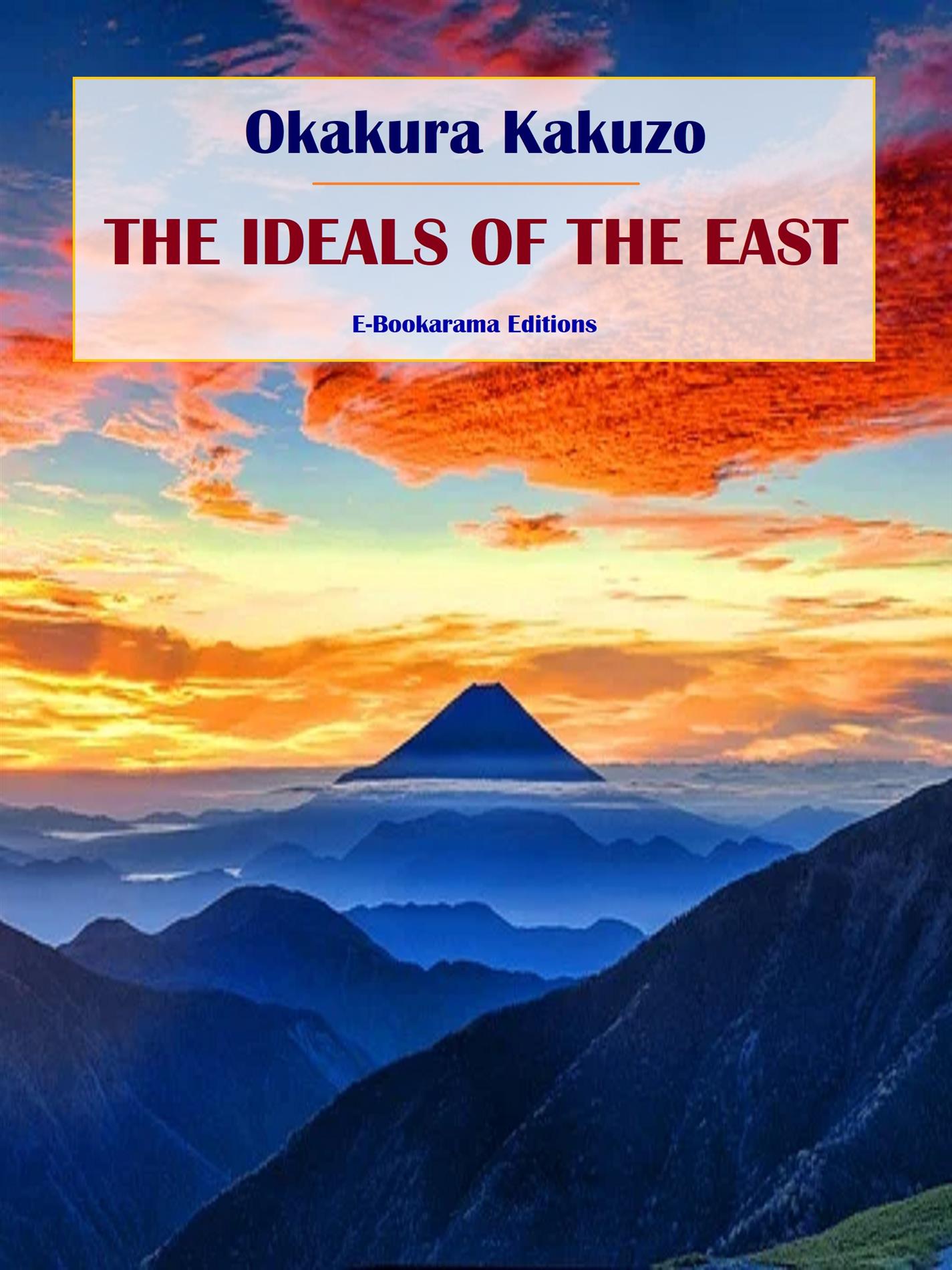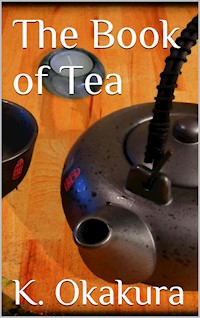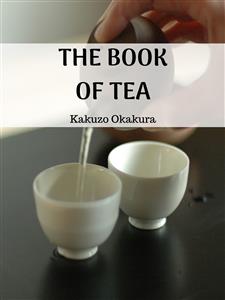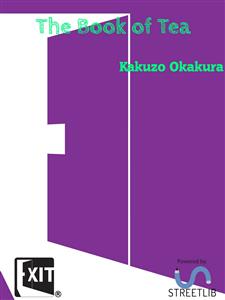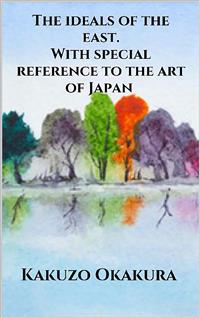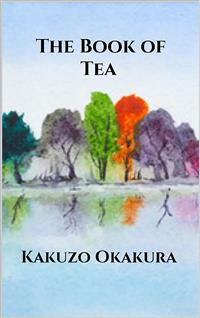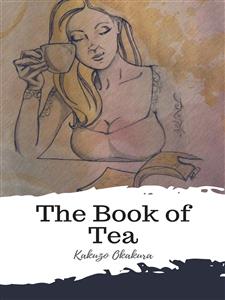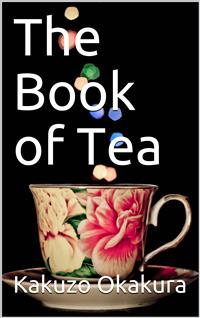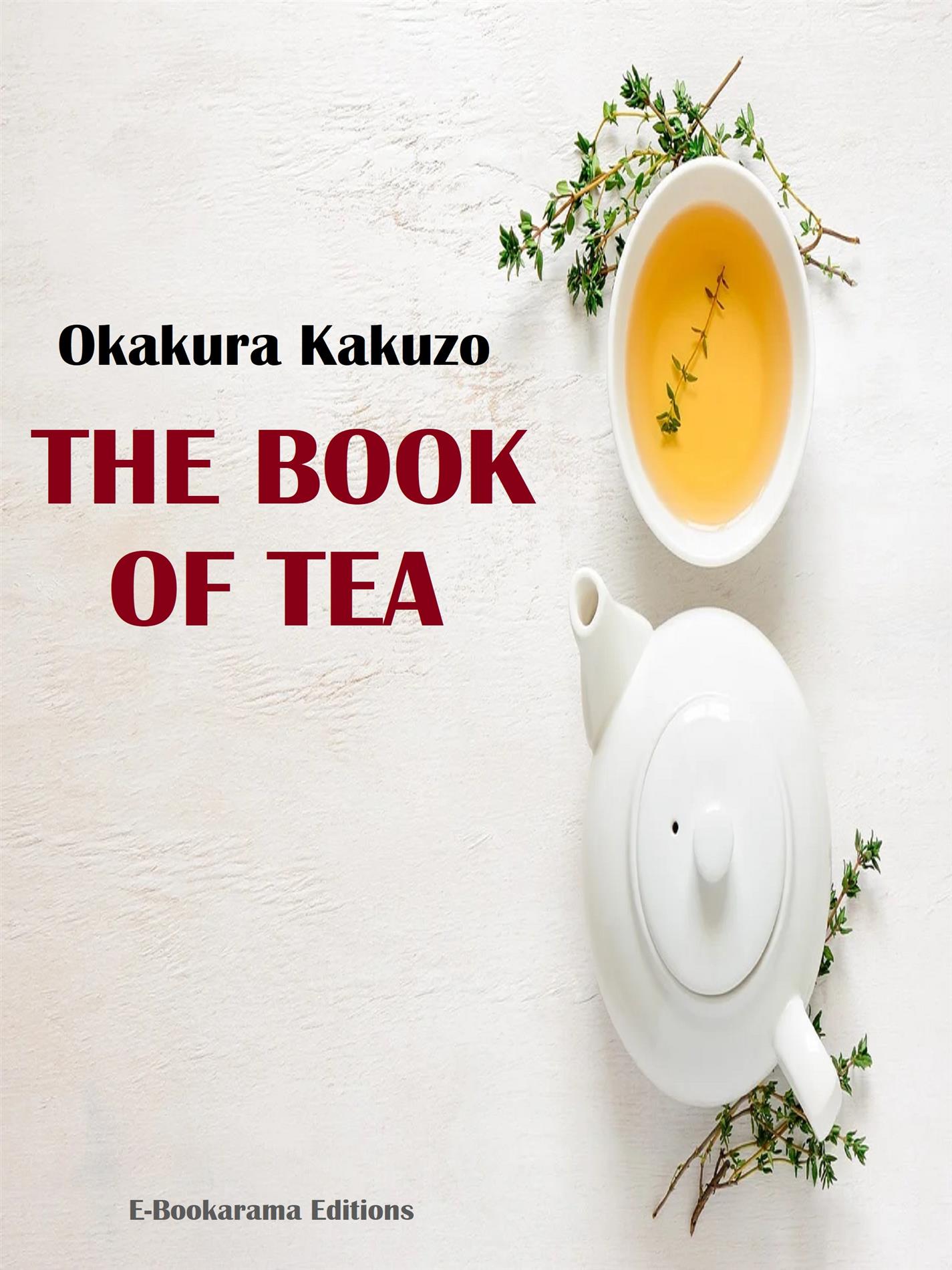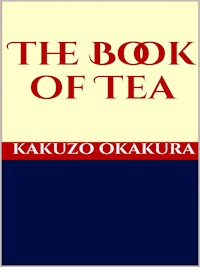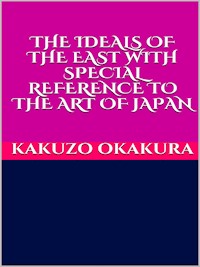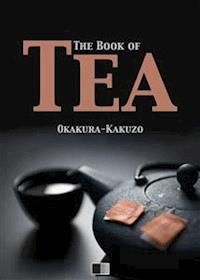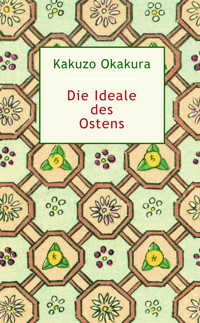
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kristkeitz, Werner
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Werk von Kakuzo Okakura, der durch sein 'Buch vom Tee' berühmt wurde, gibt uns eine detaillierte Einführung in das Wesen und die Entwicklung der ostasiatischen und insbesondere der japanischen Kunst im Verlauf der verschiedenen Epochen, und er beleuchtet ihre vielfältigen Verbindungen mit der östlichen Spiritualität und den buddhistischen Traditionen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kakuzō Okakura
Die Ideale des Ostens
unter besonderer Berücksichtigung der Kunst Japans Verlag Werner Kristkeitz
Diese Ausgabe basiert im Wesentlichen auf der Übersetzung von Marguerite Steindorff, erschienen in Leipzig (Insel) 1922. Zur besseren Lesbarkeit wurde der Text behutsam an die Rechtschreibung unserer Zeit angepasst, und nur an wenigen Stellen wurden notwendige Korrekturen angebracht. Titel der Originalausgabe: «The Ideals of the East. With Special Reference to the Art of Japan», erschienen bei E. P. Dutton & Co., New York 1904. Copyright für diese Ausgabe © 2007-2025 Verlag Werner Kristkeitz, Heidelberg. Alle Rechte für sämtliche Medien und jede Art der Verbreitung, Übersetzung, Vervielfältigung, Speicherung oder sonstigen, auch auszugsweisen, Verwertung bleiben vorbehalten. ISBN dieser E-Book-Ausgabe: 978-3-948378-31-8www.kristkeitz.de
Inhalt
Einleitung
Der Machtbereich der Ideale
Die primitive Kunst Japans
Der Konfuzianismus und Nordchina
Laoismus und Taoismus
Der Buddhismus und die indische Kunst
Die Asuka-Periode
Die Nara-Periode
Die Heian-Periode
Die Fujiwara-Periode
Die Kamakura-Periode
Die Ashikaga-Periode
Die Toyotomi- und ältere Tokugawa-Periode
Die jüngere Tokugawa-Periode
Die Meiji-Periode
Zukunftsaussichten
Einleitung
Kakuzō Okakura, der Verfasser dieses Buches über japanische Kunstideale, ist den Japanern und anderen Völkern schon längst als die erste lebende Autorität auf dem Gebiet orientalischer Archäologie und Kunstgeschichte bekannt. 1886 wurde er trotz seines damaligen jugendlichen Alters zum Mitglied der kaiserlichen Kunstkommission ernannt, das von der japanischen Regierung nach Europa und den Vereinigten Staaten hinübergesandt wurde, um die dortige Entwicklung der Kunst und ihre Strömungen zu studieren. Weit davon entfernt, von seinen Erlebnissen überwältigt zu werden, entdeckte Herr Okakura ganz im Gegenteil, dass seine Liebe zur asiatischen Kunst sich durch seine Reisen noch vertieft und verstärkt hatte, und seit jener Zeit suchte er seinen Einfluss in der Richtung einer Erstarkung und Wiederbelebung der japanischen Kunst auf nationaler Grundlage geltend zu machen, wodurch er in bewussten Gegensatz zu der im Osten heute so in Mode gekommenen Neigung zur Pseudo-Europäisierung trat.
Nach seiner Rückkehr aus dem Westen wurde Herr Okakura in Anerkennung seiner Verdienste und Überzeugungen von der japanischen Regierung zum Direktor der neuen Kunstschule in Ueno, Tōkyō, ernannt. Politische Umwälzungen aller Art hatten jedoch zur Folge, dass immer neue Wogen des so genannten Europäismus gegen die Schule anprallten, und 1897 wurde darauf gedrungen, dass von nun ab den europäischen Lehrmethoden ein wachsender Spielraum einzuräumen sei. Herr Okakura reichte seine Entlassung ein. Ein halbes Jahr später hatten sich neununddreißig der begabtesten jungen Künstler Japans um ihn geschart und das Nippon Bijitsuin, die Halle der schönen Künste, in Yanaka, einem Vorort Tōkyōs, eröffnet, von der im vierzehnten Kapitel des vorliegenden Buches die Rede ist.
Wenn wir Herrn Okakura mit einer gewissen Berechtigung den William Morris seines Vaterlandes nennen, so müssen wir das Nippon Bijitsuin als eine Art japanische Merton Abbey bezeichnen. Hier werden die verschiedenen Arten des Kunstgewerbes, wie zum Beispiel Lack- und Metallarbeit, Bronzegießerei und Porzellanherstellung, sowie japanische Malerei und Plastik gepflegt. Die Mitglieder suchen sich tiefes Mitgefühl und Verständnis für die zeitgenössischen Kunstströmungen des Abendlandes zu erwerben, gleichzeitig aber ihre nationale Eigenart zu behaupten und zu vertiefen. Es ist ihr Stolz, erklären zu dürfen, dass sich ihre Arbeiten neben dem Besten, was auf diesem Gebiet geschaffen worden ist, sehen lassen können. Unter ihnen befinden sich Namen wie Hashimoto Gahō, Kanzan, Taikan, Sessei, Kozan und andere, nicht minder klangvolle. Neben seiner Tätigkeit am Nippon Bijitsuin hat Herr Okakura aber noch Zeit gefunden, im Auftrag seiner Regierung an der Klassifizierung der Kunstschätze Japans mitzuwirken und die Altertümer Chinas und Indiens zu besichtigen und zu studieren. Was Indien betrifft, so ist mit Okakura dort zum ersten Mal in neuerer Zeit ein Reisender von hoher östlicher Kultur und weit gehenden orientalischen Kenntnissen erschienen, und Okakuras Besuch der Gräber von Ajantā ist in der Geschichte indischer Archäologie Epoche machend geworden. Seine Kenntnisse der südchinesischen Kunst aus der gleichen Epoche ließen ihn sofort erkennen, dass die in den Höhlen aufgefundenen Steinfiguren ursprünglich nur als Gerippe oder Grundlagen für die eigentlichen Statuen geplant waren. Leben und Bewegung des Porträts sollten später in eine dicke Gipsschicht, mit der man sie zu überziehen gedachte, eingearbeitet werden. Eine eingehende Untersuchung der Modellierungen ergab die völlige Berechtigung dieser Auffassung. Unwissenheit und unbewusster Vandalismus des geldgierigen Europas haben unglücklicherweise zu einer überflüssigen Reinigung und unbeabsichtigt zu einer Entstellung der Statuen geführt, ähnlich wie das leider auch in letzter Zeit mit den Kunstwerken in den Dorfkirchen Englands geschehen ist. Die Kunst kann sich nur bei Völkern entwickeln, die in Freiheit leben. Sie ist in Wahrheit das gewaltige Mittel und die Frucht jenes freiheitlichen Hochgefühls, das wir Nationalitätsbewusstsein nennen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Indien – durch jahrtausendalte Unterdrückung von einer spontanen Entwicklung abgeschnitten – seines Platzes in der Welt der Freude und veredelnden Arbeit verlustig gegangen ist. Tröstlich ist es jedoch, von so maßgebender Seite wie von Herrn Okakura zu erfahren, dass Indien auch auf diesem Gebiet früher einmal wie in der Religion zur Zeit des Aśoka allem Anschein nach für den gesamten Osten führend war. Dadurch, dass es den Stempel seiner Gedanken und seines Geschmacks den zahllosen Pilgern, die seine Hochschulen und Tempel besuchten, einprägte, wurde die Entwicklung der Skulptur, Malerei und Architektur in China selbst und auf diesem Umweg auch in Japan beeinflusst.
Nur wer sich bereits eingehend in die besonderen Probleme indischer Archäologie vertieft hat, vermag die überragende Bedeutung von Okakuras Hypothese über den vermeintlichen Einfluss Griechenlands auf die indische Plastik zu ermessen. Als Vertreter der entgegengesetzten großen Kunsttradition, der chinesischen, ist Okakura in der Lage, die Unhaltbarkeit der hellenistischen Theorie aufzuzeigen. Er weist nach, dass die fremden Anklänge in der indischen Kunst zum großen Teil chinesischen Ursprungs sind. Den Grund hierfür erblickt er in dem Vorhandensein einer frühen, einheitlichen asiatischen Kunst, deren entlegenste Wellen gleichzeitig bis zu den Küsten von Hellas, Etrurien, Phönizien, Ägypten, Indien, China und Irland drangen und dort ihre Spuren hinterließen. Diese Theorie bringt auch jeden entwürdigenden Prioritätsstreit in befriedigender Weise zum Schweigen und weist Griechenland an seinen ihm gebührenden Platz als kulturelle Provinz des alten Asien zurück, das die Gelehrten von jeher als den Asgard-Hintergrund der großen nordischen Sagenwelt betrachtet haben. Gleichzeitig wird der künftigen Wissenschaft eine neue Welt erschlossen, in der synthetische Methoden und Gesichtspunkte die Irrtümer der Vergangenheit zu korrigieren berufen sind.
Auch Okakuras Behandlung chinesischer Probleme ist nicht minder reich an Anregungen. Seine Analyse der nördlichen und südlichen Gedankenwelt Chinas hat unter den chinesischen Gelehrten beträchtliches Aufsehen erregt, und seine Unterscheidung zwischen Laoismus und Taoismus ist von den weitesten Kreisen akzeptiert worden. Am wertvollsten jedoch erscheint sein Werk dort, wo es neuen Grund legt. Er ist der Meinung, dass das große, allgemein bekannte, welthistorische Schauspiel des über die Himālayapässe und durch die Meerengen auf dem Seeweg nach China sich ergießenden Buddhismus, jene Völkerbewegung, die vermutlich unter Aśoka einsetzte und in China selbst zur Zeit Nāgārjunas im zweiten Jahrhundert u. Z. begann, nicht isoliert dasteht. Diese Bewegung war vielmehr charakteristisch für die Zustände, unter denen allein Asien zu leben und zu gedeihen vermag. Die als Buddhismus bezeichnete Geistesströmung kann an sich keine scharf formulierte, streng definierte Glaubenslehre mit bestimmt abgegrenzten Irrlehren und einem aus sich geborenen Ritual gewesen sein. Vielmehr ist der Buddhismus ein Name, den man jener ungeheuren Synthese, die wir als Hinduismus bezeichnen, beilegte, nachdem diese in einem fremden Bewusstsein aufgegangen war. Denn Okakura weist in seinen Schriften über die japanische Kunst im neunten Jahrhundert nach, dass die gesamten Mythologien des Ostens – nicht nur die persönlichen Lehren Buddhas – in engem Austausch untereinander standen. Die mongolische Gedankenwelt wurde nicht buddhaisiert, sondern indisiert. Es wäre etwa das Gleiche, als würde man in einem fremden Land das Christentum, seinen ersten Verkündigern zu Ehren, mit dem Namen Franziskanertum belegen.
Bekanntlich kommen die Lebenselemente des aktiven japanischen Nationalgefühls stets in der Kunst zum Ausdruck. In ihr hat das Volksbewusstsein zu jeder Periode seiner Entwicklung seine wesentlichsten Zeichen und Spuren hinterlassen. Im Gegensatz zu den alten Griechen nimmt die gesamte japanische Nation an der Kunst Anteil, ähnlich wie sich in Indien alle Volksschichten an der Philosophie beteiligen. So entsteht die überaus interessante Frage: Was ist es, das im Zusammenklang seiner Elemente durch die japanische Kunst als Gesamtheit zum Ausdruck gelangt?
Okakura antwortet, ohne zu zögern: Es sind die Kulturformen des gesamten asiatischen Kontinents, die auf Japan übergegriffen haben und in seiner Kunst freien, lebendigen Ausdruck erhalten. Und diese asiatische Kultur lässt sich, seiner Meinung nach, in zwei Faktoren zerlegen: in chinesische Gelehrsamkeit und indische Philosophie. Für ihn sind weder die ornamentalen noch die handwerklichen Eigenheiten der japanischen Kunst das in Wahrheit Bedeutsame, sondern die große Welt ihrer Ideale, die in Europa vorläufig noch fast unbekannt ist. Nicht die paar Zeichnungen blühender Pflaumenbäume, sondern der erhabene Begriff des Drachen; nicht Vögel und Blumen, sondern der Totenkult; kein nebensächlicher, noch so schöner Realismus, sondern eine großartige Auslegung des großartigsten Themas des menschlichen Geistes, der Sehnsucht nach Buddhaschaft zum Heil der anderen und nicht des eigenen Ichs, sind der Inbegriff der japanischen Kunst. Die Ausdrucksmittel und -methoden hat Japan von jeher China entlehnt; in seinen Idealen jedoch ist es von Indien abhängig. Okakura ist der Meinung, dass den großen Blüteperioden der japanischen Kunst stets eine Welle indischen Spiritualismus vorausgegangen ist. So mussten die saftschwellenden Kunsttriebe Chinas und Japans notgedrungen verkümmern und verarmen, sobald sie des befruchtenden Einflusses der großen südlichen Halbinsel beraubt waren; ähnlich wäre es zweifellos Nord- und Westeuropa ergangen, hätte man sie von Italien und dem Einfluss der Kirche losgelöst. Auch isoliert wäre jedoch die Kunst Asiens niemals verbürgerlicht. In dieser Hinsicht steht sie in scharfem Gegensatz zu der deutschen, holländischen und norwegischen Kunst. Okakura wird damit nicht bestreiten wollen, dass sie vielleicht auf dem Niveau einer groß angelegten, sinnfälligen und wertvollen bäuerischen Gegenstandskunst geblieben wäre.
Okakuras Ziel ist es, bis ins Einzelne klarzulegen, wie diese Wogen indischen Spiritualismus den asiatischen Völkern Anregung und Inspiration wurden. Vorerst müssen wir indes die Elemente kennen lernen, auf die sie trafen, die sich sowohl in der Yamato-Rasse Japans wie in dem wunderbaren ethischen Genius Nordchinas und in der reichen Fantasie Südchinas verkörpern. Erst dann können wir den Eintritt des buddhistischen Stroms nach Japan verfolgen, der alsbald das Ganze zu überschwemmen und zu vereinigen beginnt. Wir wollen ihm nachgehen und sehen, wie die erste, schattenhafte Vorstellung einer allgemeinen Glaubenslehre kosmische Begriffe in der Wissenschaft und den Roshana-Buddha in der Kunst gebiert. Dann wieder sehen wir ihn zu dem intensiven Pantheismus der Heian-Periode, zu dem Emotionalismus der Fujiwara- und der heldenmütigen Mannhaftigkeit der Kamakura-Periode anschwellen.
Dem Wiederaufleben des Shintōismus, der von buddhistischen Elementen größtenteils entkleideten, primitiven Religion der Yamatos, scheint die Meiji-Periode ihre Größe zu verdanken. Der Kunstgenius jedoch bleibt hinter dieser Art von Größe nur allzu oft zurück, und heute sind sich alle Freunde des Orients in ihrer Abneigung und Enttäuschung über die Spaltung von Geschmack und Ideal einig, die dort infolge des Konkurrenzkampfes mit dem Abendland immer weitergeht.
Daher ist es vielleicht an der Zeit, die Völker Asiens wieder auf ihre alten, ursprünglichen Ziele hinzuweisen, in denen ihre Größe lag und die sie heute noch zur alten Größe zurückzuführen vermögen. Es ist von höchster Bedeutung, wenn Okakura den Beweis erbringt, dass Asien keineswegs, wie man bisher annahm, ein Konglomerat geographischer Fragmente darstellt, sondern ein einheitlicher, lebender Organismus ist, in dem jeder einzelne Teil von allen übrigen abhängt und ein einiges und vielfältiges Leben ausströmt.
Zu guter Stunde ist denn auch der orthodoxe Hinduismus in den letzten zehn Jahren, ähnlich wie zur Aśoka-Periode, wieder militant geworden, dank dem Genie eines Wandermönches namens Swāmi Vivekānanda, der nach Amerika verschlagen wurde und sich 1893 auf dem Chicagoer Religionskongress Gehör zu verschaffen wusste. In den letzten sechs bis sieben Jahren sind indische Missionare fortgesetzt nach Europa und Amerika hinübergewandert, um dort eine allgemeine religiöse Bewegung vorzubereiten, welche die intellektuelle Freiheit des in den Naturwissenschaften gipfelnden Protestantismus mit der Fülle katholischen Spiritualismus vereinigen will. Fast möchte man es für das Los der siegreichen Völker halten, ihrerseits wieder von den religiösen Ideen der Besiegten unterworfen zu werden. «So wie die Lehre des geknechteten Juden» – ich zitiere den vorhin erwähnten großen indischen Denker – «achtzehn Jahrhunderte lang die halbe Erde in ihrem Bann hielt, wird auch die des verachteten Hindus in Zukunft vielleicht die Welt beherrschen.» Hierauf ruht die Hoffnung Nordasiens. Der gleiche Vorgang, der zu Beginn unserer Zeitrechnung ein Jahrtausend dauerte, kann sich mit Hilfe von Dampfkraft und Elektrizität heute in wenigen Jahrzehnten abspielen. Vielleicht wird die Zeit ein zweites Mal Zeuge von der Indisierung des Ostens sein.
Ist das der Fall, so wird eine Wiedergeburt der Kunstideale Japans, ähnlich der im vorigen Jahrhundert stattgehabten Wiedererweckung des Mittelalters in England, eine ihrer zahlreichen Folgen sein. Und wie wird die gleichzeitige Entwicklung in China und Indien verlaufen? Denn was das östliche Inselreich beeinflusst, beeinflusst auch die übrigen Länder. Unser Autor hat sein Buch umsonst geschrieben, wenn es ihm nicht gelungen ist, den Satz, der an der Spitze dieses Werkes steht, unwiderleglich zu beweisen: «Asien, die große Mutter, ist eine Einheit, von Ewigkeit her.»
Nivedita, von Rāmakrishna-Vivekānanda,Bagh Bazaar, Kalkutta
Der Machtbereich der Ideale
Ganz Asien ist eins. Der Himālaya scheidet wohl zwei gewaltige Kulturen, die chinesische mit dem Kommunismus des Konfuzius und die indische mit dem Individualismus der Veden, aber er trennt sie nur, um ihr Gemeinsames deutlicher hervortreten zu lassen. Selbst an seinen Schneewänden brach sich zu keiner Stunde der breite Strom der Sehnsucht nach dem Urgrund und dem Urziel allen Seins, die als gemeinsames Gedankenerbe alle Rassen Asiens befähigte, sämtliche großen Religionen der Erde zu gebären und sie von den seefahrenden Völkern des Mittelmeers und der Ostsee unterschied, deren Liebe zum einzelnen mehr den Äußerungen des Lebens als seinen Endzwecken nachhing.
Bis hinauf in die Tage der mohammedanischen Eroberungen kamen die kühnen Seefahrer von der bengalischen Küste auf den alten Heerstraßen des Meeres, gründeten ihre Kolonien auf Ceylon, Java und Sumatra, mischten ihr arisches Blut mit dem der Küstenvölker von Birma und Siam und banden so durch wechselseitigen Verkehr Cathay und Indien fest aneinander. Lange Jahrhunderte einer Systole folgten der Epoche Mahmuds von Ghazni im elften Jahrhundert. Die Kraft Indiens zu geben war gelähmt. Es zog sich in sich selbst zurück, und China hatte allzu viel mit seiner Erholung von den Schlägen der mongolischen Tyrannei zu tun, um seine Stellung als intellektuelle Gastgeberin nicht einzubüßen. Aber der alte, starke Drang zum Verkehr lebte wieder auf in der Hochflut der Tatarenhorden, deren Wogen, zurückgeworfen von den Bergwänden des Nordens, über das Pandschab hereinbrachen. Die Hūna, die Saken und die Geten (Yüeh-chi), die rauen Ahnen der heutigen Rājputen, waren die Vorläufer jenes großen mongolischen Einbruchs, der unter Dschingis-Khan und Tamerlan das Reich des Himmels überschwemmte, es mit dem Tantrismus Bengals [Anmerkung 1] übergoss und, die indische Halbinsel durchflutend, den muslimischen Imperialismus mit mongolischen Staatsgedanken und Kunstideen verfärbte.
So unleugbar Asien eine Einheit ist, sind seine Rassen Maschen eines einzigen Gewebes. Wir vergessen in unserer an Klassifikationen so reichen Zeit, dass Typen doch schließlich nichts sind als leuchtende Unterscheidungsmale in dem Ozean der Ähnlichkeiten, nichts als aus Nützlichkeitsgründen ureigens zur Anbetung aufgerichtete falsche Götter, die letzten Endes und für sich betrachtet keinen größeren Wert haben als zwei trotz ihrer Verwandtschaft isolierte wissenschaftliche Disziplinen. Wenn die Geschichte Delhis eine Darstellung davon ist, wie der Tatare sich einer mohammedanischen Welt aufdrängte, so muss man sich vor Augen halten, dass die Geschichte Bagdads und seiner sarazenischen Kultur gleichermaßen ein Ausdruck ist für die Macht, mit der die semitischen Völker chinesische so gut wie persische Sitten und Kunst angesichts der Mittelmeerstaaten verbreiteten. Arabische Ritterlichkeit, persische Poesie, chinesische Ethik und indische Philosophie, alles spricht von einem einheitlichen, friedvollen Asien, wo eine gemeinsame Lebensweise erstand, die wohl in verschiedenen Gegenden verschiedene charakteristische Blüten zeitigte, aber doch nirgends eine klare, scharfe Trennungslinie aufkommen ließ. Selbst den Islam könnte man als einen Attacke reitenden, Schwert tragenden Konfuzianismus bezeichnen. Denn man kann unschwer in dem uralten Kommunismus des «Gelben Tales» die Spuren des reinen Hirtenelements finden, wie es sich uns unverfälscht in den muslimischen Rassen verkörpert.
Auch der Buddhismus, um vom westlichen wieder auf das östliche Asien zurückzukommen, dies weite Meer des Idealismus, in das alle Stromsysteme ostasiatischer Philosophie münden, hat seine Farbe nicht allein von den reinen Wassern des Ganges. Die tatarischen Nationen, die sich ihm verbündeten, brachten ihm auch die Tribute ihres Geistes und mehrten durch einen neuen Symbolismus, eine neue Organisation und neue Kräfte der Hingabe, die Schätze «des Glaubens».
Mit ausgesprochener Deutlichkeit verkörpert Japan diese Einheit in der Vielfältigkeit. Darin liegt seine Sonderstellung. Das indo-tatarische Blut der japanischen Rasse war an und für sich schon ein Erbteil, das sie befähigte, aus zwei Quellen zu schöpfen und zum Spiegel der gesamten Gedankenwelt Asiens zu werden. Das seltene Glück ununterbrochenen Herrentums, das stolze Selbstvertrauen einer unbesiegten Rasse und die insulare Abgeschlossenheit, die althergebrachter Denk- und Gefühlsweise, wenn auch auf Kosten ihrer Weiterverbreitung, Schutz bot, machten Japan zum Schatzhaus asiatischen Geistes und Geisteslebens. China dagegen haben die dynastischen Umwälzungen, die Einfälle tatarischer Reiterscharen, die Metzeleien und Verwüstungen rasender Pöbelmassen, die es immer und immer von Neuem durchfegten, die alten Marksteine genommen. Nur seine Literatur und seine Ruinen mahnen noch an den Glanz der T’ang-Kaiser oder an die Verfeinerung der Gesellschaft zur Zeit der Sung-Periode.
Die Größe Aśokas, des asiatischen Weltherrschers in der Vollendung, dessen Dekrete den Diadochenfürsten Antiochiens und Alexandriens religiöse Vorschriften diktierten, ruht fast vergessen unter den zerfallenen Bauten von Bharhut und Bodhgayā. Der diamantenreiche Hof Vikramādityas ist nur ein entschwundener Traum, den selbst die Dichtungen Kālidāsas kaum heraufzubeschwören vermögen. Die höchsten Leistungen indischer Kunst sind fast restlos getilgt durch die Rohheit der Hūna, die fanatischen Bilderstürmereien der Mohammedaner und den unbewussten Vandalismus des gewinnsüchtigen Europa. Uns ist nichts geblieben als die verblasste Pracht der Wände von Ajantā, die verstümmelten Skulpturen Elloras, die stummen Anklagen des felsgehauenen Orissa und schließlich die Schönheit des Hausgerätes unserer Tage, die sich mit einer gewissen Wehmut inmitten eines feinfühligen Familienlebens noch an das Religiöse klammert.
Einzig und allein in Japan kann der historische Reichtum der asiatischen Kultur [Anmerkung 2] lückenlos erfasst werden, denn es beherbergt eine Fülle von Beweisstücken. Die Kaiserliche Sammlung, die Shintō-Tempel und die erschlossenen Dolmen entschleiern uns die künstlerische Feinheit der Arbeiten aus der Han-Zeit. Die Tempel von Nara sind reich an Denkmälern der T’ang-Kultur und der indischen Kunst, die damals in ihrer höchsten Blüte die Schöpfungen jener klassischen Periode stark beeinflusste. All das sind natürliche Erbstücke einer bedeutsamen Zeit, die nur ein Volk unversehrt zu erhalten vermochte, das sich wie die Japaner auch die Musik, die Sprache, die Gebräuche und die Kleidung – von den religiösen Riten und der Philosophie ganz zu schweigen – zu bewahren gewusst hat.
Die Schatzkammern der Daimyō sind voll von Kunstwerken und Handschriften aus der Sung- und Mongolen-Dynastie. Da in China selbst die Erstgenannten während der mongolischen Eroberung und die Letztgenannten unter der reaktionären Ming-Herrschaft verloren gegangen sind, sehen sich heutzutage viele chinesische Gelehrte genötigt, in Japan die Hauptquellen ihrer eigenen, uralten Wissenschaft zu suchen.
So ist Japan recht eigentlich ein Museum der asiatischen Kultur. Aber es ist mehr als nur Museum. Der eigenartige Geist der Rasse hält alle P»n der philosophischen Ideale der Vergangenheit gegenwärtig. Ein lebendiger Advaitismus heißt das Neue willkommen, ohne das Alte aufzugeben. Das Shintō übt noch die präbuddhistischen Riten des Ahnenkultus, und die Buddhisten wieder lassen von keiner der verschiedenen Schulen religiöser Entwicklung, die in natürlicher Folge den Boden befruchtet haben.
Die Yamato-Poesie [Anmerkung 3] und die Bugaku-Musik [Anmerkung 4], die das T’ang-Ideal unter dem Regiment der Fujiwara-Aristokratie widerspiegeln, sind dem Japaner von heute nicht minder Quelle der Begeisterung und Freude als das düstere Zen und die dramatischen Nō-Tänze, die der Sung-Eingebung entstammen. Mit der gleichen Zähigkeit, mit der sich Japan zur Stellung einer modernen Großmacht erhebt, hält es seiner asiatischen Seele die Treue. So wird die Geschichte der japanischen Kunst zur Geschichte der religiösen und philosophischen Ideale Asiens. Sie ist der Strand, auf dem jede Welle östlichen Denkens ihre Spur hinterlassen hat, sobald sie überhaupt die Rasse bewusst traf. Und dennoch halte ich furchtsam schon an der Schwelle des Versuchs inne, eine klare Zusammenstellung dieser Kunstideale zu geben. Denn wie das Diamantennetz Indras spiegelt die Kunst in jedem Glied die ganze Kette. Zu keiner Zeit gibt es eine endgültige, feste Form. Kunst ist ein beständiges Werden, das dem Seziermesser des Chronisten trotzt. Man kann kein Einzelstadium behandeln, ohne unendlichen Ursachen und Wirkungen durch die gesamte Vergangenheit und Gegenwart nachgehen zu müssen. Unsere Kunst ist wie jede andere auch Ausdruck des Höchsten und Edelsten in der nationalen Kultur. Um sie verstehen zu können, muss man all die verschiedenen P»n konfuzianischer Philosophie an sich vorüberziehen lassen. Man muss die verschiedenen Ideale, die der Buddhismus mit der Zeit entwickelt hat, die gewaltigen politischen Zyklen, die nacheinander das Banner der Nationalität entfaltet haben, überschauen. Man sehe, wie Licht der Poesie und Schatten heroischer Gestalten im Volksempfinden reflektieren, und höre das Echo, wie es das Wehgeschrei einer Masse, wie es die ausgelassene Freude eines Volkes wachruft.
Eine Geschichte japanischer Kunstideale ist also nahezu eine Unmöglichkeit, solange die westliche Welt nicht mehr von der vielseitigen Umgebung und den mannigfachen sozialen Beziehungen weiß, in die unsere Kunst gleich einem Edelstein gefasst ist. Definieren hieße begrenzen. Die Schönheit einer Wolke oder einer Blume liegt in dem ungezwungenen Entbreiten ihres Selbst. Besser als ein Abriss unumgänglicher Halbwahrheiten vermag die stumme Beredsamkeit meisterlicher Werke die Geschichte ihrer Epoche zu schildern. Meine schwachen Versuche wollen nicht Geschichte, sondern nur Wegweiser sein.
Die primitive Kunst Japans
Die Herkunft der Yamato-Rasse, die die ureingesessenen Ainu nach Ezo und den Kurilen vertrieb, um das Reich der Aufgehenden Sonne zu begründen, ist tief verhüllt in den Nebeln des Ozeans, dem dieses Volk eines Tages enttauchte, und die Quelle ihres Kunsttriebes lässt sich unmöglich mehr ergründen. Ob die Yamato ein Überrest der Akkadier sind, die auf ihren Fahrten längs den Küsten und Inseln Ostasiens ihr Blut mit dem indo-tatarischer Völker vermischten; ob sie ein abgesprengter Teil der türkischen Horden sind, die ihren Weg durch die Mandschurei und Korea suchten, um sich früh schon am indisch-pazifischen Ozean niederzulassen; oder ob sie die Nachkommen arischer Wanderstämme sind, die über die Pässe von Kaschmir stießen, in den turanischen Völkern aufgingen, aus denen Tibeter, Nepalesen, Siamesen und Birmanen wurden und die Kinder des Yang-tse-kiang mit den Kräften des indischen Symbolismus bereicherten, all das sind Fragen, die noch in dem Wolkennebel archäologischer Mutmaßung schweben.