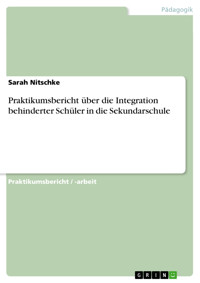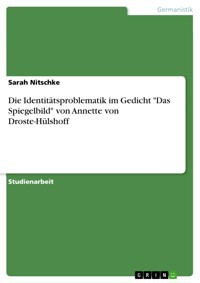
Die Identitätsproblematik im Gedicht "Das Spiegelbild" von Annette von Droste-Hülshoff E-Book
Sarah Nitschke
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,0, Universität Erfurt, Sprache: Deutsch, Abstract: In meiner selbständigen Hausarbeit möchte ich mich mit der Identitätsproblematik des lyrischen Ichs in Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht „Das Spiegelbild“ beschäftigen, welches 1841 verfasst wurde. Dieses Gedicht kann für das literarische Verständnis der Werke von Droste-Hülshoff sehr hilfreich sein, jedoch möchte ich mich konkret im Kontext der Identitätssuche mit dem Gedicht befassen. Sehr passend zum Thema der Identität ist das Gedicht „Das Spiegelbild“, da „[d]ie einzelnen Strophen zeigen, wie sich die Bespiegelung im Spiegel in eine faszinative und zugleich verstörte Innenschau verwandelt“.1 Annette von Droste-Hülshoff beschäftigt sich in ihren Werken hauptsächlich mit Themen, die sie selbst seit dem Kindesalter kannte oder durch Erfahrung kennen lernte2.[...] 1 Gössmann 1985, S.32 2 Vgl. Gössmann 1985, S.13
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhaltsangabe
1 Einleitung
2 Die Identitätsproblematik im Gedicht „Das Spiegelbild“ von Annette von Droste-Hülshoff
2.1 Das Spiegelmotiv
2.2 Interpretation und Analyse: Die Identitätssuche des lyrischen Ichs
3 Fazit
4 Literatur- und Quellenangaben
5 Anhang
1 Einleitung
In meiner selbständigen Hausarbeit möchte ich mich mit der Identitätsproblematik des lyrischen Ichs in Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht „Das Spiegelbild“ beschäftigen, welches 1841 verfasst wurde. Dieses Gedicht kann für das literarische Verständnis der Werke von Droste-Hülshoff sehr hilfreich sein, jedoch möchte ich mich konkret im Kontext der Identitätssuche mit dem Gedicht befassen. Sehr passend zum Thema der Identität ist das Gedicht „Das Spiegelbild“, da „[d]ie einzelnen Strophen zeigen, wie sich die Bespiegelung im Spiegel in eine faszinative und zugleich verstörte Innenschau verwandelt“.[1]
Annette von Droste-Hülshoff beschäftigt sich in ihren Werken hauptsächlich mit Themen, die sie selbst seit dem Kindesalter kannte oder durch Erfahrung kennen lernte[2].
Anna Elisabeth von Droste-Hülshoff, geboren am 12. Januar 1797 auf dem Wasserschloss Hülshoff bei Münster, ist die erste wirklich bedeutende Dichterpersönlichkeit Westfalens, so Freund[3]. Annette von Droste-Hülshoff wuchs sehr wohlbehütet auf und wurde von ihrer Mutter und diversen Hauslehrern streng erzogen. Die ersten Gedichte verfasste Droste-Hülshoff zwischen 1804 und 1808, welche eine Freude am realistischen Stil sowie eine scharfe Beobachtungsgabe erahnen ließen.
Annette von Droste-Hülshoff lebte in einer Zeit, in der Frauen von der männlichen Gesellschaft unterdrückt wurden. Schon in frühen Jahren beklagte die Droste die männliche Autorität und die damit zusammenhängende Unmündigkeit der Frau[4].
Annette von Droste-Hülshoff verstarb am 24. Mai 1848 nach heftigem Bluthusten auf der Meersburg[5].
In meiner Hausarbeit möchte ich mich als erstes mit dem Spiegelbegriff in der Literatur allgemein befassen, da dieser literarisch gesehen eng mit dem Persönlichkeitsbegriff verknüpft ist. Dies wird für die darauf folgende Interpretation des Gedichts und der damit verbundenen Identitätsproblematik des lyrischen Ichs eine wichtige Rolle spielen. Ich möchte klären, worin die Identitätsproblematik besteht und wie das lyrische Ich dieses Problem lösen kann. Ich werde als erstes erläutern, wie sich das lyrische Ich selbst im Spiegel sieht. Als zweiten Punkt werde ich die Gegensätzlichkeiten benennen, die das lyrische Ich mit seinem Spiegelbild vergleicht und als dritten Punkt werde ich die Identitäsfindung des lyrischen Ichs erläutern. Neben der Interpretation werde ich das Gedicht auch hinsichtlich seiner Struktur und Stilistik analysieren.
2 Die Identitätsproblematik im Gedicht „Das Spiegelbild“ von Annette von Droste-Hülshoff
2.1 Das Spiegelmotiv
Der Deutungsursprung des Spiegelmotivs liegt in der Auffassung, die Seele würde die Gegenwart Gottes widerspiegeln. Im Zuge der Auflösung des festen christlichen Weltbildes verlagert sich die Verweisfunktion des Spiegels dahingehend, dass die Spiegelung nicht nur die Anwesenheit Gottes reflektiert, sondern auf innere Probleme der Menschen, Verunsicherung sowie Furcht verweist. Der Spiegel beleuchtet Störungen der Persönlichkeit und fördert dadurch die Identitätserkundung, da er Knotenpunkt zwischen Wahrheitserfahrung und dem Unbekannten ist[6].
Schon im Märchen „Schneewittchen“ spielt das Spiegelmotiv eine wichtige sowie magische und Wahrheit eröffnende Rolle. Der Spiegel bringe die Wahrheit an den Tag, indem er durch das Abbild der Erscheinung das innere Wesen und damit das totale Sein eines Menschen zeige[7]. In Märchen allgemein zeigt der Spiegel Wunschträume, Phantasien und Erscheinungen geliebter Personen auf. Laut einer griechischen Sage findet Narziss seine Selbstliebe, indem sich sein Gesicht im Wasser eines Brunnen spiegelt. Der Sinngehalt des Spiegelmotivs hat seine Funktion über Jahrhunderte bewahrt[8]. Oft kehrt es in der Hand von Frauen wieder, wo er sowohl Sinnbild von Weisheit und Gerechtigkeit sein kann als auch das Schöne und den Stolz widerspiegelt[9]. Das Spiegelbild zeigt die menschliche Verfassung auf, gibt Anlass zur Seinsorientierung und stellt weiterhin eine feste gedankliche Verbindung zwischen Gott und dem Menschen dar[10].
Das Spiegelbild ist mit einer „zweiten Haut“ vergleichbar oder, im weiteren Sinne, mit der Sichtbarmachung der Seele. Die Abbilder, die Spiegel schaffen, machen Menschen zu Individuen, die über die Reflexionsmöglichkeit des Ich verfügen[11]. Das Spiegelbild stellt des Weiteren die Identität mit seinem Urbild dar, welches im Abbild erkennbar wird[12]. Spiegel ermöglichen „die Gestalt des Menschen zu reflektieren, sein Wesen in irgendeiner Form widerzuspiegeln, weshalb sie auch mit seiner Natur in eine seelische Wechselbeziehung treten können“[13]. Es sei wichtig, den geheimnisvollen und doch vertrauten Doppelgänger zu akzeptieren. Aus dem Spiegel tritt sozusagen eine Doppelgängerfigur heraus, wie es auch in von Droste-Hülshoffs Gedicht passiert. Es kommt sozusagen zu einer Ich-Spaltung. Diese erdachten Doppelgänger ermöglichen eine Darstellung von „Eigenschaften, die eine Person in ihrer besonderen psychologischen Verfassung ausweisen“[14]. Doppelgänger spiegeln Wünsche, Ahnungen und Befürchtungen wider und lassen Gefühle erkennen, die die Person selbst nicht aussprechen kann. Sie geben daher die psychologische Innensicht der Person wieder.
Ende des 18.Jahrhunderts nimmt die Darstellung der Bewusstseinsinhalte einzelner Figuren durch Ich-Projektionen zu. In der Literaturepoche der Annette von Droste-Hülshoff, im Biedermeier und Vormärz, sind Spiegel und Spiegelungen Mittel der Darstellung der Unergründbarkeit der menschlichen Seele. Speziell im Werk von Droste-Hülshoff zeigt der Spiegel das Unheimliche auf, das in der Psyche des Menschen schlummert, und lässt dieses hervortreten[15]. Auch das Motiv des Doppelgängers findet hierbei Verwendung. Das Doppelgängermotiv ist Methode „zur Darstellung der Vielschichtigkeit und Komplexität der Identität des Menschen“[16]. Diese Aussage zielt genau auf das „Spiegelbild“ - Gedicht von von Droste-Hülshoff ab, denn das lyrische Ich kann sich anfangs nicht damit abfinden, ein komplexes Individuum mit guten aber auch nicht so guten Charakterzügen zu sein.
2.2 Interpretation und Analyse: Die Identitätssuche des lyrischen Ichs
Aufgrund der reaktionären Politik der Zeit der Restauration, befindet sich das Volk dieser Zeit in einer nachrevolutionären Phase zunehmender Kollektivierung und persönlicher Enttäuschung. Das Denken dieser Zeit war geprägt von Freiheitshoffnungen[17]. Es galt, sich mit sich selbst als Opfer auseinanderzusetzen, um sich der Gefährdung seiner menschlichen Existenz bewusst zu werden. In dieser Zeit der Unterdrückung des Individuums wurde auch in der Literatur das Thema der Identitätsproblematik häufig behandelt und wurde zu einem „Medium subjektiver Selbstbehauptung in einer sinnlos scheinenden Welt“[18].
Dabei gestaltete Annette von Droste-Hülshoff Lyrik „von unverwechselbarer Eigenart und innovativer Originalität, Zeugnisse literarischen Selbstbewusstseins und künstlerischer Reife“[19]. Es ist typisch für Werke von Annette von Droste-Hülshoff, die Gegenwertigkeit der Dinge mit einem Doppelblick zu begutachten und in die ungestalteten Abgründe des Seins hinab zu tauchen[20]. Insbesondere schätze sie in ihren Werken eine gefühlvolle Annäherung an das eigene Selbst, wie es auch in ihrem 1842 entstandenen Gedicht „Das Spiegelbild“ deutlich wird. Dieses Gedicht ist streng mit dem romantischen Motiv der Personenspaltung sowie des Doppelgängers verbunden, wobei die barocke Vorstellung, dass die Menschheit von höheren Mächten abhängig sei, sichtbar wird[21].
Das Gedicht „Das Spiegelbild“ ist in sechs Strophen unterteilt, welche jeweils aus sieben Versen bestehen. Das Versmaß ist ein vierhebiger Jambus. Außer Vers drei und sieben jeder Strophe enden alle Verse auf eine betonte und somit männliche Silbe. Bezüglich des Reimschemas ist das Gedicht sehr kompliziert aufgebaut. Verse eins und zwei ergeben in jeder Strophe einen Paarreim, wobei die Verse drei und sieben jeweils den Haufenreim der Verse vier, fünf und sechs umschließen. Daraus ergibt sich das Reimschema: a, a, b, c, c, c, b.
Das Gedicht stellt den Umgang des lyrischen Ichs, von dem der Leser weder Alter noch Geschlecht erfährt, mit seinem Spiegelbild dar.
Beim ersten Lesen des Gedichts fällt auf, dass es viele Adjektive enthält, beispielsweise wunderlich (Z.4), warme (Z.9) oder dunkel (Z.10). Die im Gedicht verwendeten Substantive lassen sich des Weiteren in verschiedene Wortfelder zusammenfassen. Während Nomen wie Nebelball (Z.2), Kometen (Z.3), Seelen (Z.5) und Phantom (Z.7) das Wortfeld des Mystischen betreffen, beschreiben Nomen wie Moses (Z.31) und Gott (Z.34) ein religiöses Wortfeld.
In Strophe eins beschreibt das lyrische Ich die Ungleichheit zwischen ihm und seinem Spiegelbild. Der Spiegel selbst wird hierbei als Kristall (Z.1) metaphorisiert. Diese Metapher deutet darauf hin, dass der Spiegel sein Gegenüber perfekt abbildet und zeigt, dass das lyrische Ich nur mit dem Spiegelbild vollkommen ist.
Ganz nach dem Vorbild Goethes und dessen Faust, wohnen in den Augen des Spiegelbilds zwei Seelen (Z.5), welche sich nicht gleichen und wie Spione (Z.5) lauernd umeinander schleichen. Die Zerrissenheit und Zwiespältigkeit des Eindrucks über das Gedicht wird durch die sich offensichtlich im Kampf befindenden zwei Seelen hervorgerufen[22]. Das lyrische Ich fühlt sich von seinem Spiegelbild angestarrt. Zwischen den Zeilen fünf und sechs findet sich ein Enjambement, welches die Dringlichkeit der Aussagen des lyrischen Ichs demonstriert. Für das lyrische Ich stellt sein Spiegelbild nur ein Phantom (Z.7) dar und es kann sich nicht mit ihm identifizieren. Dies ist möglich, da dass lyrische Ich nicht in seine Seele hinein sehen kann, da ihm die Augen trüb wie ein Nebelball (Z.2) erscheinen. Das lyrische Ich sieht in seinem Spiegelbild kein Abbild seinesgleichen und hat sich demnach selbst noch nicht gefunden. Durch das Gefühl des Unheimlichen beim Anblick des Abbildes entsteht eine Abwehrreaktion beim lyrischen Ich und dadurch eine Nicht-Identifikation mit dem Spiegelbild sowie die Abgrenzung dessen als fremdes Nicht-Ich[23]. Es scheint gebannt von seinem Spiegelbild und somit von der Selbsterkundung, doch kann sich das lyrische Ich im eigenen Abbild nicht erkennen und nimmt somit Abstand, indem es sagt: „[d]u bist nicht meines Gleichen!“ (Z.7). Das lyrische Ich versucht zum Schutz seiner bewussten Identität die andere, unbewusste Identität abzuwehren[24].
Die zweite Strophe des Gedichts zeigt die gespaltene Meinung des lyrischen Ichs zu seinem Spiegelbild auf. Dies wird durch die Verwendung von Antithesen noch einmal unterstrichen: eisen – warme (Z.9); dunk[el] – blassen (Z.10); lieben – hassen (Z.14). Das Abbild scheint bedrohlich und Furcht einflößend auf das lyrische Ich zu wirken. Damit scheint das lyrische Ich Angst vor seinem eigenen Inneren und den damit verbundenen unterdrückten (unmoralischen) Charakterzügen zu haben. Es schiebt sein Spiegelbild in das Traumreich ab, um sich von der Angst vor ihm zu distanzieren und es als Imagination ab zu tun, um sich dadurch zu beruhigen. Im Traum kommt jedoch auch das Unbewusste an das Tageslicht, was wiederum zeigt, wie wenig das lyrische Ich die Annäherung zu sich selbst findet. Genau wie Dchuang Dsi träumte, er sei ein Schmetterling und nach dem Erwachen nicht wusste, ob er ein Mensch sei, der träumte ein Schmetterling zu sein oder ein Schmetterling, der nun träumt ein Mensch zu sein[25], so scheint auch das lyrische Ich unentschlossen, ob das Spiegelbild wirklich Teil seiner selbst oder nur ein schlechter Traum ist. Der Konflikt zwischen dem lyrischen Ichs als Urbild und dem Spiegelbild als Abbild besteht in der Auseinandersetzung zwischen dem akzeptiert Bewussten und dem unerwünscht Unbewussten[26]. Das Bewusste stellt dabei die Normen und Moralvorstellungen der Gesellschaft dar, das Unbewusste die Triebe und Charakterzüge der einzelnen Person. Da das lyrische Ich diese von der Gesellschaft auferlegten Forderungen und Vorstellungen nicht erfüllen kann, möchte es von seinem Abbild, welches die unbewussten Triebe des lyrischen Ichs widerspiegelt, Abstand nehmen.
Obwohl sich das lyrische Ich vor seinem Spiegelbild fürchtet und es ihm das warme Blut (Z.9) eist, erkennt es langsam das Doppellicht (Z.12) in dem Abbild. Wie es dem Doppelgänger bei Austreten aus dem Spiegel jedoch gegenüber stehen würde, weiß das lyrische Ich nicht. Es steht hierbei in einem Gefühlskonflikt zwischen Liebe und Hass (Z.14). Das lyrische Ich kann seine bewusste Identität nur solange aufrechterhalten, wie das Unerwünschte abgewährt werden kann[27].
In den folgenden zwei Strophen betrachtet das lyrische Ich sein Abbild genauer und beschreibt es, als würde es ihm wie ein Doppelgänger gegenüber stehen. Dabei beschreibt es die Gegensätzlichkeiten der Charaktereigenschaften des Spiegelbilds. Das Spiegelbild ist nun eingebettet zwischen den Polen des Kognitiven und Emotionalen[28]. Durch diese dargestellte Polarität rückt der Eindruck, das lyrische Ich sei zerrissen, zurück, und wird durch einen Eindruck der Totalität ersetzt. Die kognitive und emotionale Seite ist allerdings noch einmal zweigeteilt, was bei der Analyse der Strophen drei und vier deutlich wird.
In Strophe drei beschreibt das lyrische Ich seinen Respekt vor der Vernunft. Es würde schüchtern zu der Stirn des Doppelgängers blicken (15ff.). Die Gedanken personifiziert Annette von Droste-Hülshoff im Gedicht als Knechte, die Frohn leisten. Der Vergleich mit den Knechten stellt dar, dass die Gedanken kontrollierbar scheinen, genau wie Knechte. Hier herrscht ein „Ambivalenzkonflikt“, da das Ich unterworfen und damit gezwungen werde, das zu tun, was das übermächtige Über-Ich von ihm verlange[29]. Der Vergleich der Gedanken mit Knechten stellt demnach ein „Depersonalisierungserlebnis“ dar. Zwischen den Versen 16 und 17 findet sich ein Enjambement, welches wiederum die Erregtheit des lyrischen Ichs widerspiegelt.
Die Augen sind für das lyrische Ich etwas Unbekanntes und Fremdes, von dem es sich zu distanzieren gilt. Das Auge ist ein literarisches Motiv mit Spiegelfunktion, da man durch dieses in die Seele des Menschen blicken könne. Es gilt als ein „Zugang zum Herzen und Fenster zur Welt, wird zum Schnittpunkt, in dem sich das ´Ich´ und das ´Du´ begegnen“[30].
Das lyrische Ich vergleicht hier das Rationale, das durch das Motiv der Stirn ausgedrückt wird, und das Irrationale, für was die gespenstisch wirkenden Augen stehen. Das Erkennen sitzt damit direkt unter den Gedanken und somit besitzt das Abbild neben der Eigenschaft des Denkens auch „die Fähigkeit, die Grenzen der intelligiblen Welt zu überschreiten“[31]. Aber nur durch diese Wahrnehmungsfähigkeit kann das Urbild sein Abbild erkennen. Hier zeigt sich nun die Abwendung des lyrischen Ichs vom Irrationalen und somit von seiner eigenen irrationalen Seite. Dies spiegelt wiederum die einseitige Existenz des lyrischen Ichs wider. Diese Abkehr entspringt allerdings nicht aus persönlichen, sondern aus sozialen Beweggründen, da sich das lyrische Ich den Moralvorstellungen der Gesellschaft entsprechend geben möchte[32].
Schon der Philosoph Descartes, der im 17.Jahrhundert lebte, beschrieb den Menschen als Doppelwesen, „das sowohl denkt als auch Raum einnimmt“[33]. Nach Descartes besteht der Mensch aus einer Seele und einem Körper. Nach Freund (Was bleibt, 90) folgt Annette von Droste-Hülshoff folgt bezüglich der emotionalen Ebene dem cartesianischen Dualismus, der Lehre von den zwei Substanzen. Dieses spiegelt sich in der Auffassung wider, dass das lyrische Ich aus zwei Seelen bestehe. Erst beide Seiten zusammen ergeben den vollkommenen Menschen. Um seine ganze Identität zu finden, muss das lyrische Ich daher beide Seelen akzeptieren und sie als seine eigenen annehmen[34].
In Strophe vier führt das lyrische Ich mit der Beschreibung des Gesichtes vom Spiegelbild fort und beschreibt nun den Mund, welcher unter Stirn und Augen liegt und Zone des Sanften und des Weichen ist. Hier bilden nun das Gedankliche und das Sinnliche die entgegengesetzten Pole. Es zeigt sich wieder die Unentschlossenheit des lyrischen Ichs bezüglich der Zuneigung oder Ablehnung des Mundes. Einerseits sei der Mund unschuldig und hilflos wie ein Kind (Z.23), andererseits können aus diesem Mund auch schreckliche Worte fließen. Die Gesellschaft befürwortet emotionale Sanftheit, verpönt aber jegliche Art von Aggressionen. Der Mund kann wie eine Waffe, wie ein gespannte[r] Bogen (Z.26), sein, wenn er verletzende Worte abfeuert. Das lyrische Ich fühle sich dadurch zur Flucht getrieben (Z.28), wobei es wieder zu einer Distanzierung zum Spiegelbild kommt, da der Mund mit seinen zwiespältigen Eigenschaften nicht alle gesellschaftlichen Erwartungen erfüllen kann. Das Menschenbild der Annette von Droste-Hülshoff zeigt sich als sehr komplex und realistisch, da es Gegensätze vereint (Rational und Irrational, sanft und aggressiv) und alle Einseitigkeiten vermeidet[35]. Es wird deutlich, dass das Spiegelbild das ganze Bild der Persönlichkeit widerspiegelt und sich daraus die Unteilbarkeit dieser ergibt.
Auffällig ist, dass den negativen Seiten des Abbildes immer mehr Verse einer Strophe gehören als den Eigenschaften, die die Gesellschaft erwartet. In den letzten Zeilen der Strophen zeigt sich jeweils die Reaktion des lyrischen Ichs auf sein Spiegelbild – die Distanzierung und Ablehnung. Da die negativen und positiven Eigenschaften des Spiegelbilds trotz allem durch das Reimschema verbunden sind, wird deutlich, dass sie zusammen ein Ganzes ergeben und bezüglich der Persönlichkeit eines Menschen nicht zu trennen sind. Da das lyrische Ich jedoch in die Moralvorstellungen der Gesellschaft gedrängt wird, wertet es die negativen Eigenschaften des Spiegelbilds und damit die eigenen ab, um ein positives Bild in der Gemeinde zu haben. Das lyrische Ich erkennt zwar seine negativen Charakterzüge bei der Gegenüberstellung und Auswertung des Spiegelbildes, aber möchte diese dennoch nicht als seine eigenen akzeptieren[36].
Die beiden letzten Strophen zeigen den Versuch eines abschließenden Urteils, bei dem das lyrische Ich sowohl als öffentliche als auch als private Person Richter und Ankläger zugleich ist[37]. Das Ich versucht anfangs noch einmal, das Spiegelbild und damit seine versteckte Identität zurück zu weisen und damit eventuellen Sanktionen durch die Gesellschaft zu entgehen.
In Strophe fünf unterstreicht das lyrische Ich noch einmal, dass das Spiegelbild nicht seinesgleichen ist: „Es ist gewiß, du bist nicht Ich“ (Z.29). Auch die Wiederholung des Adjektivs fremd in Zeile 30 und 33 verdeutlicht wieder die Distanz, die das lyrische Ich zwischen sich und dem Spiegelbild schaffen möchte. Ein weiteres sprachliches Mittel ist in den Zeilen 32 und 33 zu finden, wo an beiden Versanfängen das Wort voll steht. Es handelt sich hierbei um eine Anapher. In Vers 33 findet sich weiterhin ein Parallelismus: „Voll fremden Leides, fremder Lust“, wodurch die untrennbare Verbindung zwischen lyrischem Ich und Spiegelbild unterstrichen wird. Das lyrische Ich versucht trotz seiner Distanzierungsversuche sich seinem Abbild anzunähern. Hierbei findet ein Vergleich zu Moses statt, der nach einer Biblischen Erzählung auch seine Identität zu finden hatte. In dieser Erzählung nähert er sich barfuss einem brennenden Dornenbusch, um Gottes Befehl, das Volk Israel aus der Knechtschaft zu führen, entgegenzunehmen. So geht auch das lyrische Ich unbeschuhet auf sein Spiegelbild, welches nun in die Position des Göttlichen rückt, zu[38]. In religiöser Hinsicht gilt das Ablegen der Schuhe als fromm und respektvoll. Das lyrische Ich möchte „die Heiligkeit der Erscheinung anerkennen und ihr in Ehrfurcht und Demut begegnen“[39]. Das Spiegelbild wird mit dem Bild Gottes assoziiert und wächst dadurch zu einem Wesen heran, welches das lyrische Ich ehrfürchtig anbetet[40]. Es lässt sich hier erkennen, dass das lyrische Ich zumindest nicht mehr die Möglichkeit ausschließt, das Spiegelbild könne Teil von ihm sein. Es bittet, falls die aufgezählten schlechten Eigenschaften des Spiegelbilds tatsächlich zu seiner Identität gehören, Gott um Gnade (Z.34). Der Bezug zum Christentum ist hier natürlich sehr deutlich. An dieser Stelle muss beachtet werden, dass das Christentum – so eine der Thesen aus dem Seminar „VerWandlung und Identität“ - eine Religion ist, die Identität einfordert und somit Identitätskrisen oder Doppelgänger regelrecht produziert.
In der sechsten Strophe kann sich das lyrische Ich neben der Angst vor seinem Abbild auch langsam Zuneigung eingestehen. Es beichtet, dass es sich bei Austritt des Doppelgängers aus dem Spiegel nicht fürchten, sondern um sein Verschwinden trauern würde. Würde das Abbild bei Austreten aus dem Spiegel mit dem lyrischen Ichs verschmelzen und es somit zu seiner Identität finden? Oder wäre die Identität des lyrischen Ichs verschwunden, wenn sein Doppelgänger aus dem Spiegel schwinden würde?
Im Verlauf des Gedichts wird dem lyrischen Ichs klar, dass es ohne sein Spiegelbild nicht vollständig ist und es nur mit ihm seine volle Identität erlangen kann: „[T]rätest aus Kristalles Rund […] – ich würde um dich weinen!“ (Z.39,42). Auch die Erwähnung, dass der Spiegel rund ist, ist ein Hinweis auf das Vollkommene und die Ganzheitlichkeit zwischen dem lyrischen Ichs und seinem Abbild[41]. Hier wird klar, dass die Identitätsfindung für das lyrische Ich sehr wichtig ist und da es nun endlich seine volle Identität mit Hilfe des Spiegelbilds gefunden hat, möchte es diese natürlich auch nicht wieder verlieren. Obwohl das lyrische Ich sein Spiegelbild noch immer als Phantom (Z.40) sieht, erkennt es dies doch als Teil von sich und als lebend (Z.40). Es ist sich bewusst, dass es ohne sein Abbild und die dadurch dargestellten schlechten Charakterzüge nicht vollkommen ist und beginnt, diese zu akzeptieren. Es fühlt sich zum Spiegelbild wie verwandt (Z.36). Das lyrische Ich begreift, dass es falsch war, sein Abbild durch gesellschaftliche Rollenerwartungen zurückzustufen und unkenntlich gemacht zu haben. Es beginnt, sich mit dem auseinanderzusetzen, was die Gesellschaft missbilligt, und sich damit zu identifizieren. Es emanzipiert sich sozusagen vom gesellschaftlichen Druck[42].
Durch die „Reintegration vorher ausgegrenzter Persönlichkeitsanteile“[43] erfolgt das Akzeptieren von bisher abgelehnten Ich-Anteilen, wobei sich ein toleranteres Ich-Ideal herausbildet. Hier findet das Gegenteil des bekannten narzisstischen Identitätsfindungsablaufes statt, da es nach der Abwehr zur Annäherung und Selbstüberwindung sowie schließlich zur Annahme der verdrängten Ich-Anteile kommt.
Auffällig im Gedicht sind die Modiwechsel. Von Vers eins bis zwölf ist der Indikativ zu finden. Dort beschreibt das lyrische Ich noch sein Spiegelbild, dann wechselt der Modus zum Konjunktiv, da das lyrische Ich vom möglichen Heraustreten des Doppelgängers aus dem Spiegel spricht. In Strophe fünf wechselt der Modus wieder zum Indikativ, da das lyrische Ich sicher scheint, mit dem Spiegelbild nichts gemeinsam zu haben und es sich von ihm abwendet. Als das lyrische Ich in Zeile 39 wieder ein mögliches Heraustreten des Spiegelbildes beschreibt, erfolgt wieder der Wechsel zum Konjunktiv.
Die Satzebene des Gedichts spiegelt die Tiefgründigkeit der Konfrontation zwischen dem lyrischen Ichs und seinem Spiegelbild wider. Durch das Überwiegen der Hypotaxen wird ein Verständnis manchmal erschwert, da die Sätze sich teilweise über die ganze Strophe hinweg ziehen. In Strophe eins, Vers sieben findet sich die Parataxe: „Phantom, du bist nicht meinesgleichen!“. Dies unterstreicht die Sicherheit des lyrischen Ichs, dass sein Spiegelbild nicht Teil von ihm ist. Auch in Strophe 5 bzw. Vers 29 wurde von der Autorin eine Parataxe gewählt, um die Sicherheit des lyrischen Ichs zu unterstreichen: „Es ist gewiß, du bist nicht ich“. Hypotaxen finden meist Verwendung in Verbindung mit möglichen Ereignissen, wie zum Beispiel dem Heraustreten des Abbildes aus dem Spiegel. Parataxen, die nur wenig verwendet werden, verdeutlichen die Sicherheit des Ichs bezüglich seines Nicht-Ichs auf.
Hinsichtlich der Klangebene ist auffallend, dass sich in Strophe eins helle Assonanzen (ei, e, i) häufen. Dies scheint Ausdruck für die Sicherheit des lyrischen Ichs zu sein, dass es dem Spiegelbild nicht gleicht. In der folgenden Strophe zweifelt das lyrische Ich an der vorher aufgestellten Hypothese: „Phantom, du bist nicht meinesgleichen!“ (Z.7). Dies wird durch die Benutzung sowohl heller als auch dunkler Laute unterstrichen. Harte Konsonanten, beispielsweise k und t, treten in Strophe drei auf, was die Ängstlichkeit des lyrischen Ichs vor seinem Abbild verdeutlicht. Als das lyrische Ich in Strophe vier seine zerrissene Meinung über den Mund preisgibt, treten helle und dunkle Laute wieder gleichermaßen häufig auf. In Strophe fünf begegnen dem Leser gehäuft u-Laute. Dieser dunkle Laut ist beispielsweise in Lust (Z.33) oder Brust (Z34) zu finden. Auch der o-Laut, zum Beispiel bei Moses (Z.31) oder Gott (Z.34) stechen heraus. Diese dunklen Assonanzen unterstützen den Wunsch des lyrischen Ichs, das Spiegelbild solle nicht schlummernd in seiner Seele ruhen (Z.35). In der sechsten Strophe wird dem lyrischen Ichs die Verbindung zu seinem Spiegelbild bewusst, was durch den weiche Konsonanzen n in dennoch (Z.36) oder gebannt (Z.37) verdeutlicht wird. Auch helle Assonanzen wie ä, i, ü sowie der ei-Diphthong finden hierbei Verwendung: trätest (Z.39), Liebe (Z.38), würd (Z.41) und weinen (Z.42).
Der Rhythmus des Gedichts deutet immer wieder auf die große Erregtheit des lyrischen Ichs hin, was durch die Enjambements in den Zeilen fünf und sechs sowie 16 und 17 deutlich wird. Der Rhythmus wirkt bis zu Zeile fünf sehr drängend, da an dieser Stelle die Distanz zwischen lyrischem Ich und Spiegelbild am stärksten ist. Als sich das lyrische Ich in Strophe sechs über die Bedeutung seines Abbilds bewusst wird, verlangsamt sich der Rhythmus wieder. Der Rhythmus wird in Zeile 42 durch einen Gedankenstrich unterbrochen, der die Traurigkeit des lyrischen Ichss über das mögliche Verschwinden des Spiegelbilds verdeutlicht und die Nachdenklichkeit des Ichs unterstreicht.
Letztendlich wird deutlich, dass die Dichterin durch eine vergleichende und parallelisierend Sprachkonstruktion die untrennbare Verbindung zwischen dem lyrischen Ichs und seinem Spiegelbild unterstreicht.
3 Fazit
Schlussendlich hat das lyrische Ich seine Identität mit Hilfe des Spiegels finden können. Dieser dient also dazu, dem Ich auch seine schlechten Seiten aufzuzeigen und sie ihm nah zu bringen. Das lyrische Ich kann somit seine volle Identität mit vielschichtigem Charakter erkennen. Es entwirft in einem inneren Dialog mit sich selbst einen Existenzentwurf. Der Blick in den Spiegelbedeutet für das lyrische Ich die momentane Abkehr von Außen und einen Augenblick der inneren Zuwendung[44]. Des Weiteren kann das lyrische Ich dadurch sein Zeitbewusstsein ausblenden und sich ganz auf seine Selbsterkenntnis konzentrieren.
Da die Identitätssuche eine Grundfrage nach dem Wesen der Menschen ist, muss das lyrische Ich sich eingestehen, dass jedes Wesen nicht nur gute Eigenschaften besitzt, sondern auch von einigen schlechten Charakterzügen zeugt. Man kann sagen, dass das Spiegelbild einer Person und das damit dargestellte Selbst-Bildnis immer auch Entwürfe einer eigenen Identität sind.
4 Literatur- und Quellenangaben
Bär, Gerald: Das Motiv des Doppelgängers als Spaltungsphantasie in der Literatur und im deutschen Stummfilm. Amsterdam (u.a.): Rodopi, 2005
Daemmrich, Ingrid; Daemmrich, Horst S.: Themen und Motive in der Literatur: ein Handbuch. 2.Auflage, Tübingen: Francke, 1995
Eicher, Thomas; Wiemann, Volker (Hrsg.): Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft. Paderborn (u.a.): Ferdinand Schöningh, 1996
Forderer, Christof: Ich-Eklipsen. Doppelgänger in der Literatur seit 1800. Stuttgart, Weimar: Metzler, 1999
Freund, Winfried: Die Literatur Westfalens. Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Paderborn: Schöningh, 1993
Freund, Winfried: Annette von Droste-Hülshoff. Was bleibt. Stuttgart (u.a.): Kohlhammer, 1997
Freund, Winfried: Annette von Droste-Hülshoff. München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1998
Gaarder, Jostein: Sofies Welt. Roman über die Geschichte der Philosophie. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 5. Auflage, 1999
Gödden, Walter: Tag für Tag im Leben der Annette von Droste-Hülshoff. 2. Auflage. München (u.a.): Schöningh, 1996
Gössmann, Wilhelm: Annette von Droste-Hülshoff: Ich und Spiegelbild. Zum Verständnis der Dichterin und ihres Werkes. Düsseldorf: Droste Verlag, 2. Auflage, 1985
Häntzschel, Günter: Tradition und Originalität. Allegorische Darstellung im Werk Annette von Droste-Hülshoffs. Berlin (u.a.): Kohlhammer, 1968
Heselhaus, Clemens: Annette von Droste-Hülshoff. Die Entdeckung des Seins in der Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts. Halle (Saale): Niemeyer, 1983
Liebrand, Claudia: Kreative Refakturen. Annette von Droste-Hülshoffs Texte. Freiburg (u.a.): Rombach, 2008
Nettesheim, Josefine: Die geistige Welt der Dichter Annette von Droste-Hülshoff. Münster: Verlag Regensburg Münster, 1967
Schneider, Ronald: Annette von Droste-Hülshoff. Stuttgart: Metzler, 1977
Schwarz, Christopher: Langeweile und Identität. Eine Studie zur Entstehung und Krise des romantischen Selbstgefühls. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 1993
Stendel, Andrea: „It is myself that I remake“. Identitätsprozesse beim lyrischen Schreiben am Beispiel von W.B. Yeats. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2003
Vonhoff, Gert: Naturlyrik. Über Zyklen und Sequenzen im Werk von Annette von Droste-Hülshoff, Uhland, Lenau und Heine. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1998
Weber, Achim Johann: Bild und Abbild. Volkskundlich-anthropologische Studien zum Kulturobjekt des Spiegels. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005
5 Anhang
Das Spiegelbild
Schaust du mich an aus dem Kristall
Mit deiner Augen Nebelball,
Kometen gleich, die im Verbleichen;
Mit Zügen, worin wunderlich
Zwei Seelen wie Spione sich
Umschleichen, ja, dann flüstre ich:
Phantom, du bist nicht meinesgleichen!
Bist nur entschlüpft der Träume Hut,
Zu eisen mir das warme Blut,
Die dunkle Locke mir zu blassen;