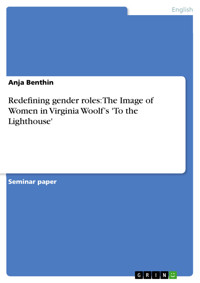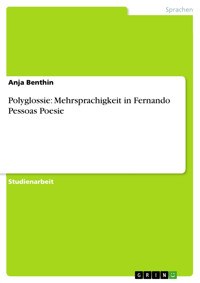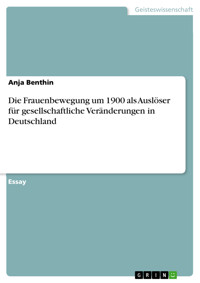0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Französische Philologie - Literatur, Note: 1,3, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Institut für Romanische Sprachen und Literaturen), Veranstaltung: Erzählte Welt aus Kinderaugen, Sprache: Deutsch, Abstract: Azouz Begag, Autor zahlreicher Romane und Erzählungen, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, ist zweifelsohne einer der bekanntesten Vertreter der Littérature Beur. In vielen seiner Romanen scheint er seine eigenen Erfahrungen als Kind algerischer Eltern, aufgewachsen in einem Bidonville Lyons, verarbeiten zu wollen. So wird sein Werk Le gone du Chaâba auch häufig als autobiographischer Roman klassifiziert. In seinen Werken thematisiert er die verschiedensten Probleme der Einwanderungskinder, wie beispielsweise das Leben im Ghetto, Rassismus, Arbeitslosigkeit, aber ebenso das Thema der Identitätsproblematik, der Transkulturalität und der Selbstfindung. Dies wird auch in seinem Roman Le Gone du Chaâba deutlich, in welchem der kleine Azouz seine Identität je nach Situation immer neu definieren muss, um so seinen eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden. Aber wie genau spiegelt sich diese Identitätsproblematik in Le Gone du Chaâba wider? Und inwieweit stellt das Werk eine realistische Widerspiegelung der Identitätsfindung und –bildung eines bi-kulturellen Jugendlichen dar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Die Beurs in Frankreich: Begriffklärung, Entwicklung und Identität
1.2. Beur Kultur: Entstehung einer Littérature Beur
2. Begags Le Gone du Chaâba
2.1. Identitätsproblematik in Le Gone du Chaâba
3. Zusammenfassung
4. Bibliographie
Einleitung
Azouz Begag, Autor zahlreicher Romane und Erzählungen, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, ist zweifelsohne einer der bekanntesten Vertreter der Littérature Beur. In vielen seiner Romanen scheint er seine eigenen Erfahrungen als Kind algerischer Eltern, aufgewachsen in einem Bidonville Lyons, verarbeiten zu wollen. So wird sein Werk Le gone du Chaâba auch häufig als autobiographischer Roman klassifiziert.[1] In seinen Werken thematisiert er die verschiedensten Probleme der Einwanderungskinder, wie beispielsweise das Leben im Ghetto, Rassismus, Arbeitslosigkeit, aber ebenso das Thema der Identitätsproblematik, der Transkulturalität und der Selbstfindung.
Dies wird auch in seinem Roman Le Gone du Chaâba deutlich, in welchem der kleine Azouz seine Identität je nach Situation immer neu definieren muss, um zu beiden Kulturen, der französischen, sowie auch der Algerischen dazuzugehören, und so seinen eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden. Aber wie genau spiegelt sich diese Identitätsproblematik in Le Gone du Chaâba wieder? Und inwieweit stellt das Werk eine realistische Wiederspiegelung der Identitätsfindung und –bildung eines bi-kulturellen Jugendlichen dar.
1. Die Beurs in Frankreich: Begriffklärung, Entwicklung und Identität
Um ein Verständnis für diese Zerrissenheit Azouz’ zwischen den beiden Kulturen zu entwickeln, ist es wichtig zuallererst einen Blick auf die Entwicklung der Génération Beur[2] in Frankreich zu werfen.
Die Anfänge der dieser Sub-Kultur liegen in den 1970ern. Dabei handelt es sich um eine neue Generation von, in Frankreich geborener Jugendlicher nordafrikanischer Eltern, die sich sowohl mit der französischen als auch mit der maghrebinischen Kultur zu gleichen Teilen identifizierten, also als zweiheimisch oder bi-kulturell bezeichnet werden könnten. Jedoch könnte auch das genaue Gegenteil behauptet werden, das heißt dass diese Jugendlichen der neuen Generation weder zu der einen, noch zu der anderen Kultur gehören. Dies wird auch in Mehdi Charefs Roman Le thé au harem d’Archi Ahmed deutlich, wenn die Identität des Protagonist, Madjid, Sohn algerischer Immigranten, erläutert wird:
„Madjid se rallonge sur son lit, convaincu qu'il n'est ni arabe ni francais depuis bien longtemps. Il est fils d'immigres, paume entre deux cultures, deux histoires, deux langues, deux couleurs de peau, ni blanc ni noir, a s'inventer ses propres racines, ses attaches, se les fabriquer “[3]
Da die Jugendlichen mit beiden Kulturen konfrontiert werden, können sie dieser Zerrissenheit nicht entkommen. So kommen sie in der Schule mit der französischen Kultur in Kontakt und zuhause mit der Maghrebinischen.
Diese Abgrenzung von beiden Kulturen wird auch durch die Erfindung des Wortes Beur verdeutlicht, welches von den Jugendlichen benutzt wurde um ihre eigene Identität darzustellen; eine andere Identität als die ihrer Eltern oder jene ihrer französischen Mitschüler. Das Wort Beur ist ein Verlan-Ausdruck des Wortes Arabe („rabeu“ - „beur“). Verlan bezeichnet eine Art Slang, bei welchem die erste und die letzte Silbe vertauscht werden. Die Anfänge des Verlan sind in der französischen Unterwelt zu finden, hier wurde es benutzt um kriminelle Aktivitäten verschleiern zu können.[4] In den 70er Jahren gewann dieser Slang allerdings bei den Jugendlichen nordafrikanischer Eltern in den Pariser Banlieues immer mehr an Beliebtheit. So vereint dieser Begriff wiederum beide Kulturen, einerseits wird ein französischstämmiger Slang zur Bildung des Wortes benutzt, andererseits beschreibt das Wort den ethnischen Hintergrund der Jugendlichen. Allerdings wurde das Wort nicht lediglich zur Abgrenzung und Erfindung einer neuen Identität verwendet, sondern ebenso um dem Begriff Arabe, der unter Francofranzosen eine eher negative Konnotation mit sich trug, zu entkommen.
Allerdings erhielt der Begriff Beur in den 80er Jahren schnell dieselben negativen Konnotationen, indem er immer häufiger in den Medien auftauchte und somit auch Einzug in die französische Gesellschaft erhielt. So ersetzte der Begriff schnell die Benutzung des Wortes Arabe, und wurde mit Worten, wie Armut oder Ghettoisierung gleichgesetzt. Diese negativen Konnotationen, welche die Francofranzosen den maghrebinischen Immigranten und ihren Kindern gegenüber entgegenbrachten, entstanden allerdings erst im Zuge der Massenarbeitslosigkeit der 70er Jahre, welche, die bis zu diesem Zeitpunkt erfolgende ökonomische und politische Integration der Migranten schlagartig beendete.[5] Die Migranten und ihre Kinder waren durch die Arbeitslosigkeit, die offene Diskriminierung und den Rassismus, der ihnen durch diese Situation gegenüber gebracht wurde, gezwungen in immer ärmlicheren Verhältnissen zu leben, welche somit auch immer mehr zu sozialen Problemen führte. So hatten die Migranten, die zuallererst in den 60er Jahren ohne ihre Familien als Arbeiter nach Frankreich gekommen waren und bereits in ärmlichsten Verhältnissen in Vororten, den Banlieues oder Bidonvilles lebten, keine Chance in den 70er Jahren als ihre Familien nachkamen, aus diesem Milieu aufzusteigen. Im Gegenteil, sie wurden sogar, trotz der Wohnungspolitik, welche die Lebensqualität der Familien in den Banlieues und den neuerbauten HLMs verbessern sollte, noch weiter in die Armut gezwungen, da durch die Massenarbeitslosigkeit von den Francofranzosen ein Klassenkampf betrieben wurde und bei Wohnungsvergaben europäische Mieter bevorzugt und Migranten „herausgefiltert“ wurden.[6]
So stieg durch diese Ablehnung und Zurückweisung der Jugendlichen maghrebinischer Herkunft auch die Jugendarbeitslosigkeit und der daraus resultierende Unmut, welcher sich in Gewalt und Kriminalität in den Banlieues und Bidonvilles, in denen die Migranten gezwungen waren zu leben, verwandelte.[7] Die Banlieues, am Stadtrand, außerhalb des Stadtinneren, symbolisieren deutlich diese Ablehnung oder Marginalisierung der Francofranzosen gegenüber der Migranten, die dort leben müssen und dies macht zweifelsohne die Identitätsbildung und Selbstwahrnehmung der Franco-maghrebinischen Jungendlichen nicht einfacher.
Durch diese schlechten Verhältnisse, den Klassenkampf und den immer stärker werdenden Rassismus der Francofranzosen gegen die Maghrebiner, entwickelte sich immer mehr Unmut unter den maghrebinischen Jugendlichen, so dass es bereits 1981 zu Krawallen in den Banlieues und Streiks der Immigranten kam. 1983 erreichte dieser Unmut den Höhepunkt mit dem „Marche pour l’égalité et contre le racisme“[8], bei welchem die Jugendlichen mit dem Slogan „Vivre ensemble avec nos différences“ die gleichen Rechte forderten, welche auch ihre Francofranzösischen Altergenossen hatten.[9] Dieser Marche pour l’égalité war für die Franco-maghrebinischen Jugendlichen daher wichtig, weil sie so öffentlich und sichtbar in Erscheinung traten und sich so auch politisch äußerten um ihre Identität zu formen.
Bestärkt durch diesen ersten öffentlichen Auftritt der Jugendlichen, entstand in den nachfolgenden Jahren geradezu eine Beur Kultur, die einen wichtigen Teil zur Identitätsbildung der Jugendlichen beitrug. Ebenso war sie allerdings auch für die Francofranzosen bestimmt, um einen Einblick in das Leben der Einwandererkinder und deren Situation, sowie ein Verständnis für deren Zerrissenheit zu entwickeln.
1.2. Beur Kultur: Entstehung einer Littérature Beur
Nach dem Marche pour l’égalité wurden schnell auch andere Möglichkeiten benutzt um die Situation der Beurs öffentlich zu machen und der Gesellschaft vor Augen zu halten. So wurde beispielweise die Musik, sowie Hip Hop und Rap benutzt um Antirassismus und Zusammenhalt zu verbreiten.[10] Diese Form der Musik, welche zu dieser Zeit aus Amerika nach Europa herüberschwappte, wurde erst nach einiger Zeit von den Jugendlichen in den Vororten angenommen, hauptsächlich um auf ihren Alltag in den Banlieues, welcher von Rassismus, Kriminalität und Ungleichberechtigungen geprägt war, aufmerksam zu machen.
Eine der wichtigsten Formen dieser Verbreitung stellt allerdings die Littérature Beur da, welche in den 1980er Jahren ihre Blütezeit, mit fünf bis sechs Werken dieser Art pro Jahr, erlebte.[11] Die Autoren der Littérature Beur schilderten oft Erlebnisse in Anlehnung an ihre eigenen Erfahrungen und die Probleme sich in der französischen Gesellschaft zu integrieren.
Neben zahlreichen anderen wie Mehdi Charef oder Akli Tadjer wurde Azouz Begag zu einem der erfolgreichsten Schriftstellern dieser Bewegung und veröffentlichte mehr als 20 Werke. Begag selbst wurde im Jahr 1957 in Frankreich geboren, nachdem seine Eltern acht Jahre zuvor nach Frankreich emigriert waren. Seine Kindheit verbrachte er in den heruntergekommenen Bidonvilles von Lyon bis er 1966 mit seinen Eltern in eine Sozialwohnung in Croix-Rousse und 1969 in eine Hochhaussiedlung in den Banlieue von Lyon zog. Trotz seiner sozialschwachen Situation gelang ihm der Aufstieg, so dass er nach seiner erfolgreichen schulischen Laufbahn an die Universität in Lyon wechselte und dort 1984 in Wirtschaftswissenschaften und Soziologie promovierte. So wurden auch vor seinen zahlreichen Romanen etliche soziologische Studien veröffentlicht, die sich vor allem mit den Migranten, mit Rassismus und der Frage nach der sozialen Mobilität der Migranten beschäftigt.[12] Von 2005-2007 ist Begag sogar Ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances unter Premierminister de Villepin. In dieser Zeit ist Begag genau für diese Angelegenheiten zuständig, welche in seinen Romanen thematisiert werden, die Gleichberechtigung, die Sensibilisierung der französischen Gesellschaft, sowie die Schaffung eines Bewusstseinsprozess um Vorurteile und Diskriminierung zu bekämpfen. Da sich Begag allerdings immer mehr vom damaligen Innenminister, Sarkozy, wegen dessen repressiver Politik nach den Unruhen im Jahre 2005, distanziert, tritt er 2007 aus der Politik zurück.
Zu dieser politischen Mitwirkung, kam es sicherlich nicht zuletzt nur durch seine soziologischen Beiträge, sondern ebenso durch seine Romane, beispielsweise Le Gone du Chaâba, welches in den nächsten Kapiteln näher beleuchtet werden soll.
2. Begags Le Gone du Chaâba
Seinen ersten Roman veröffentlicht Begag 1986, Le Gone du Chaâba, für welchen er 1987 den Prix de Sorcières erhält. Le Gone du Chaâba soll ebenso, wie seine soziologischen Studien, auf die Missstände Franco-maghrebinischer Kinder und Jugendliche aufmerksam machen, indem er die alltäglichen Probleme schildert, welche sie täglich ausgesetzt sind. Diese beinhalten nicht lediglich Probleme der Ungleichberechtigung sondern, wie bereits erwähnt, die Probleme der Identitätsfindung und der Identifizierung mit den beiden Kulturen. Dies wird besonders deutlich, da der Roman in der Ich-Perspektive geschrieben ist, und so die Innensicht des Kindes verdeutlicht.
Le Gone du Chaâba gilt als autobiographisches Werk, und dies wird auch deutlich, indem es ebenso in den Bidonvilles von Lyon beginnt und der Protagonist, ebenso wie der Schriftsteller, Azouz heißt.[13] Der kleine Azouz wächst in den 60er Jahren als Sohn algerischer Immigranten in seinem Bidonville auf. Durch seine harte Arbeit in der Schule, zu welcher ihn sein Vater immer wieder anhält, wird er immer erfolgreicher und genauso gut, wie seine französischen Mitschüler. Trotzdem bekommt er von seinen französischen Mitschülern immer wieder zu spüren, dass er nicht zu ihnen gehört. Aber gleichzeitig entfremdet er sich durch sein schulisches Engagement auch immer weiter von seinen maghrebinischen Schulkameraden, so dass er immer zwischen zwei Kulturen steckt, und je nach Situation entscheiden muss, zu welcher er gehört und mit, welcher er sich identifiziert. So muss er immer wieder neu um seinen Platz in der französischen Gesellschaft kämpfen.
Wie genau diese Zerrissenheit Azouz’ zwischen den beiden Kulturen, der französischen und der algerischen, in Le Gone du chaâba dargestellt wird, soll in dem nächsten Abschnitt thematisiert werden.
2.1. Identitätsproblematik in Le Gone du Chaâba
Bereits der Titel Begags Werkes Le Gone du Chaâba[14] verdeutlicht die Transkulturalität zwischen der französischen und der maghrebinischen Kultur, wie es von Azouz, dem Protagonisten, bzw. Begag, dem Schriftsteller, wahrgenommen wird. So stellt der Titel eine gewisse Mischform, eine Hybride Konstruktion, beider Kulturen dar. Dadurch das Begag das Wort Le Gone (Kind/Junge) wählte, verdeutlicht er eindeutig eine Zugehörigkeit zur französischen Kultur, da dieses ein spezifisches Wort aus der Region in und um Lyon ist. Das Algerisch-Arabische Wort Chaâba repräsentiert die andere Seite Azouz’ und bedeutet im weitesten Sinne dasselbe, wie das französische Wort Bidonville.[15] Dadurch das die Bewohner des Chaâba diesem Bereich einen algerischen Namen geben, beweist dass sie ihn als den ihren ansehen, ein Gebiet das algerisch und nicht französisch ist. So zeigt bereits der Titel Azouz Selbstidentifizierung mit einer gewissen Region Frankreichs, da das Wort außerhalb Lyons nicht existiert, gleichzeitig aber findet keine komplette Ablösung von der elterlichen Kultur, jener die ihm zuhause in der Familie vorgelebt wird, statt d.h. in der Schule erlebt Azouz die französische Kultur im Chaâba die Algerische und muss somit seine Identität jeweils anpassen.
Auch während des Romans wird diese Repräsentation der doppelten Identität durch Sprachverwendungen immer wieder aufgegriffen. So benutzt Azouz von Zeit zu Zeit algerische Wörter, sowie auch Wörter des Lyoneser Sprachgebrauchs, und mischt sie wie selbstverständlich mit seiner französischen Sprache. So benutzt er beispielsweise Wörter wie Chemma, anstatt tabac à priser (S. 18) oder Abboué und Emma, anstelle von Papa und Maman (S.149), diese stehen für seinen maghrebinischen Hintergrund. Andererseits integriert er auch immer wieder Lyoneser Wörter wie beispielsweise la boche, anstatt la pierre oder le braque anstelle von le vélo.
Es scheint als wäre Azouz sowohl dem Arabischen als auch dem Französisch und sogar dem regionalen Dialekt mächtig. Allerdings ist dies ein Fehlgedanke. So macht er selbst auch, wie seine Eltern, als Kind mit Migrationshintergrund Fehler bei der Benutzung der französischen Sprache, oder aber ist nicht immer in der Lage, die Benutzung des Arabischen und des Französischen der Situation anzupassen und zu differenzieren.. Dies wird besonders deutlich, wenn der Lehrer M. Grand die Schüler nach ihrer morgendlichen Hygiene fragt. So antwortet Azouz: „M’sieur, on a aussi besoin d’un chritte et d’une kaissa! […] c’est quelque chose qu’on se met sur la main pour se laver…“[16] M. Grand schlägt ihm daraufhin die französischen Wörter vor, doch Azouz kann damit nichts anfangen und muss die Bedeutung der arabischen Wörter erklären. Hier wird deutlich, dass Azouz sich nicht komplett der französischen Kultur anpassen kann, auch wenn er es versucht, trotzdem besteht eine Lücke zwischen ihm und dem Französischsein, welche für ihn erst mal durch sprachliche Probleme unüberwindbar ist.
Diese Überforderung mit der französischen Sprache wird auch noch mal an einer anderen Stelle verdeutlicht, hier berichtet Azouz von dem Beruf seines Vaters in Algerien und sagt dieser wäre ein „Journaliste dans la ferme de Barral“[17] gewesen, meint allerdings das Wort Journalier, wie ihm sein Lehrer M. Loubon erklärt. Eine weitere sprachliche Form, welche aufzeigt, dass Azouz zwischen den beiden Kulturen steht, ist die Verwendung der „phraséologie Bouzidien“, wie es Begag bezeichnet, auf welches Azouz zuhause trifft. Da die Konsonanten und Vokale im Algerischen unterschiedlich verwendet werden als im Französischen oder gar nicht existent sind, werden diese einfach an das französische angeglichen, so entsteht sozusagen eine eigene Sprache, welche Azouz wie folgt erklärt:
À la maison, l’arabe que nous parlons ferait certainement rougir de colère un habitant de La Mecque. Savez-vous comment on dit les allumettes chez nous, par exemple ? Li zalimite. […] et une automobile= La taumobile. Vous voyez, c’est un dialecte particulier qu’on peut assimiler aisément lorsque l’oreille est suffisamment entraînée[18]
Dies zeigt, wie Azouz die beiden Kulturen bzw. Sprachen vereinen möchte, um eine Identität annehmen zu können.
Neben der Mehrsprachigkeit die Begag verwendet um diese doppelte Identität bzw. eine Identitätslosigkeit Azouz’ deutlich zu machen, existieren auch viele andere Situationen, in denen dies offensichtlich wird. So lehnt Azouz beispielweise zu einem Zeitpunkt seine maghrebinische Identität komplett ab und möchte die französische annehmen um so zu sein, wie seine Klassenkameraden. Es scheint er habe erkannt, dass er nur als „echter Franzose“, wie seine Klassenkameraden komplette Akzeptanz und Annerkennung finden, und dieses will er durch gute Schulleistung erreichen:
Depuis quelques mois, j’ai décidé de changer de peau. Je n’aime pas être avec les pauvres, les faibles de la classe. Je veux être dans les premières places du classement, comme les Français [19]
Er scheint sich seiner Herkunft zu schämen, sowohl der maghrebinischen als auch der des Chaâbas, da er die Herkunft mit dem schulischen Erfolg gleichzusetzen scheint, welches die anderen maghrebinischen Schüler der Klasse allerdings auch bestätigen, da sie selbst schlechte schulische Leistungen erbringen. So setzt sich Azouz in der darauffolgenden Stunde in die erste Reihe um endlich genauso zu sein wie die Franzosen ( „Il faut que je traite d’égal à égal avec le Francais“[20]) und als der Azouz dem Lehrer zustimmt, dass sie alle Nachfahren der Gallier sind[21], macht er dies noch deutlicher, und beweist eine eindeutige Verleumdung eines Teils seiner eigenen Identität, infolge einer Assimilation an die französische Gesellschaft und Kultur.
Daraufhin machen Azouz’ Freunde Hacène, Moussaoui und Nasser ihm klar das, was es heißt ein echter Araber zu sein und zwar sich von den Franzosen abzugrenzen. Auch wenn dies für sie bedeutet schlechte schulische Leistungen zu erbringen, das diese, laut ihnen als Ablehnung des französischen Schulsystems dienen: „Si t’en était un [Arabe], tu serais dernier de la classe comme nous“[22] Azouz will ihnen verdeutlichen, dass er sehr wohl ein Araber ist, und das jeder gute schulische Leistungen, wie er selbst, erbringen könnte. Aber dies wollen seine Freunde nicht hören, und verlassen ihn mit den Worten: „Bon, allez, laisser-le tomber.On parle pas aux Gaouris, nous.“[23] Daraufhin macht sich Azouz das erste mal ernsthafte Gedanken über seine Identität, und bemerkt, dass seine Freunde zum Teil die Wahrheit sagen, da er tatsächlich nur mit Franzosen in der Schule spielt, sich aber gleichzeitig auch arabisch fühlt, da es für ihn keinen Widerspruch darstellt, sich beiden Kulturen angehörig zu fühlen. Er, im Gegensatz zu seinen Freunden, beweist eine Bi-Kulturalität, durch seine Assimilation an die französische Gesellschaft und gleichzeitige Beibehaltung der Kultur seiner Eltern. Trotzdem scheint dies ihm zu diesem Zeitpunkt noch Angst zu machen. Seine Freunde entgehen diesem Identitätskonflikt, indem sie nur an der arabischen Kultur festhalten und diese mit allem gleichsetzen, was anders ist als das französische, egal ob dies tatsächlich der arabischen Kultur entspricht oder nicht. Sie sehen alles Französische, im Gegensatz zu Azouz als feindlich und beschimpfen den Lehrer, M. Grand sogar als Rassist[24], obwohl ihre Art der französischen Gesellschaft gegenüber zu treten nichts anderes ist als eine Form der Diskriminierung.
Obwohl Azouz hier zeigt das er bi-kulturell ist, lehnt er zu einem späteren Zeitpunkt seine Identität erneut ab, indem er seinen jüdischen Mitschülern Taboul sagt, dass auch er Jude sei und dies wie folgt begründet: „Je suis juif, j’ai dit […]Si j’avais avoué que j’étais arabe, tout le monde m’aurait mis en quarantaine“[25]. Hier zeigt er, dass er erkannt hat das dem Arabisch-sein eine negative Konnotation anhaftet, welcher er um alles in der Welt entkommen will und sagt daher, als er auf seinen arabischen Namen angesprochen wird: „C’est parce que mes parents sont nés en Algérie, c’est tout.[…] Mais je suis né à Lyon de toute façon, je suis Français.“[26] Später geht Azouz sogar so weit, dass er seine Mutter verleugnet, die ihn von der Schule abholen will, und zweifelsohne arabisch und nicht jüdisch aussieht.[27] Azouz scheint es zu diesem Zeitpunkt wichtiger zu sein, in der Schule anerkannt zu werden, als seine algerische Identität zu akzeptieren und da dies seiner Meinung nach nur als Franzose funktioniert, nimmt er in der Schule diese Identität an, um nicht die negativen Eigenschaften zugeschrieben zu bekommen, welche die französische Gesellschaft, den Maghrebinern gegenüber, zweifelsohne noch heute haben.
Bis auf seinen Kontakt mit der algerischen Kultur im Chaâba, scheint es für Azouz auch schwer zu sein, zu dieser einen Zugang zu finden, wie die oben beschriebenen Situationen beweisen. So erlebt er diese Seite seiner Identität zu Beginn nur durch seine Eltern und die Bewohner des Chaâbas, die ihm die algerischen Sitten und Lebensweisen lediglich vorleben, welche für ihm aber ein Land darstellen, das er selbst nie gesehen und in welchem er nie gelebt hat. So ist ein Selbsterleben der algerischen Kultur für ihn unmöglich. Erst zu Ende des Romans lernt er auch eine andere Seite Algeriens kennen, welche er durch seine Eltern noch nicht entdecken konnte, und zwar durch seinen Lehrer M. Loubon, der die umgekehrte Situation erlebt hat, und als Franco-Franzose in Algerien war. Er befragt Azouz in der Klasse immer wieder nach arabischen Begriffen, seinem Leben etc. Durch diese Ermunterung über seine „andere Seite“ (der anderen Seite seiner Identität) zu sprechen, zeigt er, dass diese genauso viel Wert ist, wie die Französische, und somit auch von Azouz entdeckt und erforscht werden sollte. So sagt Azouz auch:
Depuis maintenant de longs mois, le prof a pris l’habitude de me faire parler en classe, de moi, de ma famille, de cette Algérie que je ne connais pas, mais que je découvre de jour en jour avec lui. [28]
Hier zeigt Azouz das er jetzt bereit ist, diese andere Seite zu entdecken und einer Bi-Kulturalität eventuell ins Auge blicken kann um mit beiden Seiten von sich zu Leben und seine Identität nicht mehr situationsbedingt anpassen zu müssen, um jeweils das zu sein, was andere von ihm verlangen.
3. Zusammenfassung
Begags Le Gone du Chaâba beweist deutlich, dass es für Jugendliche, die Kinder algerischer Eltern sind, zweifelsohne nicht einfach ist, sich in Frankreich zurecht zu finden und zum gleichen Maße wie ihre Franco-Französischen Altergenossen anerkannt und akzeptiert zu werden. Auch zeigt sein Werk, dass der Selbstfindungsprozess dieser Jugendlichen lang und verwirrend für diese ist, da sie sich erst selbst bewusst werden müssen, wie sie mit ihrer Bi-Kulturalität zurecht kommen und zu welchen Teilen sie welcher Kultur angehören wollen, bzw. können.
Betrachtet man die Hintergründe der Beur Génération
4. Bibliographie
Begag, Azouz (1986): Le gone du Chaâba. Éditions du Seuil, Collection Points, Paris
Charef, Mehdi (1983) : Le thé au harem d’Archi Ahmed. Mercure de France, Paris
Hargreaves Alec G. (1997): Immigration and Identity in Beur Fiction: Voices from the North African, Oxford
Heiler, Susanne (2005):Der maghrebinische Roman: Eine Einführung. Gunter Narr Verlag, Tübingen
Kretzschmar, Sonja (2002): Fremde Kulturen im europäischen Fernsehen, Westdeutscher Verlag. Wiesbaden
Lorcerie, Françoise (2001) : Comment vivre ensemble ? Perspectives françaises. In : Resch, Yannick : Définir l'intégration?: perspectives nationales et représentations symboliques Montréal, XVZ Editeur, p. 33-60
Offord, Malcolm/ Ibnlfassi, Laila et al. (2001) : Francophone Literatures: A Literary and Linguistic Companion.Routledge, London