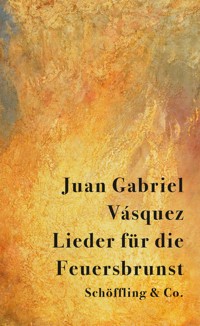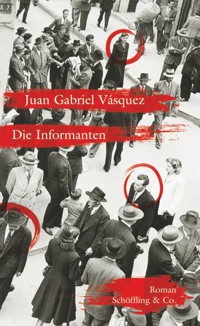
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Voller Stolz schenkt der junge kolumbianische Journalist Gabriel Santoro seinem Vater, einem bekannten Rhetorikprofessor, sein erstes Buch. Er kann nicht ahnen, dass sein Vater diese Chronik einer befreundeten deutsch-jüdischen Familie mit einem Verriss in der größten Zeitung des Landes zunichtemachen wird. Mehr noch, dass er mit der Veröffentlichung seines Buches auf ein dunkles Geheimnis gestoßen ist. Gabriel begibt sich auf Spurensuche, die ihn vom Kolumbien der dreißiger Jahre in die Gegenwart führt, und entreißt ein bis heute vertuschtes, unrühmliches Kapitel der Geschichte seines Landes der Vergessenheit. Vásquez´ großes Thema ist die Erinnerung, die Rückkehr unserer persönlichen und politischen Albträume. In einer melodischen, bildreichen Prosa deckt er immer neue Schichten der historischen Wahrheit auf und dringt in seelische Abgründe vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Zitat
Das unvollendete Leben
Das zweite Leben
Das Leben gemäß Sara Guterman
Das geerbte Leben
Nachschrift von 1995
Nachwort des Autors
Dank
Autorenporträt
Übersetzerporträt
Über das Buch
Impressum
[Leseprobe – Willkommen in Amerika]
Für Francis Laurenty(1924–2003)
Nie, nie wirst du das, was du dort getan hast, auslöschen, wie viele Worte du auch immer darüber machen wirst.Demosthenes, Rede für die Krone
Wer will sprechen?Wer will Vergangenes anklagen?Wer will für die künftigen Ereignisse Bürgschaft leisten?Demosthenes, Rede für die Krone
Das unvollendete Leben
Am Morgen des siebten April 1991, als mein Vater anrief, um mich zum ersten Mal in seine Wohnung in Chapinero einzuladen, ging ein solcher Regenguss auf Bogotá nieder, dass die Bäche an den Hängen der Cerros Orientales überliefen und das Wasser talwärts stürzte, Äste und Erdreich mit sich riss, die Rinnsteine verstopfte, schmalere Straßen überflutete, kleinere Autos fortschwemmte und sogar eine unvorsichtige Taxifahrerin ertränkte, die aus ungeklärtem Grund unter die Karosserie ihres Wagens geraten war. Der Anruf war an sich schon überraschend, an einem solchen Tag jedoch geradezu unheilverkündend, nicht nur, weil mein Vater seit langem keinen Besuch mehr empfing, sondern weil ihn der Anblick der vom Wasser bestürmten Stadt mit ihren reglosen Autokolonnen, den ausgefallenen Ampeln, den eingekeilten Rettungswagen und wartenden Notfällen unter normalen Umständen zu der Einsicht hätte bringen müssen, dass es töricht war, sich für einen Besuch hinauszuwagen, und einen Besuch zu sich zu bestellen, nahezu tollkühn. Das Bild des im Chaos versunkenen Bogotá gab mir einen Begriff von der Dringlichkeit und ließ mich vermuten, dass es kein Höflichkeitsbesuch sein sollte, und so kam ich zu dem vorläufigen Schluss: es würde um ein Buch gehen. Nicht um irgendeines, versteht sich, sondern um das einzige, das ich bisher veröffentlicht hatte, eine Chronik mit einem Titel wie für einen Dokumentarfilm – Ein Leben im Exil –, die von Sara Guterman erzählte oder erzählen wollte, Tochter einer jüdischen Familie, die seit ihrer Ankunft in Kolumbien in den dreißiger Jahren mit der unseren befreundet war. Nach der Veröffentlichung 1988 hatte das Buch eine gewisse Bekanntheit erlangt, allerdings nicht wegen des Themas oder der fraglichen Qualität, sondern weil mein Vater, ein Rhetorikprofessor, der von jeher um jegliche Form von Journalismus einen großen Bogen gemacht hatte, ein Leser von Klassikern, der Ausführungen zur Literatur in der Presse verachtenswert fand, in der Sonntagsbeilage von El Espectador eine Kritik veröffentlicht hatte, einen Verriss, den wütende Erbitterung diktiert zu haben schien. So war es nicht verwunderlich, dass ich später, als mein Vater das Haus der Familie verscherbelt und sich sein Refugium eines eingefleischten Pseudojunggesellen gemietet hatte, aus fremdem Mund von seinem Umzug erfuhr, auch wenn es sich um Sara Gutermans Mund handelte, der mir unter den fremden am wenigsten fremd war.
Für mich lag es auf der Hand, dass er an dem Nachmittag genau darüber sprechen und mit drei Jahren Verspätung diesen Verrat wiedergutmachen wollte, einen winzigen, familiären Verrat, aber darum nicht weniger schmerzlich. Doch etwas ganz anderes geschah. Von der autoritären Höhe eines gelben Lehnstuhls aus, wo er mit dem einsamen Daumen seiner verstümmelten Hand durch die Kanäle zappte, erzählte mir dieser gealterte, verängstigte Mann, der nach schmutziger Bettwäsche roch und dessen Atem wie ein Papierdrache surrte, im gleichen Tonfall, in dem er sonst Anekdoten von Demosthenes oder Gaitán zum Besten gab, dass er seit drei Wochen regelmäßig einen Arzt in der San Pedro Claver-Klinik sehe und eine Untersuchung seines siebenundsechzig Jahre alten Körpers in chronologischer Reihenfolge dies ergeben habe: eine harmlose Diabetes, eine verstopfte Arterie – die vordere absteigende – und die sofortige Notwendigkeit einer Operation. Er wisse jetzt, wie nah er daran gewesen sei, die Welt zu verlassen, und ich solle es ebenfalls wissen. »Ich bin alles, was du hast«, sagte er. »Alles, was dir geblieben ist. Deine Mutter ist seit fünfzehn Jahren unter der Erde. Ich hätte dich nicht anrufen müssen, habe es aber getan. Weißt du, warum? Weil du ohne mich ganz allein sein wirst. Wärst du ein Trapezkünstler, wäre ich dein einziges Netz.« Jetzt, da ausreichend Zeit seit dem Tod meines Vater verstrichen ist und ich mich endlich entschlossen habe, Kopf und Schreibtisch zu ordnen, die Unterlagen und Aufzeichnungen, die Informationen für meine Chronik, hat sich mir dieser Beginn aufgedrängt: die Erinnerung an den Tag, an dem er mich mitten im anstrengendsten Winter meines Erwachsenenlebens anrief, und nicht etwa, um den Graben zwischen uns zu überbrücken, sondern um weniger einsam zu sein, wenn man ihm mit einer elektrischen Säge den Brustkorb öffnete und an sein krankes Herz eine Vene nähte, die seinem rechten Bein entnommen worden war.
Angefangen hatte alles mit einer Routineuntersuchung. Der Arzt, ein Mann mit Sopranstimme und Jockeyfigur, hatte ihm gesagt, eine leichte Diabetes sei für sein Alter weder ungewöhnlich noch bedenklich, nur eine kleine, vorhersehbare Störung, Insulinspritzen oder Medikamente seien nicht notwendig, dafür jedoch regelmäßige körperliche Ertüchtigung und eine strenge Diät. Nachdem er sich ein paar Tage lang folgsam zum Joggen aufgemacht hatte, begannen die Schmerzen, ein leichtes Unwohlsein im Magen, das eher auf Verdauungsprobleme hinzuweisen schien, als hätte mein Vater einen brummenden Teddy verschluckt. Der Arzt ordnete neue Untersuchungen an, die immer noch allgemeiner Natur, doch umfassender waren, darunter ein Belastungs-EKG. In seinen langen Unterhosen, die ihm wie die Chaps eines Cowboys um die Schenkel schlackerten, lief er zunächst gemächlich, dann schneller auf der synthetischen Matte, diesem kalten Teppich, der sich unter seinen Füßen ständig erneuerte, und ging dann in die winzige Umkleidekabine zurück (in der er, wie er mir erzählte, die Arme hatte ausbreiten wollen, aber feststellen musste, dass schon seine Ellbogen an die Wände stießen, worauf er einen kurzen Anfall von Klaustrophobie bekam), aber kaum hatte er sich die Anzughose angezogen und begonnen, die Hemdmanschetten zuzuknöpfen, in Gedanken bereits draußen, wo er auf den Aufruf der Arzthelferin warten und sich das Ergebnis des EKGs abholen würde, da klopfte der Arzt an die Kabinentür. Es tue ihm leid, sagte er, aber die ersten Ergebnisse gefielen ihm gar nicht, man müsse sofort eine Herzkatheteruntersuchung machen, um zu sehen, ob sich der Verdacht bestätige. Das tat man natürlich, und der Verdacht bestätigte sich (natürlich): Eine Arterie war verstopft.
»Zu neunundneunzig Prozent«, sagte mein Vater. »Der Infarkt war für übermorgen programmiert.«
»Warum hat man dich nicht gleich ins Krankenhaus eingeliefert?«
»Wahrscheinlich fand mich der Mann zu nervös und hat mich lieber nach Hause geschickt. Allerdings mit strengen Anweisungen. Ich darf mich das Wochenende über nicht bewegen. Muss Aufregungen jeder Art vermeiden. Und vor allem kein Sex. Das hat er gesagt, stell dir vor.«
»Und du, was hast du gesagt?«
»Dass er sich da keine Sorgen machen muss, nichts weiter. Weshalb sollte ich ihm mein Leben erzählen?«
Als er die Praxis verließ und inmitten des Trubels auf der Sechsundzwanzigsten ein Taxi nahm, wurde meinem Vater erst langsam bewusst, dass er krank war. Er musste ins Krankenhaus, ohne ein einziges Symptom, das seinen kritischen Zustand verraten hätte, ohne andere Beschwerden als den läppischen Schmerz am Magenmund, und all dies auf die Anklage eines Herzkatheters hin. Das arrogante Gefasel des Arztes klang ihm noch im Ohr: »Wenn Sie drei Tage später zu mir gekommen wären, hätten wir Sie vermutlich in einer Woche beerdigt.« Es war ein Freitag, die Operation war für den folgenden Donnerstag um sechs Uhr früh angesetzt. »Die ganze Nacht über musste ich daran denken, dass ich sterben würde«, sagte er, »und da habe ich dich angerufen. Ich war selbst überrascht, aber noch mehr überrascht mich, dass du gekommen bist.« Womöglich eine Übertreibung: Mein Vater wusste genau, dass niemand seinen Tod ernster nehmen würde als sein Sohn, und so verbrachten wir den Sonntagnachmittag damit, uns mit seinem Tod zu beschäftigen. Ich machte uns beiden einen Salat, vergewisserte mich, dass Saft und Wasser im Kühlschrank waren, und ging dann mit ihm die letzte Steuererklärung durch. Er besaß mehr Geld, als er benötigte, was nicht auf Reichtum, sondern auf Genügsamkeit hindeutete. Seine einzigen Einkünfte bezog er aus der Pension vom Obersten Gerichtshof und dem Verkauf des Hauses, in dem ich aufgewachsen und wo meine Mutter gestorben war und dessen spärlichen Erlös er in Einlagezertifikaten angelegt hatte, deren Zinsen ausreichten, um die Miete und das spartanischste Leben zu bezahlen, das mir je untergekommen war, ein Leben, in dem, soweit ich bezeugen kann, keinerlei Restaurants, Konzerte noch sonstige kostenpflichtige Formen des Vergnügens Platz hatten. Was nicht heißen will, dass ich es gemerkt hätte, falls mein Vater sich nachts gelegentlich eine Geliebte ins Haus bestellt hätte, aber immer, wenn ein früherer Kollege ihn einmal aus dem Haus hatte locken und mit einer Frau zum Essen ausführen wollen, sagte mein Vater ab und legte für den Rest des Abends den Hörer neben das Telefon. »Die Leute, die ich in diesem Leben kennen lernen sollte, kenne ich bereits«, sagte er mir. »Ich brauche niemand Neuen.« Einmal lud ihn eine Anwältin für Marken- und Patentrecht ein, die seine Tochter hätte sein können, eine dieser jungen Frauen, großbusig und wenig belesen, die neugierig auf Sex mit älteren Männern sind. »Und hast du abgelehnt?«, fragte ich. »Aber natürlich. Ich habe gesagt, ich müsse zu einer politischen Versammlung. ›Von welcher Partei?‹, fragte sie. ›Der Onanistenpartei‹, entgegnete ich. Und sie ging brav nach Hause und hat mich nicht mehr belästigt. Inzwischen hat sie wohl ein Wörterbuch zum Nachschlagen gefunden, jedenfalls scheint sie beschlossen zu haben, mich in Frieden zu lassen, denn sie hat mich nie mehr eingeladen. Oder vielleicht ist auch eine Klage gegen mich im Gang, was meinst du? Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir: Perverser Professor belästigt junge Frau mit biblischen Mehrsilbern.«
Bis sechs oder sieben leistete ich ihm Gesellschaft und ging dann nach Hause, musste jedoch den ganzen Weg über an dieses Erlebnis denken, die seltsame Art, wie ein Sohn die Wohnung seines Vaters kennen lernt. Waren es zwei Zimmer – Wohn- und Schlafzimmer –, oder gab es noch ein Arbeitszimmer? Ich hatte nichts weiter als ein weißes Sperrholzregal gesehen, das verloren an der Wand zur Neunundvierzigsten hin stand, daneben ein Fenster, durch dessen Gitter kaum Licht hereindrang. Wo waren seine Bücher? All die Silberplaketten und -schalen, mit denen man ihn während seiner langjährigen Laufbahn so hartnäckig ausgezeichnet hatte? Wo arbeitete er, wo las er, wo hörte er diese Platte – Die Meistersinger von Nürnberg, ein mir unbekannter Titel –, deren Hülle sich auf den Küchentisch verirrt hatte? Die Wohnung schien fest im Griff der siebziger Jahre zu sein: der orangebraune Teppich, der weiße Glasfaserstuhl, in dem ich in mich zusammensank, während mein Vater mir aus dem Gedächtnis die Route des Herzkatheters beschrieb (die schmalen Autobahnen, die Landstraßen, die er genommen hatte), das enge Bad ohne Fenster, nur von zwei transparenten Plastikrechtecken an der Decke beleuchtet (eines davon hatte ein Loch, durch das ich die flackernden Neonröhren sah, die bald ihren Geist aufgeben würden). Im grünen Waschbecken befanden sich Überreste von Seifenschaum, die Dusche war schmierig, roch schlecht, und über ihrem Aluminiumrahmen hingen zwei frisch gewaschene Unterhosen. Hatte er sie selbst gewaschen? Kam keine Haushaltshilfe? Ich öffnete Schubladen und Schranktüren mit Magnetverschluss, fand Aspirin, eine Schachtel Alka-Seltzer und einen schmierigen Rasierpinsel, der schon seit langem nicht mehr benutzt worden war. Auf Kloschüssel und Boden sah man Urintropfen: gelbe, riechende Flecken, die eine ramponierte Prostata verrieten. Und auf dem Spülkastendeckel, unter einer Kleenex-Schachtel, lag ein Exemplar meines Buchs. Ich fragte mich natürlich, ob er mir damit zu verstehen geben wollte, dass sich seine Meinung in den letzten Jahren nicht geändert hatte. »Der Journalismus regt die Verdauung an«, hörte ich ihn im Geist schon sagen. »Hast du das nicht an der Uni gelernt?«
Als ich zu Hause eintraf, machte ich einige Anrufe, auch wenn es zu spät war, um die Operation abzusagen oder eine zweite Meinung einzuholen, noch dazu übers Telefon und ohne Unterlagen, Ergebnisse, Röntgenaufnahmen. Doch das Gespräch mit Jorge Mor, einem Kardiologen von der Shaio-Klinik, mit dem ich seit der Schulzeit befreundet war, trug nicht gerade zu meiner Beruhigung bei. Als ich ihn anrief, bestätigte mir Jorge, was der Arzt von der San Pedro Claver gesagt hatte. Er bekräftigte die Diagnose und die dringende Notwendigkeit einer Operation, ebenso das Glück, dass die Angelegenheit durch Zufall entdeckt worden war, bevor das erstickende Herz meines Vaters seine Absicht verwirklichen konnte und ohne Vorwarnung stehen blieb. »Mach dir keine schlaflosen Nächte«, sagte Jorge. »Es ist die simpelste Version einer schwierigen Operation. Sich bis Donnerstag Sorgen zu machen bringt nichts.« »Aber was kann schiefgehen?«, bohrte ich nach. »Schiefgehen kann alles, Gabriel, bei jeder Operation auf der Welt. Aber die hier ist notwendig und relativ einfach. Soll ich kommen und sie dir erklären?« »Unsinn«, sagte ich. »Was dir alles einfällt.« Hätte ich den Vorschlag angenommen, hätte ich mich allerdings bis zum Schlafengehen mit Jorge unterhalten können. Wir hätten von der Operation gesprochen, ich wäre zu einem Schlaftrunk gekommen und hätte mich spät hingelegt. Doch jetzt ging ich um zehn ins Bett und war kurz vor drei Uhr morgens immer noch wach und erschreckter, als ich gedacht hatte.
Ich stand auf, ging zu meiner Hose, zog die Brieftasche heraus und verstreute den Inhalt unter dem Lampenschirm. Zwei Monate vor meinem achtzehnten Geburtstag hatte mein Vater mir ein Kärtchen gegeben, auf der einen Seite dunkelblau, auf der anderen weiß, das ihn dazu berechtigte, neben meiner Mutter auf dem Friedhof Jardines de la Paz beerdigt zu werden – auf dem Kärtchen war das Logo des Friedhofs zu sehen, Buchstaben in Lilienform –, und er hatte mich gebeten, es an einem sicheren Ort aufzubewahren. Damals war mir, wie wohl jedem anderen Jugendlichen auch, kein besserer Platz eingefallen als meine Brieftasche, und dort hatte es die ganze Zeit über gesteckt, zwischen Ausweis und Wehrpass, mit diesem Anstrich einer Todesanzeige und dem maschinengeschriebenen Namen auf dem verblichenen Aufkleber. »Man weiß nie«, hatte mein Vater gesagt, als er es mir gab. »Mag sein, eine Bombe erwischt einen, und dann sollst du wissen, was anfangen mit mir.« Die Zeit der Bomben und Attentate, ein ganzes Jahrzehnt, das die abendliche Rückkehr nach Hause zu einem reinen Glücksspiel machte, lag noch in weiter Ferne. Hätte ihn diese Bombe erwischt, der Besitz des Kärtchens hätte mich nicht darüber aufgeklärt, was man mit den Toten anfängt. Nun wirkte die vergilbte, unansehnliche Karte auf mich wie ein bloßes Stück Karton, das in einer neuen Brieftasche steckt, ein Außenstehender hätte sie nie als das erkannt, was sie in Wirklichkeit war: ein laminiertes Grab. Als ich darüber nachdachte, dass womöglich der Moment gekommen war, Gebrauch von ihr zu machen, und nicht wegen Bomben oder Attentaten, sondern wegen der vorhersehbaren Machenschaften eines alten Herzens, schlief ich endlich ein.
Am nächsten Nachmittag um fünf wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Während der ersten Stunden, schon im grünen Krankenhaushemd, antwortete mein Vater auf die Fragen des Anästhesisten, unterschrieb die weißen Formulare der Sozialversicherung und die dreifarbigen der Lebensversicherung (in den verblichenen Landesfarben), und den ganzen Dienstag und Mittwoch über redete und redete er, verlangte Gewissheiten, Informationen und informierte selbst, wie er da auf der Matratze, auf dem hohen Thron seines Aluminiumbetts saß und doch zu der verletzlichen Rolle desjenigen verdammt war, der weniger weiß als sein Gegenüber. Die drei Nächte blieb ich bei ihm, versicherte ihm wieder und wieder, alles werde gutgehen. Und nachdem man ihm die Brust und beide Beine rasiert hatte, wurde er am Donnerstag in aller Frühe von drei Männern und einer Frau in den Operationssaal im zweiten Stock gebracht, liegend, zum ersten Mal schweigend und unter dem wegwerfbaren OP-Hemd eindeutig nackt. Ich begleitete ihn, bis mich eine Krankenschwester wegschickte, dieselbe, die mehrmals ungeniert das komatöse Geschlecht des Patienten gemustert hatte, und mich mit einem nach Ammoniak riechenden Tätscheln auf die Schulter mit den gleichen Worten beruhigen wollte wie ich ihn: »Keine Sorge. Alles wird gutgehen.« Aber sie fügte hinzu: »So Gott will.«
Den Namen meines Vaters kennt fast jeder und nicht nur, weil es derselbe ist, der auf diesem Buch steht (ja, mein Vater gehörte zu diesem berechenbaren Menschenschlag: zu denen, die so fest an ihr eigenes Verdienst glauben, dass sie nicht davor zurückschrecken, ihren Söhnen denselben Namen zu geben), sondern weil Gabriel Santoro über zwei Jahrzehnte lang das berühmte Rhetorikseminar am Obersten Gerichtshof geleitet und zudem 1988 die Gedenkrede zur 450-Jahrfeier Bogotás gehalten hatte, ein legendärer Text, der mit den Perlen kolumbianischer Redekunst von Bolívar bis Gaitán verglichen wurde. »Gabriel Santoro, rechtmäßiger Erbe Gaitáns, unseres liberalen Caudillos« lautete die Titelzeile einer offiziellen Publikation, die keiner liest oder kennt, die meinem Vater jedoch eine der größten Genugtuungen der letzten Jahre verschaffte. Nicht ohne Grund, denn von Gaitán hatte er alles gelernt, war bei all seinen Reden zugegen gewesen, hatte sich dessen Technik abgeschaut. Noch vor seinem zwanzigsten Lebensjahr hatte er sich das Korsett meiner Großmutter angezogen, um den Effekt der Leibbinde zu erzielen, die Gaitán trug, wenn er im Freien reden musste. »Die Binde übte Druck auf das Zwerchfell aus«, erklärte mein Vater in seinem Unterricht, »und die Stimme wurde tragender, tiefer, ausdauernder. Man konnte zweihundert Meter vom Rednerpult entfernt stehen, wo Gaitán ohne jedes Mikro sprach, mit reiner Lungenkraft, und man verstand ihn einwandfrei.« Die Erklärung wurde von einer Pantomime begleitet, denn mein Vater war ein begnadeter Imitator (nur, wenn Gaitán den rechten Zeigefinger hob und zum Himmel deutete, hob mein Vater seinen blanken Stummel). »Mitbürger: Für die moralische Wiedergeburt der Republik! Mitbürger: Für unseren Sieg! Mitbürger: Für die Niederlage der Oligarchie!« Pause, dann eine täuschend harmlose Frage meines Vaters: »Wer kann mir sagen, warum uns diese Reihe von Sätzen mitreißt, worin ihre Wirkung beruht?« Ein unvorsichtiger Student: »Wegen der Ideen, die…« Mein Vater: »Nichts von wegen Ideen. Ideen sind egal, Ideen hat jeder Esel, und gerade hier haben wir keine Ideen, sondern Slogans. Nein, diese Reihung bewegt und überzeugt uns, weil zu Beginn eines jeden Aufrufs dieselbe Wortfolge wiederholt wird, und das werden Sie von heute an Anapher nennen, wenn Sie so gut sein wollen. Und wer mir noch einmal mit Ideen kommt, wird standrechtlich erschossen.«
Ich besuchte diesen Unterricht aus dem reinen Vergnügen, ihn Gaitán oder sonst wen darstellen zu sehen (andere beliebte Rollen waren Rojas Pinilla und Lleras Restrepo), und prägte mir seinen Anblick dabei genau ein, die Statur eines ehemaligen Boxers, die breiten Knochen – der Kiefer, die Jochbeine, die imposante Geometrie des Rückens –, die seine Anzüge vollständig ausfüllten, die buschigen Brauen, die ihm bis in die Augen hingen und wie ausgefranste Soffitten über die Lider zu wischen schienen, und da waren die Hände, vor allem und immer wieder die Hände. Die Linke war so mächtig, die Finger so lang, dass er mit den bloßen Kuppen einen Fußball aufheben konnte, die Rechte war nichts als ein faltiger Stummel, aus dem einsam der Mast des Daumens ragte. Mein Vater war ungefähr zwölf gewesen und allein im Haus seiner Großeltern in Tunja, als durchs Küchenfenster drei Männer einstiegen, die Macheten und hochgekrempelte Hosen trugen, nach Fusel und nassem Poncho rochen und »Tod der liberalen Partei!« riefen, jedoch nicht meinen Großvater vorfanden, der für die Provinzregierung in Boyacá kandidierte und einige Monate später in Sogamoso in einen Hinterhalt geraten sollte, sondern seinen Sohn, einen Jungen, noch im Schlafanzug, obwohl es schon nach neun war. Einer von ihnen lief ihm hinterher, sah, wie er über einen Erdhügel stolperte und sich im hohen Gras der Nachbarweide verfing; nach einem Machetenhieb ließ er den Jungen als tot zurück. Mein Vater hatte zur Abwehr die Hand gehoben, und die rostige Klinge schnitt ihm vier Finger ab. María Rosa, die Köchin, machte sich Sorgen, als er nicht zum Mittagessen kam, und fand ihn zwei Stunden nach dem Machetenhieb gerade noch rechtzeitig, dass er nicht verblutete. Aber an Letzteres erinnerte sich mein Vater nicht, davon hatte man ihm später erzählt, ebenso von seinen Fieberphantasien, bei denen die Machetenschläger mit Salgaris Piraten verschwammen. Er musste von neuem schreiben lernen, nun mit der Linken, erreichte dabei aber nie mehr die alte Gewandtheit, und bisweilen hatte ich den Eindruck, ohne es ihm je zu sagen, dass seine ungestalten, abgehackten Schnörkel, diese Großbuchstaben wie von Kinderhand, denen winzige Schwadronen von Krakelfüßen hinterhertappten, der einzige Grund waren, weshalb ein Mann, der sein ganzes Leben lang in den Büchern anderer zu Hause gewesen war, kein eigenes geschrieben hatte. Sein Werkzeug waren das gesprochene und das gelesene Wort, jedoch nie das von eigener Hand geschriebene. Er fühlte sich plump, wenn er einen Stift führen musste, und war unfähig, eine Tastatur zu bedienen. Das Schreiben gemahnte ihn ständig an die Behinderung, den Makel, die Scham. Und wenn ich sah, wie er die weniger begabten Studenten erniedrigte, sie mit seinem brutalen Sarkasmus peitschte, dachte ich immer: Du rächst dich gerade. Das ist deine Rache.
Aber nichts davon schien irgendeine Konsequenz in der realen Welt zu haben, in der sich der Erfolg meines Vaters so wenig aufhalten ließ wie ein böses Gerücht. Immer mehr erfahrene Strafrechtler, Anwälte multinationaler Konzerne, Postdocs und Richter im Ruhestand bewarben sich bei seinem Seminar, bis dieser alte Professor mit dem unnützen Wissen und den überflüssigen Techniken ein kitschiges Wandbord im Kolonialstil zwischen Schreibtisch und Bücherregal zwängen musste, auf dem sich hinter dem kleinen Geländer mit dickbäuchigen Pfeilern die Silberschalen und all die Urkunden aus Karton, aus Papier mit Wasserzeichen oder aus Pergamentimitat häuften, ebenso Trophäen aus Spanplatten mit aufdringlichen Wappen aus buntem Aluminium. FÜR GABRIEL SANTORO, ALS ANERKENNUNG FÜR ZWANZIG JAHRE BILDUNGSARBEIT … HIERMIT WIRD BESCHEINIGT, DASS DOKTOR GABRIEL SANTORO AUF GRUND SEINER VERDIENSTE ALS BÜRGER … DER STADTRAT BOGATÁS HAT ZU EHREN VON DOKTOR GABRIEL SANTORO … In diesem Tempel der heiligen Kühe lebte die heilige Kuh, die mein Vater war. Ja, diesen Ruf hatte er. Das wurde ihm klar, als ihn das Bürgermeisteramt anrief und ihm anbot, die bewusste Rede zu halten, das heißt, vor gelangweilten Politikern Gemeinplätze abzuspulen. Dieser friedliche Professor – werden sie sich gedacht haben – würde die ungeschriebenen Gesetze der Veranstaltung einhalten. Mein Vater gab ihnen nichts von dem, was sie sich erwartet hatten.
Er sprach nicht von 1538. Sprach nicht von unserem illustren Stadtgründer Don Gonzalo Jiménez de Quesada, an dessen mit Taubendreck beschmierter Statue er jedes Mal vorbeikam, wenn er seinen Kaffee mit Schuss im Café Pasaje trinken ging. Er sprach weder von den ersten zwölf Hütten noch vom Wasserstrahl des Chorro de Quevedo, wo die Stadt gegründet worden war und bei dem mein Vater, wie er behauptete, immer an einen pinkelnden Dichter denken musste. Nein, mein Vater schwamm gegen den Strom der Gedenkrituale in Kolumbien (wo man so leidenschaftlich allem und jedem gedenkt) und machte aus seiner Rede keine politisch angehauchte Version der Grundschulbücher. Er hielt den Pakt nicht ein, enttäuschte die Erwartungen von rund zweihundert Politikern, friedfertigen Menschen, die sich nur ein Weilchen von der Trägheit des Optimismus tragen lassen und dann mit ihrer Familie ungestört den siebten August feiern wollten. Ich war natürlich anwesend, hörte die hervorgestoßenen Worte, übertragen von mittelmäßigen Mikros, sah die Gesichter der Zuhörer und bemerkte, an welchem Punkt einige nicht länger zum Rednerpult schauten, sondern Blicke tauschten: mit ungerührter Stirn und steifem Hals, während beringte Hände die Krawatten glatt strichen. Nachher würden alle den Mut erwähnen, der den Worten zugrunde lag, die tiefe Bußfertigkeit, die unerschrockene Aufrichtigkeit, die in jedem der Sätze mitschwangen – was alles, da bin ich mir sicher, für meinen Vater ohne Belang war, da er nur seine Gewehre hatte entstauben und einem auserlesenen Publikum seine besten Schüsse vorführen wollen –, doch keiner erkannte den eigentlichen Wert dieses seltenen Stücks Rhetorik: eine mutige Vorrede, die darauf verzichtete, ans Wohlwollen des Publikums zu appellieren (»Nichts preisen will ich hier«), ein Diskurs, der es auf Konfrontation anlegte (»Diese Stadt wurde verraten. Sie alle haben sie verraten, fast ein halbes Jahrtausend lang«), eine elegante Koda, die mit dem vornehmsten Topos der klassischen Rhetorik begann (»Es gab eine Zeit, da es noch möglich war, von dieser Stadt zu sprechen«). Und dann der letzte Abschnitt, der später eine Goldgrube für Mottos offizieller Publikationen war und immer wieder in den Zeitungen zitiert wurde, wie man auch ständig Bolívars In Frieden werde ich hinab ins Grab steigen oder Oberst, retten Sie das Vaterland wiederholte.
Bei Platon lesen wir: »Felder und Bäume wollen mich nichts lehren, wohl aber die Menschen in der Stadt.« Mitbürger, lernen wir von der unseren. Mitbürger, packen wir den politischen und moralischen Neuaufbau Bogotás an. Wir werden mit unserem Fleiß, unserer Beharrlichkeit und unserer Willenskraft die Wiedergeburt erreichen. Mit vierhundertfünfzig Jahren ist Bogotá eine junge Stadt, noch im Entstehen. Das vergessen, Mitbürger, hieße, unser Überleben aufs Spiel setzen. Vergesst, ihr Bürger, nie und lasst es niemals zu.
Mein Vater sprach von Neuaufbau, Moral und Beharrlichkeit und musste dabei nicht erröten, denn ihm kam es weniger auf das Gesagte als auf die rhetorische Figur an, mit der er es ausdrückte. Später sollte er dazu bemerken: »Der letzte Satz ist Blödsinn, aber der Alexandriner ist hübsch. Hat sich gut gemacht an der Stelle, meinst du nicht?«
Die Rede dauerte insgesamt sechzehn Minuten und zwanzig Sekunden – nach meiner Uhr und ohne den ergriffenen Beifall mitzurechnen –, ein winziger Bruchteil dieses Samstags, des sechsten August 1988, an dem Bogotá vierhundertfünfzig und Kolumbiens Unabhängigkeit hundertneunundsechzig Jahre weniger ein Tag alt wurde und meine Mutter seit zwölf Jahren, sieben Monaten und vier Tagen tot war. Und ich, der ich siebenundzwanzig Jahre, sieben Monate und vier Tage alt war, sah mich plötzlich von einem Gefühl der Unverwundbarkeit überwältigt, und alles schien damals darauf hinzudeuten, dass wir beide, mein Vater und ich, das Steuer unseres Lebenserfolgs fest in der Hand hielten und uns nichts würde zustoßen können, denn die geheime Verschwörung der Dinge (die wir Glück nennen) war auf unserer Seite, und fortan würde uns die Bestandsaufnahme unserer Errungenschaften erwarten, eine endlose Prozession großspuriger Schlagworte: der Stolz der Freunde, der Neid der Feinde, die erfüllte Mission. Ich muss es nicht aussprechen, tue es aber dennoch: Keine dieser Prophezeiungen bewahrheitete sich. Ich veröffentlichte ein Buch, ein harmloses Buch, und nichts war mehr wie vorher.
Ich weiß nicht, wann genau mir klar wurde, dass Sara Gutermans Erinnerungen der Stoff für ein Buch von mir werden würden, und wann mir diese Offenbarung nahelegte, die ruhmreiche Arbeit eines Chronisten könne maßgeschneidert für mich sein oder ich für sie. (Ein Irrtum. Ich war nur einer von vielen in diesem Beruf, der niemals Ruhm bringt, war eine enttäuschte Hoffnung, dieser feine Euphemismus.) Als ich mich an die ersten Nachforschungen über ihr Leben machte, merkte ich, dass ich zwar wenig über sie wusste, jedoch mehr, als vorhersehbar oder üblich gewesen wäre, denn seit ich denken kann, war Sara Gast an unserem Tisch gewesen, und viele Anekdoten aus ihrem üppigen Geschichtenrepertoire waren mir im Gedächtnis geblieben. Vor meinem Buchprojekt hatte ich noch nie von Emmerich gehört, dem deutschen Städtchen, in dem Sara geboren worden war. Ihr Geburtsdatum (1924) schien mir damals noch nicht aussagekräftiger als das ihrer Ankunft in Kolumbien (1938); dass ihr Mann Kolumbianer gewesen war, wie auch ihre Söhne und Enkel, und dass sie seit fünfzig Jahren in Kolumbien lebte, genügten mir für eine Karteikarte und die unumgängliche Greifbarkeit der Fakten – viel lässt sich über einen Menschen sagen, doch erst wenn wir mit Daten und Orten kommen, beginnt er zu existieren –, aber weiter reichte ihr Nutzen nicht. Über Zeit- und Ortsangaben und dergleichen Informationen vergingen mehrere Interviewsitzungen, bei denen vor allem auffiel, wie unumwunden Sara sprach, ohne in Gleichnisse oder Ausflüchte zu verfallen, als hätte sie ein ganzes Leben lang darauf gewartet, davon zu erzählen. Ich stellte Fragen, und sie lieferte weniger Antworten als Bekenntnisse. Unser Austausch glich am Ende einem Kreuzverhör vor Gericht.
Ihr Name war Sara Guterman, sie war ’24 geboren, ’38 nach Kolumbien gekommen?
Ja, richtig.
Was für Erinnerungen hatte sie an die letzten Tage in Emmerich?
An einen gewissen Wohlstand vor allem. Ihre Familie lebte von einer Sandpapierfabrik und nicht etwa recht und schlecht, sondern mit einem guten Auskommen, könnte man sagen. Sara sollte erst dreißig Jahre später begreifen, was für einen Wohlstand ihnen die Fabrik ermöglicht hatte. Sie erinnerte sich auch an eine unbeschwerte Kindheit. Und später an die Furcht, wohl nach dem ersten Boykott gegen die Fabrik (Sara war noch nicht zehn, aber am Morgen in die Schule zu gehen und den Vater noch zu Hause zu wissen, war beängstigend), und an eine Art Faszination angesichts dieses neuen Gefühls.
Wie gelang ihnen die Ausreise aus Deutschland?
1937, in einer Oktobernacht, rief die Telefonistin des Städtchens bei der Familie an und warnte sie, ihre Festnahme sei für den nächsten Tag vorgesehen. Das hatte sie wohl beim Weiterleiten eines Anrufs erfahren, wie damals bei Frau Maiers Ehebruch (Sara erinnerte sich nicht mehr an den Vornamen der Ehebrecherin). Die Familie flüchtete noch in derselben Nacht über die berühmte grüne Grenze nach Holland, in ein Versteck auf dem Land. Dort harrten sie mehrere Wochen lang aus. Nur Sara verließ den Unterschlupf, um wieder in die umgekehrte Richtung nach Hagen zu fahren, wo die Großeltern lebten, und ihnen von dem Vorgefallenen zu erzählen (die Familie glaubte, eine Dreizehnjährige könne unbehelligter reisen). Von ihrer Fahrt im D-Zug – der Schnellzug der damaligen Zeit – war ihr noch ein Erlebnis in Erinnerung: Sie hatte Fleischbrühe getrunken, und wie sich der Würfel, für sie etwas Neues damals, in dem heißen Wasser auflöste, begeisterte sie. Man hatte sie in ein Abteil gesetzt, in dem alle rauchten, und ein schwarzer Mann setzte sich neben sie und sagte ihr, er rauche nicht, setze sich jedoch immer dorthin, wo er Rauch sehe, denn die Rauchergespräche seien anregender, während Nichtraucher die ganze Fahrt über den Mund nicht aufmachten.
War es nicht riskant, wieder nach Deutschland einzureisen?
Und wie. Kurz vor der Ankunft fiel ihr auf, dass sich ein junger Mann um die zwanzig ins Nachbarabteil gesetzt hatte und ihr jedes Mal folgte, wenn sie in den Speisewagen ging, um Fleischbrühe zu trinken. Sie befürchtete natürlich, dass es jemand von der Gestapo war, denn diese Furcht war damals allgegenwärtig, und als sie in den Hagener Bahnhof einfuhren, stieg sie aus und ging zu dem Onkel, der sie erwartete, begrüßte ihn jedoch nicht, sondern fragte nach den Toiletten, und er begriff zum Glück die Situation, spielte mit, begleitete das junge Mädchen zur Bahnhofsrückseite und trat mit ihr trotz des Protests zweier Frauen in die Toilette. Drinnen erzählte Sara ihrem Onkel, dass die Familie in Sicherheit sei und ihr Vater beschlossen habe, nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. Das war das erste Mal gewesen, dass sie ihm gegenüber vom Fortgehen sprach. Während der Onkel ihr zuhörte, zupfte er an einem Plakat, das vermutlich jemand mit zu viel Gepäck dort angebracht hatte: Münchener Fasching.300 Künstlerfeste. Sara fragte ihren Onkel, ob man auf dem Weg von Hagen nach München umsteigen müsse oder ob es direkte Züge gebe. Der Onkel erwiderte nichts.
Warum Kolumbien?
Wegen einer Anzeige. Einige Monate zuvor hatte Saras Vater in der Zeitung eine Anzeige gesehen, eine Käsefabrik stehe zum Verkauf, in Duitama (einer unbekannten Stadt) in Kolumbien (einem primitiven Land). Da ihm das Reisen damals noch möglich, das heißt, nicht gesetzlich verboten war, beschloss er, hinzufahren und die Fabrik persönlich in Augenschein zu nehmen, und wieder in Deutschland erzählte er, das sei ein fast aussichtsloses Unterfangen, die Fabrik sei mehr als simpel und beschäftige nur drei Mädchen, aber womöglich müsse man die Reise in Erwägung ziehen. Und als der Notfall eintrat, wurde die Reise in Erwägung gezogen. Im Januar 1938 trafen Sara und ihre Großmutter mit dem Schiff in Barranquilla ein, und während sie dort auf den Rest der Familie warteten, erreichten sie die Nachrichten von den Verfolgungen, den Verhaftungen von Freunden und Bekannten, von all den Dingen, denen sie entgangen waren und – was noch erstaunlicher war – im Exil weiterhin entgehen würden. Zwei Wochen später flogen sie von Barranquilla zu Bogotás Flugplatz Techo (in einer zweimotorigen Boeing, einer Maschine der deutsch-kolumbianischen SCADTA, wie man ihr später erzählte, als sie sechzehn, siebzehn war und allmählich Fragen stellte, um sich die Tage ihrer Ankunft in Erinnerung zu rufen), und dort nahmen sie vom Bahnhof Estación de la Sabana einen Zug, der sie zu dem Ort brachte, der damals nicht mehr als ein Dorf war, wo man Käse herstellte.
Was war ihr von der Fahrt im kolumbianischen Zug noch in Erinnerung?
Ihre Tante Rotem, eine alte, fast kahle Frau, deren Autorität in Saras Augen von ihrer Kahlheit beeinträchtigt wurde, beklagte sich die ganze Fahrt über. Die arme Frau konnte nicht begreifen, dass in dem Zug die erste Klasse hinten war, konnte nicht begreifen, dass das Mädchen, das durch ein unbekanntes Land reiste, ihre Nase in ein Album mit zeitgenössischer Kunst steckte – ein Heft mit Transparentpapier, das ihrem Cousin gehörte und irrtümlich in ihr Gepäck geraten war –, anstatt über die Berge, die Plantagen, die Farbe der Flüsse zu reden. Das Mädchen schaute sich die Abbildungen an und wusste nicht, dass in einigen Fällen – dem von Chagall, zum Beispiel – die Originale schon nicht mehr existierten, weil sie verbrannt worden waren.
Was waren ihre ersten Eindrücke, als sie in Duitama eintraf?
Ihr gefiel einiges: Der Schlamm vor der Haustür, der Name der Käsefabrik (Córcega, ein Wort mit französischem Beigeschmack, dem auch der Zauber eines Meers innewohnte, das zu ihrem Heimatkontinent gehörte, des Mittelmeers, das sie auf Postkarten gesehen hatte), die Farbe, die man auf den Gouda strich, um ihn von den anderen Sorten zu unterscheiden, die harmlosen Scherze, die ihre Schulfreundinnen während der ersten Monate mit ihr trieben, und die Tatsache, dass die Nonnen von La Presentación, der Mariä-Opferungs-Schule, die die störrische Ignoranz des Mädchens nicht zu begreifen schienen, immer vor Seligkeit vergingen, wenn sie von Tod und Auferstehung, vom Karfreitag und der Ankunft des Herrn sprachen, während ihnen vor empörten Seufzern die Luft wegblieb, als sie Sara dabei erwischten, wie sie den Töchtern des Anwalts Barreto, einem alten Freund des ehemaligen Präsidenten Olaya Herrera, die Sache mit der Beschneidung erklärte.
So schrieb ich Ende 1987 zwei Seiten nieder und überraschte mich dabei, wie ich unter alten Papieren die Karteikarte suchte, auf der ich mir Jahre zuvor eine Art Schnellkurs im Schreiben notiert hatte, erteilt von meinem Vater, nachdem er erfahren hatte, dass meine Abschlussarbeit anstand. »Erstens: Was gut klingt, ist gut für den Text. Zweitens: Im Zweifelsfall siehe Punkt eins.« Wie schon damals, als ich meine Arbeit schrieb, wirkte diese Karte, die nun an einer Reißzwecke über dem Schreibtisch hing, wie ein Amulett, eine Art Voodoo gegen die Furcht. Auf den beiden Seiten tauchte nur ein Bruchteil des erzählten Lebens auf, etwa die Verhaftung von Saras Vater, Peter Guterman, wie die Soldaten eine Gipsbüste an der Wand zerschmetterten und mit Messern die Ledersessel aufschlitzten, jedoch ohne Erfolg, denn die Ausweise, die sie suchten, waren nirgendwo im Haus, sondern steckten reichlich zerknittert im Mieder der Mutter, und acht Tage später, als Peter Guterman freigelassen wurde, allerdings ohne Pass, konnten sie damit die Grenze passieren und sich in IJmuiden samt Auto und Sack und Pack am Nordseekanal in der Nähe von Amsterdam einschiffen. Aber das Wichtigste an diesen zwei Seiten war etwas anderes. Sie waren der Beweis, dass all das erzählt werden konnte, waren der Wink, dass es von mir erzählt werden konnte, waren die Verheißung einer merkwürdigen Befriedigung: dem Leben der anderen eine Form zu verleihen, ihre Erlebnisse zu stehlen, die immer wirr und ungeordnet sind, und ihnen auf dem Papier eine Ordnung zu geben, auf mehr oder weniger ehrenwerte Weise diese Neugier zu rechtfertigen, die ich immer für jegliche Absonderung der anderen empfunden habe (von ihren Ideen bis zur Monatsregel) und die mich wie durch inneren Zwang dazu treibt, Geheimnisse zu verletzen, Dinge weiterzuerzählen, die man mir anvertraut, mich für die anderen als Freund zu interessieren, wenn ich sie im Grunde wie ein gewöhnlicher Reporter interviewe. Aber ich habe noch nie gewusst, wo die Freundschaft endet und die Reportage beginnt.
Mit Sara war es nicht anders. Mehrere Tage lang fragte ich sie aus, und mit solcher Hingabe oder krankhafter Hartnäckigkeit, dass ich allmählich eine zweite Persönlichkeit entwickelte und das Ersatzleben der Befragten und mein eigenes alltägliches als zwei Parallelleben wahrnahm und nicht als ein erzähltes und ein wirkliches. Ich wohnte dem faszinierenden Schauspiel eines wohlverwahrten Gedächtnisses bei: Sara besaß ganze Mappen voller Dokumente als Zeugnis ihres Wandels auf Erden, der ebenso wirklich und greifbar war wie ein Schuppen aus dem Holz ihres Heimatlandes. Es gab offene Plastikmappen, solche mit Klappen, Kartonmappen mit und ohne Gummizug, Mappen in Pastellfarben, in verschmutztem Weiß oder in Schwarz, Mappen, die dort bescheiden schlummerten und nur darauf warteten, bereitwillig ihre Rolle als Zweitbesetzung der Pandora zu übernehmen. Abends, fast immer gegen Ende unserer Unterhaltung, verstaute Sara die Mappen, nahm die Kassette aus dem Rekorder, auf der ich während der letzten Stunden ihre Stimme aufgenommen hatte, legte eine Platte mit deutschen Liedern aus den Dreißigern auf (Veronika, der Lenz ist da oder Mein kleiner grüner Kaktus) und lud mich ein, schweigend ein Glas mit ihr zu trinken, während wir der alten Musik lauschten. Der Gedanke gefiel mir, dass man von draußen, etwa von der Wohnung eines neugierigen Nachbarn aus, der uns ausspionierte, folgendes Bild sehen würde: ein leuchtendes Rechteck und zwei Gestalten, eine Frau, die sich bereits am Rand des Alters eingerichtet hatte, und ein junger Mann, ihr Schüler oder vielleicht ihr Sohn, jedenfalls jemand, der zuhört und ans Zuhören gewöhnt ist. Derjenige war ich: schweigend und aufmerksam lauschend, doch war ich nicht ihr Sohn, sondern machte Notizen, weil das meine Arbeit war, und dachte währenddessen, dass ich mir später, sobald alle Notizen gemacht, alle Unterlagen eingesehen und alle Meinungen gehört wären, das ganze Dossier dieses Falls, meines Falls, vornehmen und ihm meine eigene Ordnung auferlegen würde. War das nicht das einzige Privileg des Chronisten?
Damals fragte mich Sara, weshalb ich über ihr Leben schreiben wolle, und ich dachte, dass es einfach gewesen wäre, der Frage auszuweichen oder sie mit irgendeinem Bonmot abzuspeisen. Doch für mich war eine möglichst wahrheitsgetreue Antwort so wesentlich wie anscheinend für sie. Ich hätte ihr sagen können, dass ich mir über einiges klar werden wolle. Dass mir gewisse Bereiche meiner Erfahrungswelt (in meinem Land, unter meinen Landsleuten, in dieser Zeit, in die der Zufall mich hineingeboren hatte) entgangen seien, vor allem, weil ich meine Aufmerksamkeit auf andere, banalere gerichtet hätte, und dem wolle ich abhelfen. Mir bewusst werden, das sei meine Absicht, so einfach und anmaßend zugleich. Und über die Vergangenheit nachdenken, jemanden dazu bringen, sich an sie zu erinnern, sei ein Weg dahin, ein Stemmen gegen die Entropie, ein Versuch, der Unordnung der Welt, deren Los eine immer größere Unordnung ist, Einhalt zu gebieten, ihr Fußschellen anzulegen, sie wenigstens einmal zu bezwingen. All das oder einen Teil davon hätte ich ihr sagen können und führe zu meinen Gunsten an, dass ich diese großspurigen Lügen vermied und bescheidenere vorzog oder, besser gesagt, halbe Wahrheiten. »Ich will seine Wertschätzung, Sara«, sagte ich. »Ich will, dass er mich respektiert. Das ist mir im Leben immer das Wichtigste gewesen.« Ich wollte die halbe Wahrheit gerade vervollständigen und Sara von dem Satz erzählen, mit dem mein Vater sie einmal beschrieben hatte – »sie ist meine Schwester im Schatten«, hatte er gesagt, »ohne sie hätte ich nicht eine Woche in dieser verrückten Welt überlebt« –, aber ich kam nicht dazu. Sara unterbrach mich. »Ich verstehe«, sagte sie, »verstehe vollkommen.« Und ich ließ es dabei bewenden, denn es erschien mir ganz natürlich, dass die Schwester im Schatten alles ohne weitere Erklärung verstand. Doch ich notierte auf eine Karteikarte: Kapitelüberschrift »Die Schwester im Schatten«. Ich gebrauchte diese Überschrift allerdings nie, denn mein Vater wurde weder während der Gespräche noch im Buch erwähnt, obwohl er – zumindest dem Anschein nach – eine wichtige Rolle in Sara Gutermans Exilleben gespielt hatte.
Ich veröffentlichte Ein Leben im Exil im November 1988, drei Monate nach der berühmten Rede meines Vaters. Ich füge das erste Kapitel an. Die Überschrift in großzügigen Kursivbuchstaben bestand aus vier Wörtern, die sich im Laufe der Zeit wie ein Gefäß immer weiter anfüllten und heute, während ich dies schreibe, überzulaufen drohen: Das Hotel Nueva Europa.
Als Erstes strich Peter Guterman nach seiner Ankunft in Duitama das Haus und baute ein zweites Stockwerk an. Dort befanden sich, von einem engen Flur getrennt, Büro und Schlafzimmer, ganz wie zu Hause in Emmerich. Schon immer waren bei ihm Arbeit und Familie nur wenige Meter voneinander entfernt gewesen. Außerdem erschien ihm die Vorstellung, ein neues Leben in alten Wänden zu beginnen, als forderte er sein Glück heraus. Und so entschied er sich für den Umbau. Die anderen Deutschen aus Tunja oder Sogamoso rieten ihm aufs Lebhafteste davon ab, ein Haus herzurichten, das ihm nicht gehörte.
»Kaum haben Sie es hübsch gemacht«, sagten sie, »wird der Eigentümer es zurückverlangen. Hier muss man äußerst vorsichtig sein, denn die Kolumbianer sind eine gerissene Bande.«
Und so kam es auch. Der Eigentümer beanspruchte das Haus, führte einen imaginären Käufer an und entschuldigte sich kaum für die Unannehmlichkeiten. Die Familie Guterman war noch nicht einmal sechs Monate in Kolumbien und musste bereits umziehen. Doch da kam die erste glückliche Fügung. Damals wurde in Tunja ein Fest gefeiert. Die Stadt war voller wichtiger Leute. Ein Schweizer Geschäftsmann aus Bern, der in Kolumbien pharmazeutische Laboratorien eröffnen wollte, hatte sich mit der Familie angefreundet. Eines Tages gegen zehn Uhr fand er sich unangemeldet bei ihnen ein.
»Ich brauche einen Dolmetscher«, sagte er zu Peter Guterman. »Es geht nicht bloß um ein wichtiges Geschäft. Es geht um Leben und Tod.«
Herrn Guterman fiel nichts Besseres ein, als seine Tochter anzubieten, die Einzige in der Familie, die Spanisch nicht nur verstand, sondern auch sprach. Sara musste dem Schweizer folgen. Sie wusste genau, dass der Wille eines dazu noch mit ihrem Vater befreundeten Erwachsenen für ein junges Mädchen Gesetz war. Allerdings fühlte sie sich in derlei Situationen immer unsicher. Sie hatte ihr Unbehagen angesichts der ungeschriebenen Gesellschaftsregeln ihres Gastlands noch nicht überwunden. Dieser Mann war Europäer wie sie. Inwiefern änderten sich seine Gewohnheiten, wenn er den Atlantik überquerte? Sollte sie ihn so begrüßen, wie sie es in Emmerich getan hätte? Aber in Emmerich hätte ihr dieser Mann nicht einmal ins Gesicht geschaut. Sara vergaß nie die Geringschätzung, die sie dort in den letzten Jahren immer wieder gespürt hatte, und auch nicht, wie sich die Miene der Gojim verändert hatte, wenn sie von ihrem Vater redeten.
Sie ging zu dem Geschäftsessen, und der Mann, für den sie die Worte des Schweizers ins Spanische übersetzen sollte, erwies sich als der Präsident Eduardo Santos, dessen Freundschaft zur deutschen Gemeinde bekannt war. Da stand also Santos, den Saras Vater so hoch achtete, drückte der jungen Dolmetscherin die Hand, fragte sie, wie es ihr gehe, und beglückwünschte sie zu ihrem guten Spanisch. »Von dem Augenblick an fühlte ich mich für immer der liberalen Partei verpflichtet«, sollte Sara viele Jahre später mit stark ironischem Unterton sagen. »So bin ich nun mal. Drei Phrasen, und ich schmelze dahin.« Sie dolmetschte während eines zweistündigen Mittagessens (nach zwei weiteren Stunden hatte sie den Inhalt der gedolmetschten Worte bereits vergessen), und am Ende erwähnte sie Santos gegenüber die Sache mit dem Umzug.
»Wir sind es müde, von Haus zu Haus zu ziehen«, sagte sie. »Als würde man in einem ewigen Schichtwechsel leben.«
»Machen Sie doch ein Hotel auf«, sagte Santos. »Dann können Sie die anderen ausquartieren.«
Aber so einfach war die Sache nicht. Ausländern war es damals bereits verboten, ohne Genehmigung andere Berufe auszuüben als die bei der Einreise angegebenen. Sara wies den Präsidenten darauf hin.
»Ach, da machen Sie sich keine Gedanken«, bekam sie zur Antwort. »Für die Erlaubnis sorge ich.«
Und ein Jahr später, die Käsefabrik war inzwischen mit üppigem Gewinn verkauft worden, eröffneten sie in Duitama die Hotel-Pension Nueva Europa. Einem Hotel, zu dessen Einweihung der Präsident der Republik kam (dachte alle Welt), war der Erfolg sicher.
Saras Vater hatte ihm eigentlich den eigenen Namen geben wollen, Hotel-Pension Guterman, aber seine Kompagnons erklärten ihm, dass so ein Nachname in diesen Zeiten am wenigsten dafür geeignet sei, ein Geschäft zu eröffnen. Nur einige Monate zuvor hatte ein Taxiunternehmen in Bogotá sieben emigrierte Juden eingestellt; die Taxifahrer der Stadt hatten eine ausgeklügelte Schmähkampagne gegen sie inszeniert, und überall, an den Schaufenstern im Zentrum, an den Taxischeiben oder den Straßenbahnen, konnte man Schilder mit der Aufschrift lesen: WIR UNTERSTÜTZEN DIE TAXIFAHRER IN IHREM KAMPF GEGEN DIE POLEN. Das war das erste Anzeichen, dass das neue Leben nicht leichter sein würde als das vorige. Als die Gutermans von dem Vorfall mit den Taxifahrern erfuhren, nahm es sich der Vater so sehr zu Herzen, dass die Familie Schlimmes befürchtete. (Einer ihrer Freunde hatte sich in seinem Haus in Bonn kurz nach dem Pogrom von ’38 erhängt.) Peter Guterman reagierte besonders empfindlich auf diese falsche Nationalität, die ihm die Vox populi da zuwies. Erst nach Jahren konnte er sich an den Gedanken gewöhnen, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft verloren hatte, als wäre ihm ein Gegenstand abhanden gekommen oder ein Schlüssel aus der Tasche gefallen. Er beklagte sich nicht, schnitt jedoch die Statistiken aus, die regelmäßig in den hinteren Seiten der Bogotaer Presse erschienen: »Hafen: Buenaventura. Dampfer: Bodegraven. Juden: 47. Verteilung: Deutsche (33), Österreicher (10), Jugoslawen (3), Tschechoslowaken (1).« In seinem Album gab es finnische Schiffe wie das Vindlon und spanische wie das Santa María. Peter Guterman verfolgte die Nachrichten so aufmerksam, als könnte auf den Dampfern jemand aus seiner Familie eintreffen. Aber Sara wusste, dass diese Ausschnitte weniger Familienanzeigen darstellten als Notruftelegramme, deutliche Zeugnisse des Unbehagens, das die Neuankömmlinge bei den Ansässigen hervorriefen. Diese Umstände entschieden letztlich die Namensgebung des Hotels. Peter Gutermans Teilhaber waren Kolumbianer, die drei Silben des Wortes »Europa« klangen für sie wie ein Wundermittel. Saras Vater schrieb ihnen in einem Brief, der später in die Familiengeschichte einging, in diesen Anekdotenschatz, mit dem Tanten und Großmütter auf der ganzen Welt die häuslichen Mahlzeiten anreichern, als müssten sie den Nachkommen damit das Gedächtnis eines ganzen Geschlechts übertragen: »Ich weiß nicht, was Sie so fasziniert am Namen einer Kuh.« Und sie lasen den Brief und lachten, lasen ihn wieder und wieder und wurden noch lange Zeit von Lachen geschüttelt.
Das Hotel Nueva Europa befand sich in einem dieser Kolonialhäuser, die nach der Unabhängigkeit in Kloster umgewandelt und dann an Priesterseminare oder Religionsgemeinschaften weitergegeben worden waren, welche keinen großen Ehrgeiz daran setzten, sie zu erhalten. Ihre Bauweise war immer die gleiche. Alle besaßen einen Innenhof, in dessen Mitte die Statue des Ordensgründers oder irgendeines Heiligen stand. In dem zukünftigen Hotel herrschte die Statue von Bartolomé de las Casas über den Hof, aber der Mönch wurde so schnell wie möglich durch einen Brunnen ersetzt. Der Brunnen des Nueva Europa bestand aus einem runden Becken, so groß, dass sich ein Mann darin ausstrecken konnte – wie mancher Betrunkene zu Zeiten des Hotels –, und sein Wasser roch nach Stein und Moos. Zu Anfang war der Brunnen voll kleiner tänzelnder Goldfische gewesen, später voll Münzen, die vor sich hin rosteten. Vor den Fischen hatte es nur das Wasser und das Becken gegeben, an dem sich morgens die Vögel sammelten, in solchen Scharen, dass man sie mit Besengefuchtel verscheuchen musste, denn nicht alle Gäste fanden Gefallen an ihnen. Und der Gast war König. Es war kein billiges Etablissement. Peter Guterman nahm zwei Pesos fünfzig pro Tag, inklusive fünf Mahlzeiten, während das Regis, damals das andere führende Hotel der Region, einen Peso weniger kostete. Aber das Nueva Europa war immer ausgebucht, vor allem von Politikern und Ausländern. Jorge Eliécer Gaitán (der die Vögel übrigens mit der gleichen Leidenschaft hasste, die auch seine Reden auszeichnete) und Miguel López Pumarejo zählten zu den treusten Gästen. Auch Klim, der Kolumnist Lucas Caballero, der weder Politiker noch Ausländer war, besuchte das Hotel, sooft es ihm möglich war. Bevor er die Reise antrat, schickte er stets Wort für Wort das gleiche Telegramm:
ANKUNFT NÄCHSTEN DONNERSTAG STOP
BITTE ZIMMER OHNE BALLONS
Mit Ballons waren die Daunenbetten gemeint, die Klim nicht mochte. Er bevorzugte die schweren Wolldecken, die Staubfänger sind und Allergiker zum Niesen bringen. Peter Guterman ließ ihm das Zimmer nach seinen Anweisungen herrichten, gab seine Befehle auf Deutsch und mit solchem Nachdruck, dass sich die Zimmermädchen, die aus Sogamoso und Duitama stammten, allmählich einen Grundwortschatz aneigneten. Errpetter, sagten sie. Ja, Errpetter. Sofort, Errpetter. Herr Guterman, selbst erfahren in fixen Ideen, hatte Verständnis und Respekt für die fixen Ideen seiner besonders geschätzten Gäste. (Wenn sich Gaitán angesagt hatte, ließ er Vogelscheuchen auf den Dachziegeln aufstellen, auch wenn das seiner Ansicht nach den Dächern ihren folkloristischen Charme nahm.) Sara musste immer wieder einspringen, musste sich als Übersetzerin und Schlichterin betätigen, denn ihrem Vater bereitete das Spanisch entsetzliche Mühe, und er sollte es niemals richtig beherrschen. Da er zudem ein Mann war, der eine unmöglich zu erfüllende Effizienz erwartete, verlor er oft die Geduld und brüllte wie ein eingesperrtes Raubtier, wonach die Angestellten den ganzen Nachmittag über in Tränen aufgelöst waren. Peter Guterman war kein nervöser Mensch, aber es machte ihn nervös, wenn sich der Präsident, die Präsidentschaftskandidaten und die wichtigsten Journalisten der Hauptstadt um seine Hotelzimmer rissen. Sara, die mit der Zeit ihre neue Heimat besser verstand, versuchte ihrem Vater zu erklären, dass die anderen eigentlich die Nervösen waren, dass in diesem Land ein Mann aus dem simplen Grund das Sagen hatte, weil er aus dem Norden stammte, und dass für die Hälfte seiner großspurigen, ehrgeizigen Gäste der Besuch eines Hotels einem Aufenthalt im Ausland gleichkam. Genau so war es. Ein Zimmer im Hotel der Familie Guterman war für die Mehrzahl dieser ambitiösen Einheimischen die einzige Gelegenheit, etwas von der Welt zu sehen, verschaffte ihnen die einzige tragende Rolle in dem belanglosen Theaterstück, das sie spielten.
Denn das Nueva Europa war vor allem ein Treffpunkt für Ausländer. Nordamerikaner, Spanier, Deutsche, Italiener, Menschen aus aller Herren Länder. Kolumbien, das niemals ein Einwanderungsland gewesen ist, schien es zumindest zu dieser Zeit und an diesem Ort zu sein. Einige waren Anfang des Jahrhunderts gekommen, um Geld zu machen, weil sie gehört hatten, dass in diesen südamerikanischen Ländern noch alle Tore offen standen; andere waren vor dem ersten Weltkrieg geflohen, in der Mehrzahl Deutsche, die sich über die Welt zerstreut hatten und versuchten, sich durchs Leben zu schlagen, weil das in ihrem Land nicht mehr möglich war; und da waren die Juden. So entpuppte sich Kolumbien auch als Land der Flüchtlinge, nicht mehr und nicht weniger. Und diese Verfolgten trafen sich am Ende in der Hotel-Pension Nueva Europa, als wäre es das Abgeordnetenhaus der vertriebenen Welt, ein Weltmuseum der Auswanderer. Und manchmal schien es das wirklich zu sein, denn die Gäste versammelten sich jeden Abend unten im Salon, um im Radio die Nachrichten vom Krieg zu hören. Natürlich gab es Streit und Wortgefechte, die jedoch immer moderat blieben, denn Peter Guterman hatte sehr schnell dafür gesorgt, dass die Leute die Politik an der Rezeption ablegten, wie er es nannte, und keiner vergaß es, denn das war einer der wenigen Sätze, die der Hoteldirektor fließend auf Spanisch hervorbrachte: »Bitte, du lässt die Politik an Rezeption«, sagte er den Ankommenden, bevor sie überhaupt ihr Gepäck ausgeladen und sich ins Register eingetragen hatten, und die Leute respektierten die Abmachung, weil für alle ein kurzzeitiger Waffenstillstand bequemer war, als sich jedes Mal, wenn man zum Essen hinunterging, auf Handgreiflichkeiten mit den Tischnachbarn gefasst zu machen. Aber vielleicht war das gar nicht der Grund. Vielleicht setzten sich in diesem Hotel am anderen Ende der Welt tatsächlich Leute an einen Tisch, die in ihrem Ursprungsland die Fenster der Rezeption mit Steinen eingeworfen hätten. Was vereinte sie? Was neutralisierte den erbarmungslosen Hass, der das Nueva Europa als Nachricht wie aus einem anderen Leben erreichte?
Denn während der ersten Jahre war der Krieg nur eine Rundfunkmeldung, ein trauriges Schauspiel aus anderen Regionen. »Später erst erstellte man schwarze Listen, verwandelte die Hotels in Luxusgefängnisse«, sagt Sara und meint die Internierungslager für die Bürger der Achsenmächte. »Ja, das kam später. Erst später kam der Krieg von jenseits des Meeres den Leuten an diesem Ufer ins Haus. Wir waren so naiv, wiegten uns in Sicherheit. Das wird dir alle Welt bestätigen. Das hat noch jeder gut in Erinnerung. Es war schwierig damals, deutsch zu sein.« Im Hotel der Familie Guterman geschahen Dinge, die Familien zerrütteten, Leben zerbrachen, Schicksale zerstörten; aber all das wurde erst viel später deutlich, es musste erst Zeit vergehen, bis sich die zerstörten Schicksale, die zerbrochenen Leben abzeichneten. Überall – in Bogotá, in Cúcuta, in Barranquilla, in armseligen Städtchen wie Santander de Quilichao – spielte sich das Gleiche ab. Manche Orte jedoch schienen wie schwarze Löcher zu sein, die das Chaos anzogen, das Schlechteste aus einem heraussaugten. Das Hotel der Gutermans war einer davon, vor allem zu einer bestimmten Zeit. »Allein der Gedanke daran tut weh«, sagt Sara Guterman heute, wenn sie fünfundvierzig Jahre später an diese Ereignisse denkt. »Ein so hübscher Ort, den die Leute so lieben und an dem so schreckliche Dinge passieren können.« Und was war passiert? »Wie in der Bibel. Sohn gegen Vater, Vater gegen Sohn, Bruder gegen Bruder.«
Natürlich verlangt oder sollte das Hinschreiben von Wörtern wie Auswanderer oder schwarze Listen vom Schreiber eine Art Absicherung verlangen. Mit Hypotheken belastete Wörter. Das Buch ist voll von ihnen. Das weiß ich jetzt, doch damals ahnte ich es kaum. In Manuskriptform machten diese Seiten einen so friedfertigen, neutralen Eindruck, dass es mir nie in den Sinn gekommen wäre, sie könnten jemandem zu nahe treten oder gar einen Streit auslösen. Die gedruckte und gebundene Version dagegen war ein Molotowcocktail, bereit, mitten im Hause Santoro zu landen.
»Ach, Santoro«, sagte Doktor Rakovsky, als eine Krankenschwester ihn anhielt, um ihn nach dem Ergebnis des Eingriffs zu fragen. »Vorname Gabriel, nicht wahr? Ja, es ist hervorragend gelaufen. Warten Sie hier. Gleich können wir hinein und den Patienten sehen.« Dann sei es also gutgegangen? Der Operierte lebendig? »Lebendig nicht, quicklebendig«, sagte der Arzt noch im Gehen und fügte die Phrase hinzu: »Sein Herz ist frisch wie ein Salatkopf.« Nach dem Schwindel, der mich bei dieser Nachricht überkam, geschah etwas Seltsames. Ich wusste nicht, ob der Name, der aus dem Mund des Arztes gekommen war, den Patienten oder den Sohn des Patienten meinte. Ich ging auf die Toilette, um mir das Gesicht zu waschen, bevor ich die Intensivstation betrat. Wegen meines Vaters, der mich nicht so sehen sollte, denn ich konnte mich nicht erinnern, wann einer von uns beiden den anderen zuletzt so verstört gesehen hatte. Vor dem Spiegel zog ich mir die Jacke aus, sah zwei nasse Schmetterlingsflecken unter den Achseln und musste plötzlich an Doktor Rakovskys Achseln denken, als wären wir enge Freunde, und während ich darauf wartete, dass mein Vater aufwachte, ekelte es mich vor dieser Intimität, die ich gar nicht gesucht hatte, vielleicht, weil ich von meinem Vater darauf gedrillt worden war, mich bei niemandem in der Schuld zu fühlen. Nicht einmal bei dem, der verantwortlich dafür war, dass er noch lebte.
Obwohl der Arzt im Plural gesprochen hatte, trat ich allein in die Intensivstation, diese Folterkammer. An den Wänden und auf den Rolltischen flimmerten die Monitore wie blinzelnde Schleiereulen; in einer abscheulichen Symmetrie angeordnet und abgeteilt durch undurchsichtige Trennwände, wie auf einer öffentlichen Toilette, standen dort sechs Betten, deren Aluminiumgeländer das Neonlicht reflektierten. Die Monitore piepsten jeder im eigenen Rhythmus, die Beatmungsgeräte pumpten, und in einem der Betten, im letzten auf der linken Seite, dem einzigen, das sich der Tafel gegenüber befand, auf der die Krankenschwestern mit roten und schwarzen Filzschreibern die Anwendungen für den Tag notierten, lag mein Vater und atmete durch einen grauen, gerippten Schlauch, der seinen Mund ausfüllte. Ich hob das Krankenhaushemd an und sah zum zweiten Mal an einem Tag (nachdem ich es vorher noch nie zu Gesicht bekommen hatte) das Geschlecht meines Vaters, das auf der Leiste ruhte, fast auf gleicher Höhe wie seine verkrüppelte Hand, es war beschnitten, im Gegensatz zu meinem. Man hatte einen Katheter angebracht, um ihm das Urinieren zu erleichtern. So standen die Dinge: Mein Vater war über Plastikschläuche mit der Welt verbunden, über Elektroden auf Brust und Stirn, die ihn wie gescheckt aussehen ließen, und über Nadeln (die für Schmerzmittel und Antibiotika verschwand in seinem Hals, die für den Tropf in der Ader seines linken Arms). Ich setzte mich auf einen runden Hocker und begrüßte ihn. »Hallo, Papa. Alles ist vorbei, alles ist gutgegangen.« Er konnte mich nicht hören. »Ich habe es ja gesagt, weißt du noch? Ich habe gesagt, dass es gutgehen wird, und nun ist es vorüber. Alles vorbei. Wir haben es geschafft.« Sein Beatmungsgerät arbeitete, sein Monitor flimmerte, aber er war abwesend. Der Halskatheter war am Gesicht mit einem Pflaster befestigt, das an der schlaffen Wangenhaut zog (den siebenundsechzigjährigen Wangen). So sah seine Haut, sein Gewebe noch welker aus, und ich musste nur ein wenig die Lider senken und hatte im Zeitraffer deutlich seine Verwesung vor Augen, all die freien Radikale, als würden sie über die Brücke der Dreißigsten spazieren. Und noch ein Bild holte ich mir ins Gedächtnis, um zu sehen, was es mir sagte: ein faustgroßes Plastikherz, in dem die Venen und Arterien reliefartig hervortraten und das einen ganzen Monat lang auf dem Pult meines Biologielehrers gelegen hatte.
Um vier Uhr nachmittags wurde ich fortgeschickt, obwohl ich nicht mehr als zehn Minuten bei dem Kranken gesessen hatte, doch am nächsten Tag kehrte ich in aller Frühe zurück, und nach einem Kampf mit der aggressiven Bürokratie der San Pedro-Klink – die Anmeldung bei der Verwaltung, das Beantragen eines Dauerausweises, der Name und Ausweisnummer vermerkte und den ich gut sichtbar an die Brust zu heften hatte, die Erklärung, dass ich der einzige Verwandte des Kranken und somit der einzige Besucher war – blieb ich bis nach zwölf Uhr mittags, wonach mich dieselbe Krankenschwester wie am Vortag hinauswarf, eine dick geschminkte Frau, an deren Stirn beständig Schweißtropfen hingen. Beim zweiten Besuch wurde mein Vater allmählich wach. Das war die eine Neuigkeit. Die andere teilte mir die Krankenschwester mit, als würde sie auf Prüfungsfragen antworten. »Man hat versucht, ihn vom Beatmungsgerät zu nehmen. Er hat nicht positiv reagiert. Wasser ist dabei in die Lungen getreten, und er hat die Besinnung verloren, aber inzwischen hat er sich etwas erholt.« Ein weiterer Schlauch drang nun in den Körper meines Vaters ein. Er füllte sich mit blutigem Wasser und mündete in einen Beutel mit Maßanzeige. Ja: eine Dränage. Er klagte über vielerlei Schmerzen, aber am meisten schmerzte der Schlauch, den man ihm zwischen die Rippen geschoben hatte und der ihn zwang, sich fast ganz auf die Seite zu drehen, obwohl gerade diese Stellung die qualvollste für seine operierte Brust war. Vor Schmerz konnte er nicht sprechen. Manchmal verzog sich sein Gesicht zu schrecklichen Grimassen, manchmal war er ruhig, ohne seine Gefühle zu offenbaren, ohne mich anzuschauen. Der Schlauch in seinem Mund gab seinem Stöhnen einen Ton, der unter anderen Umständen komisch gewirkt hätte. Die Krankenschwester kam, wechselte die Sauerstoffflasche, überprüfte den Dränagebeutel und ging wieder. Einmal blieb sie genau drei Minuten, nahm ihm die Temperatur ab und fragte mich, was mit der Hand meines Vaters passiert sei.
»Was geht Sie das an?«, fragte ich. »Machen Sie Ihre Arbeit und kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten.«
Sie stellte mir keine Fragen mehr, weder an diesem ersten noch an den folgenden Tagen, während derer sich das Routineprogramm wiederholte. Ich nahm die ganze Besuchszeit für mich allein in Anspruch, wobei ich von der fixen Idee meines Vaters profitierte, die Operation geheim zu halten, so dass ihm weder entfernte Verwandte noch Freunde ihre Anteilnahme bekundeten. Und doch hatte man den Eindruck, dass das inzwischen nicht mehr der Idealzustand war. »Ist keiner draußen?«, war seine erste Frage am Morgen des dritten Tages, sobald man ihm den Schlauch aus dem Mund genommen hatte. »Nein, Papa, niemand.« Und als die Besuchszeit am Nachmittag begann, zeigte er wieder auf die Tür und fragte durch die Wolke der Betäubungsmittel hindurch, ob keiner gekommen sei. »Nein«, sagte ich. »Niemand kommt dich stören.« »Jetzt bin ich ganz allein«, erwiderte er. »Ich habe es geschafft, am Ende ganz allein zu bleiben. Darauf habe ich hingearbeitet, mit all meiner Energie. Und du siehst, es ist mir perfekt gelungen, das schafft nicht jeder, wirf nur einen Blick ins Wartezimmer, quod erat demonstrandum.