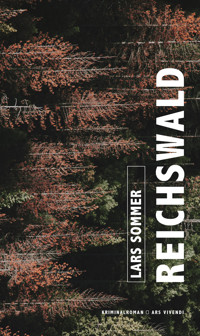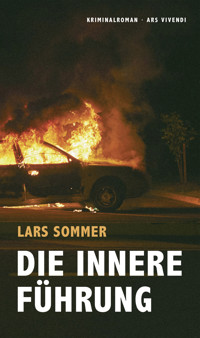
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Thriller um Liebe und Verrat und den Konflikt zwischen einem vernachlässigten Militär und einer Gesellschaft, die Frieden zu lange als selbstverständlich erachtet hat Nachdem auf der Hochzeit eines Elitesoldaten der Bundeswehr eine tödliche Bombe hochgeht, beginnt Kriminalhauptkommissar Erich Kleinrädl zu ermitteln. Während er und sein Team die Hochzeitsgäste vernehmen, stellt die Boulevardpresse ihre eigenen Vermutungen an: Hat Inka Minden, die Ex-Freundin des Bräutigams, etwas mit der Sache zu tun? Welche Rolle spielt der ehemalige Scharfschütze Jonathan von Holl, der über dem Gesetz zu stehen scheint? Das LKA beurteilt die Bombe als ein Werk von Fachleuten. Ein zweiter Anschlag erhöht den Druck auf Kleinrädl. War die Bundeswehr das eigentliche Ziel des Attentats? Die Lage wird immer unklarer. Steckt der Feind gar in den eigenen Reihen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lars Sommer
Die Innere Führung
Kriminalroman
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage Oktober 2024)
© 2024 by ars vivendi verlagGmbH & Co. KG, Bauhof 1,90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
www.arsvivendi.com
Umschlaggestaltung: ars vivendiCoverfoto: © Matt Hearne/unsplash
eISBN 978-3-7472-0628-7
Die Innere Führung
Für meinen Petter
SAMSTAG
1
Erich Kleinrädl war leicht zu übersehen, und das war ihm ganz recht.
Am Münchner Hauptbahnhof war es noch gedrängter als sonst. Am Vorabend hatte Deutschland die EM eröffnet und gegen Schottland gewonnen. Zwischen den übrigen Reisenden leuchteten die Trikots der Fußballfans weiß und rosa, die karierten Röcke der Schotten, dazwischen schwarze Inseln der Bereitschaftspolizei. Es war bereits dunkel, aber die Temperaturen machten noch keine Anstalten zu fallen. Das Werbeschild der Apotheke am Südausgang verkündete zweiunddreißig Grad. Es roch nach Bockwurst und Schweiß und Gewaltbereitschaft.
Tief sog Kleinrädl die Luft ein. Er wäre gewiss nicht so weit gegangen, die Melange an Gerüchen als erquicklich zu beschreiben. Doch das Gegröle, der Gestank waren ihm so vertraut, dass er eine Geborgenheit in der aufgeheizten Atmosphäre empfand, die einem Außenstehenden wohl schwerlich zu vermitteln gewesen wäre.
Dass auch er selbst im Grunde nichts anderes war als ein Außenstehender, störte ihn nicht. Am Fußball lag ihm nichts, noch weniger an den flüchtigen Freundschaften, die aus Rausch und Gewohnheit geboren waren. Sein Bier trank er stets alkoholfrei und allein.
Jemand rempelte ihn an, eine Flüssigkeit schlug gegen seinen Rücken, doch auch diese Unappetitlichkeit konnte ihm nichts anhaben. Das Sakko zog er aus, und das Hemd würde schnell trocknen. Wahrscheinlich war er der Einzige in der gesamten Innenstadt, der bei diesen Temperaturen mit Sakko unterwegs war.
Geduldig arbeitete er sich zum Nordausgang vor. Junge Männer mit blauen Schals und roten Gesichtern schrien verschmierte Satzfetzen in die Metallstreben des Hallendachs hinauf, Parolen, die nur die Erfahrung als Liedtexte einzuordnen vermochte.
Die Ausgelassenheit war erzwungen, die Gemeinschaft eine Illusion, der Überschwang nur einen falsch verstandenen Blick von zügelloser Aggression entfernt. Und doch fand Kleinrädl hier, was ihm im Alltag abhandengekommen war: einen bedingungslosen, verzweifelten Willen, das Leben nicht einfach geschehen zu lassen, sondern ihm eine Bedeutung abzuringen, so fadenscheinig und vergänglich sie auch sein mochte.
Er verließ den Bahnhof. Der Rausch der Masse hatte ihn mit nervöser Hand gestreift, doch kaum trat Kleinrädl auf die Arnulfstraße, drückte ihn die brutale Nüchternheit der Nachkriegsfassaden zurück in die Nichtigkeit seiner Existenz. Reflexhaft zog er sein Sakko wieder über, ein zweifelhafter Schutz gegen die Gleichgültigkeit der Welt. Die Hundertschaft, die sich in der Hirtenstraße bereithielt, beachtete ihn nicht.
Kleinrädl durchquerte den Alten Botanischen Garten. Die Polizei war mit den Fußballfans beschäftigt, das wussten die Dealer und lungerten entspannt unter Bäumen, deren Namen Kleinrädl nicht kannte. Er spürte die Blicke der Dealer zwischen seinen Schulterblättern. Sie konnten sehen, dass er unbewaffnet war. Trotzdem bestand keine Gefahr. So unscheinbar Kleinrädl wirkte, in bestimmten Kreisen hatte er doch einen gewissen Ruf. Er kannte Mün-chen bei Nacht genauso gut wie bei Tage, er war zu Hause in den dunkelsten Ecken der Messestadt und erhielt Einlass in Grünwalder Villen. Es gab Tage, an denen das Leben ihm Aufgaben zutrug, deren Erfüllung genügend Konzentration erforderte, um die Melancholie in die Schranken zu weisen. An diesen Tagen ertappte er sich manchmal dabei, die Stadt als sein Eigen zu betrachten.
Heute nicht.
In der Ottostraße stieg er in die Tram und fuhr Rich-tung Schwabing. Vom Elisabethplatz aus waren es noch zwei Minuten bis zu seinem Ziel. Er beeilte sich nicht. Eine Brise kam auf, trieb die Hitze des vergangenen Tages aus den Straßen. Neben einem Fahrradladen stand ein Tor offen. Kleinrädl zog sich so weit in die Einfahrt zurück, bis die Straßenbeleuchtung ihn nicht mehr erreichte, er vom Dunkel des Innenhofs geschluckt wurde.
Er hatte die Position mit Bedacht gewählt, das gegenüberliegende Gebäude war gut zu erkennen. Im zweiten Stock, dem sein besonderes Interesse galt, brannte Licht. Er hätte selbst nicht zu sagen gewusst, ob es Glück oder Unglück bedeutete – aber an einem der Fenster stand das Mädchen, dessentwegen er hier war. Es trug ein helles Top und eine blaue Jogginghose und war damit beschäftigt, seine langen blonden Haare zu kämmen. Dabei wippte es rhythmisch, bewegte die Lippen dazu. Doch obwohl das Fenster offen stand, drang keine Musik zu Kleinrädl herüber.
Das Mädchen hieß Sophia Mayers und stand kurz vor seinem fünfzehnten Geburtstag. Kleinrädl wusste so viel über sie und gleichzeitig viel zu wenig. Er fragte sich, wie sie ihren Geburtstag wohl feiern würde. Ob sie sich betrinken würde? Eine große Party veranstalten oder nur ihre engsten Freundinnen zum Essen einladen würde? Hatte sie einen Freund, mit dem sie die Nacht verbringen würde? Für den sie sich gerade vielleicht hübsch machte? Oder eine Freundin? Die Schweißflecken unter seinen Armen rührten nicht mehr von der Hitze.
Das Mädchen schloss das Fenster, zog dunkelgrüne Vorhänge zu. Für einen Augenblick befürchtete Kleinrädl, sie hätte ihn entdeckt. Rasch sah er weg.
»Was wollen Sie hier?«, blaffte ihn eine Männerstimme von der Seite an.
Erschrocken fuhr Kleinrädl herum. Tastete instinktiv nach der Waffe, die er normalerweise an der Seite trug. Vergeblich, natürlich. Hinter ihm im Hof stand ein breitschultriger Mittdreißiger in Hosenträgern, der einen zusammengeklappten Kinderwagen in Händen hielt. Der Mann musste aus einem der angrenzenden Gebäude in den Hof gelangt sein. Und zwar ohne dass Kleinrädl es mitbekommen hatte – verflucht, warum zur Hölle war er bloß hierhergekommen? »Ich warte auf einen Freund.«
»Hier?« Der Mann trat einen Schritt näher. »In meiner Einfahrt?« Er betätigte einen Lichtschalter.
Kleinrädl blinzelte. »Verzeihung. Ich dachte, er wohnt hier.« Er erfand einen Namen.
»Nie gehört«, sagte der Mann brüsk. Er verströmte die selbstbewusste Aura eines glücklichen Familienvaters, der gut genug verdiente, um sich eine Wohnung in der Münchner Innenstadt leisten zu können. »Im Übrigen bilde ich mir ein, ich hab Sie schon mal hier gesehen.«
»Das kann nicht sein«, behauptete Kleinrädl. Innerlich bebte er vor Zorn über seine Fahrlässigkeit.
»Machen Sie, dass Sie wegkommen.«
»Ja, schon gut.«
»Wenn ich Sie noch einmal hier erwische, rufe ich die Polizei.«
»Die können Sie vergessen. Die braucht eine halbe Stun-de, bis sie hier ist.« Kleinrädl biss sich auf die Lippe. Hatte er wirklich gerade eine Situation eskaliert, die ihn Kopf und Kragen kosten konnte?
»Was?« Inzwischen war der Mann auf einen Schritt herangetreten. Breitbeinig stand er da, hatte den Kinderwagen erhoben, als wolle er gleich damit zuschlagen.
So gleichgültig wie möglich zuckte Kleinrädl die Schultern. »Na, mit den ganzen Fußballfans.« Er wandte sich zum Gehen. »Schönen Abend.«
2
In ihren Achseln zwickte das geliehene Kleid, an den Fersen rieben die hochhackigen Schuhe, die Modern-Talking-Gedächtnis-Band spielte mit verstimmter Gitarre, und von den Kaviartorten ging ein Geruch aus, der keinen Zweifel daran ließ, dass man das Büfett besser in den Schatten gestellt hätte.
Wenn Minden sich ausmalte, wie viel Geld in die Hand genommen worden sein musste, um eine halbe Autostunde vor München ein ganzes Schloss zu mieten, konnte sie sich über das schäbige Ergebnis nur wundern.
»Sieh an, Inka Minden.« Der große Mann in maßgeschneiderten Nadelstreifen, der mit breitem Grinsen auf sie zutrat, hatte ihr gerade noch gefehlt. »Dich hätte ich ja am wenigsten hier erwartet.«
Minden rang sich ein Lächeln ab. »Jonathan.«
Eine Sekunde lang fürchtete sie, er wolle sie umarmen, aber wenn es eine Sache gab, die man Jonathan von Holl zugutehalten konnte: Er wahrte die Distanz. Zumindest die körperliche. Mit verschränkten Armen musterte er sie von oben bis unten, als wäre sie ein Auto auf dem Parkplatz eines Gebrauchtwagenhändlers. »Fantastisch siehst du aus. Steht dir. Also die Frauenklamotten.«
Minden leerte ihren Sekt. »Ich hol mir mal noch was zu trinken.«
»Ausgezeichnete Idee.« Von Holl leerte seinen eigenen Drink und folgte ihr zur Bar. Der Pavillon war mit einer Lichterkette aus blinkenden Herzen geschmückt. »Was macht der Nachwuchs?«
»Nachwuchs?«
»Bist du nicht Erzieherin inzwischen?« Er zwinkerte ihr zu. »Verantwortlich für die Zukunft unseres Landes.«
»Jugendtherapeutin.« An der Bar ließ sie sich einen Mai Tai mixen. Eine dumme Idee, aber nicht dümmer als die Entscheidung, überhaupt hierherzukommen.
Von Holl bestellte Whiskey Sour. »Mensch, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Drei Jahre?«
Minden spähte vergeblich nach einem vertrauten Gesicht, das sie retten könnte. »Sollte die Zeremonie nicht bald losgehen?«
»Halbe Stunde frühestens. Jugendtherapeutin also. Vom Regen in die Traufe, könnte man sagen.« Sein Lachen war zu laut.
Minden betrachtete die kandierte Kirsche, die in ihrem Cocktail schwamm. »Und du?«, fragte sie. »Dienst du noch?«
»BKA inzwischen.«
»Als Scharfschütze?«
»Ballistische Forensik.«
Das lieferte zumindest eine Erklärung, warum er sein Haar nicht mehr so kurz geschoren trug, wie sie es in Erinnerung hatte. »Wiesbaden? Fehlen dir die Berge nicht?«
Von Holl führte aus, dass er regelmäßig in München sei, Wiesbaden im Übrigen unterschätzt werde. Außerdem habe er den Nachlass einer Tante zu verwalten, die ein paar Güter in Nordhessen besessen habe.
Ein Kellner wieselte vorbei, Minden stellte ihr Glas auf seinem Tablett ab. Der Mann blieb stehen, starrte sie mit großen Augen an. »Sie sind Inka Minden!«
Schicksalsergeben nickte sie.
»Hören Sie, ich bin Ihr größter Fan. Ich klettere selbst ein bisschen, aber was Sie machen, das ist krass. Ehrlich, Sie haben mich zum Klettern gebracht – 2016 Paris! Das Finale, ich hab so mitgefiebert, wirklich. Und dann der Ellen-bogen, oder die Schulter – was war’s noch mal?«
»Schulter.«
»Trotzdem noch Bronze. Sie müssen doch vollgepumpt mit Schmerzmitteln gewesen sein, verrückt, ich fass es nicht, Inka Minden ... können wir vielleicht ein Selfie?« Schon fuhr der Mann mit der freien Hand in die Hosentasche.
Ein Hüsteln von der Seite. »Was haben Sie da an den Händen?«
Der junge Mann sah verwirrt zu von Holl, der die Frage gestellt hatte. »Handschuhe ...« Er zog die leere Hand wieder nach oben.
»Sehr richtig. Und sehen Sie noch jemanden mit weißen Handschuhen hier herumlaufen?«
»Die anderen Serviceleute ...?«
»Gleich die zweite korrekte Antwort in Folge, Sie haben ja einen richtigen Lauf. Und warum tragen denn Sie und Ihre Kollegen diese schönen weißen Handschuhe?«
Minden warf von Holl einen bittenden Blick zu, aber wenn der einmal losgelegt hatte, war er schwer aufzuhalten. »Damit keine Fettflecke an die Gläser kommen«, erklärte er, »während Sie uns Getränke anreichen. Das ist nämlich Ihre Arbeit. Sie werden dafür bezahlt, uns Getränke anzureichen. Nicht dafür, unsere Gespräche zu stören. Also ...«
»Jonathan.« Minden fasste ihn am Arm. »Lass ihn doch sein Foto machen.«
Doch der Kellner haspelte bereits eine Entschuldigung und bemühte sich, Land zu gewinnen. Von Holl sah ihm hinterher und faselte etwas von gutem Geld und gutem Personal, die natürlicherweise zusammengehören sollten.
In Mindens Schädel begann der Mai Tai zu wirken. Die Juni-Hitze tat ihr Übriges. Kaviartorten hin oder her, sie brauchte was zu essen.
»Schau mal, wer da kommt.«
Widerwillig folgte sie von Holls Blick. Wer immer es war, ihr Bedarf an Small Talk war gedeckt. »Oh nein«, entfuhr es ihr.
Der Großteil der Hochzeitsgesellschaft hatte sich auf der oberen Terrasse versammelt. Von dort kam ein Mann die Stufen herunter, dessen weißer Anzug sich wie gemalt von seinem dunklen Teint abhob. Dass hinter ihm die Türmchen eines neobarocken Schlosses in der Mittagssonne leuchteten, verstärkte das Gefühl, in ein impressionistisches Gemälde geraten zu sein.
Mit ausgebreiteten Armen kam er auf sie zu. Erst einen Schritt vor ihr blieb er stehen, offensichtlich unschlüssig, welche Begrüßung angemessen war. Verlegen ließ er die Arme zu den Seiten fallen.
Und von Holl, den Minden zum ersten Mal an diesem Tag gerne neben sich gehabt hätte, fiel nichts Besseres ein, als »den beiden Turteltäubchen alles Gute« zu wünschen und sich Richtung Bar zu verabschieden.
»Hi, Inka«, sagte Hossam. »Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst.«
»Ich hab doch zugesagt.«
»Trotzdem.«
Sie schwiegen.
»Schöner Ort«, sagte Minden.
»Clarissa hat ihn ausgesucht.« Hossam betrachtete seine glänzend schwarzen Schuhe.
Noch nie hatte Minden seine marokkanischen Locken in derart akkurater Ordnung gesehen. Als er den Blick hob, wandte sie ihren ab und beobachtete zwei kleine Mädchen in rosa Kleidern, die einen Beagle über die Wiese jagten.
»Geht es dir gut?«, fragte er.
Sie nickte. Hinter den Schläfen pochte der Mai Tai. »Ich freu mich für euch.«
Er räusperte sich. »Du, Inka ... Du weißt, wie viel du mir bedeutest ...«
»Bitte, Hossam, nicht wieder. Nicht heute.«
»Aber du hast Schluss gemacht. Ich hätte alles für dich getan ...«
Sie musste weg. Weg von diesem Gespräch, weg von dieser Feier. Stattdessen sagte sie: »Warum hast du mich eingeladen?« Ihre Stimme war fest, war hart geworden auf dem Weg durch die verkrampfte Halsmuskulatur.
Keine Antwort.
Sie fand die Kraft, ihm in die Augen zu sehen. »Warum, Hossam?«
»Weil ich dich nicht verlieren will.« Es war nur ein Wispern. »Weil ich will, dass du ein Teil meines Lebens bleibst.«
Mit jedem Wort nahm der Druck in Mindens Kiefern zu. Der Grund für Hossams Einladung glich ihrem Grund, diese Einladung anzunehmen.
»Schatz!«, schrillte eine Frauenstimme über den Platz. »Die Fotografin wartet!« In einem goldenen Paillettenkleid rauschte Clarissa Werker heran – Münchens schillerndste Schönheitschirurgin, Meisterin der Selbstinszenierung, Hossams Braut.
Als sie Mindens gewahr wurde, rutschte die aufgekratzte Heiterkeit aus ihren Gesichtszügen. Es dauerte nur einen Moment, dann hatte sie sich wieder gefangen und warf mit großer Geste ihre Arme um Minden. »Inka, meine Liebe, wie schön, dass du da bist.«
Minden unterdrückte den Drang, sich vorzeitig aus der Umarmung zu befreien. »Danke für die Einladung.«
»Natürlich! Hossam hat darauf bestanden, er ist wirklich eine treue Seele. Der Beste. Aber das brauche ich dir ja nicht zu erzählen. Komm, Schatz«, sie packte ihn am Handgelenk, »lass uns die Fotos hinter uns bringen.« Schon stürmte sie wieder davon, ihren Bräutigam hinter sich herzerrend.
Wie einen Gefangenen, schoss es Minden durch den Kopf. Sie schämte sich für ihre Missgunst. Der Schmerz in ihren Kiefern pulsierte dumpf. Die Band spielte Bella ciao. Vor ein paar Monaten hatte die Zahnärztin ihr eine Knirschschiene verschrieben. Minden hatte sie nie abgeholt. Erst ein Wasser, beschloss sie, dann einen Mai Tai.
3
Es wurde nicht besser. Der Trauredner hatte von Schicksal und Seelengleichklang schwadroniert, die Blasen an Min-dens Fersen hatten sich geöffnet, die Band spielte Helene Fischer, und an der Bar gab es kein Eis mehr.
Von Holl hatte sie nicht weiter behelligt, aber das war auch schon die einzige Gnade, die der Tag ihr zu bereiten gewillt schien. Zu jeder Stunde, die verstrich, hatte sie erneut entschieden, das Anwesen zu verlassen, nur um sich stattdessen jedes Mal einen weiteren Drink zu bestellen. Mit Anbruch der Nacht begannen die Lampions in der Platane zu leuchten. Man hatte Minden zwischen zwei Mitgliedern ihres alten Zugs positioniert, und die beiden hatten sich in einer Diskussion darüber verloren, weswegen der Krieg gegen den Terror, den George W. Bush nach 9/11 in Afghanistan begonnen hatte, gescheitert war. Der eine sah den Grund in den komplexen Stammesstrukturen vor Ort, der andere in der Diskreditierung des Unterfangens durch die wenig später erfolgte Irak-Invasion, in der wirtschaftliche und politische Interessen schamlos vermischt worden waren.
Minden empfand das Thema nicht als geeignet, sie von ihrer schlechten Laune zu befreien. Die Männer versuchten ihr Bestes, sie einzubeziehen, aber als Sportsoldatin war sie nie im Einsatz gewesen. Und Kameradschaft entstand nicht im Manöver, das hatte sie früh genug gelernt. Einer der Gründe, weshalb sie damals den Dienst quittiert hatte.
Sobald Hossam das Festmahl für beendet erklärt hatte und die Gesellschaft Richtung Tanzfläche lotste, entschuldigte sich Minden bei ihren Sitznachbarn und machte sich auf die Suche nach einer Zigarette. Hinter einem der Cateringzelte entdeckte sie Bastian, Clarissas Bruder, der gerade damit beschäftigt war, die Hochzeitstorte zu inspizieren. Der Anzug stand ihm. Von seinen zahllosen Tätowierungen war nur noch ein Teil der Dornenhecke am Hals zu sehen.
»Hey, Basti, hast du ne Kippe?«
»Leider nicht.« Er lud die Konditorin ein, sich am Büfett zu bedienen, dann wandte er sich Minden zu. »Ich rauch nicht mehr. Hast du nicht auch aufgehört?«
Minden zuckte die Schultern. Und weil Bastian sie ansah, als läge ihm etwas auf dem Herzen, fragte sie: »Ist was?«
»Also, ich gönne meiner Schwester ihr Glück, wirklich. Aber wenn ich ehrlich bin – du und Hossam, ihr habt schon besser zusammengepasst.« Er zögerte. »Keine Ahnung, ob das jetzt hilft ...«
»Schon gut. Kümmer dich mal um die Torte.« Immerhin war an der Bar neues Eis eingetroffen. Der Park, der das gemietete Schloss umgab, war riesig. Ihre Schuhe in der einen Hand, ihren Drink in der anderen, ging Minden barfuß in den unbeleuchteten Bereich. Die Wiese fühlte sich angenehm kühl an. Es war schwerer als gedacht, auf dem dunklen, unebenen Boden das Gleichgewicht zu halten. Wann war sie das letzte Mal so betrunken gewesen? 2010 musste das gewesen sein, als sie sich für ihre ersten Deutschen Meisterschaften qualifiziert hatte. Ein Luftzug rieselte durch die Baumwipfel, Minden fröstelte. Vierzehn Jahre lag das jetzt schon zurück. Unwillkürlich musste sie grinsen. Wie der Trainer sie am nächsten Morgen entdeckt hatte, völlig zerstört, zusammengerollt auf dem gefliesten Boden der Jungsumkleide, mehr bewusstlos als schlafend. Vor dem versammelten Team hatte er sie dermaßen runtergeputzt, dass sie Rotz und Wasser geheult hatte.
Vor ihr ragte die Silhouette eines Springbrunnens aus dem Dunkel. Über einer der umliegenden Bänke tanzte ein Glühwürmchen. Nein, kein Glühwürmchen, eine Zigarette. Sie trat einen hoffnungsfrohen Schritt näher und erkannte den Kellner, der sie vorhin angesprochen hatte.
»Darf ich mal ziehen?«
»Frau Minden, ja, natürlich, bitte, setzen Sie sich.« Er rückte hastig zur Seite.
Sie setzte sich zu ihm, nahm die dargebotene Zigarette und zog fest genug daran, dass der Tabak bis ins letzte Lungenbläschen drang. Sie hatte nie viel geraucht. Als Kaderathletin war das von vornherein ausgeschlossen gewesen. Während ihres späteren Studiums dann hier und da auf einer Party, das war es auch schon. Zur Eröffnung ihrer Praxis hatte sie wieder aufgehört.
Der Junge neben ihr sagte etwas. Sie hörte nicht zu, aber es klang nicht unangenehm. Sie legte den Kopf in den Nacken und blies den Rauch den Sternen entgegen. Die Venus leuchtete. Eigentlich war es nicht Mindens Angewohnheit, lange Trübsal zu blasen. Es war die richtige Entscheidung gewesen, sich von Hossam zu trennen. Sie zweifelte daran, dass er mit Clarissa glücklich werden würde, aber das mussten die beiden für sich herausfinden. Der Drink – ein Fog Cutter diesmal – glitt warm ihre Kehle hinunter. Sie nahm einen weiteren Zug von der Zigarette.
»Frau Minden?«
»Inka reicht.«
Er sah sie nur an, offenbar erwartete er eine Antwort auf irgendwas.
Minden sog ein letztes Mal an der Zigarette und drückte den Stummel auf der steinernen Bank aus. »Wollen wir knutschen?«
»Wie bitte?«
»Du hast mich schon verstanden.«
»Sie sind betrunken.«
»Ich dachte, wir duzen uns.«
»Sorry, ja, na ja, ich muss dann weiterarbeiten.«
»Ist es mein Kreuz?«
»Was?«
»Mein Kreuz ist zu breit. Du kannst es ruhig zugeben.« Die Worte formten sich zäh, klebten zusammen wie Agavendicksaft. Sie musste aufstoßen.
»Ich muss jetzt wirklich zurück.«
»Wie auch immer. Hast du noch eine Kippe für mich?« Fahrig nestelte der Junge eine Zigarettenschachtel aus seiner Hosentasche und reichte sie ihr. Sie bediente sich. Nachdem er ihr Feuer gegeben hatte, murmelte er einen Abschiedsgruß und machte sich davon, zurück in den Lichtkegel des strahlend hellen Schlosses.
Minden rauchte und sah die Sterne an.
Die Welt war ein Wunder, das musste man glauben, alles andere führte zu nichts.
Irgendwann war der Fog Cutter getrunken, die Blase drückte. Mühselig stemmte Minden sich auf. Die Bäume drehten sich. Nach einigen bangen Sekunden hatte sie das Stehen im Griff.
Die Lampions in der Platane wiesen ihr den Weg. Schritt für Schritt kämpfte sie sich den Hang hinauf. Die Terrassen lagen gespenstisch leer. In den Cateringzelten wurde aufgeräumt. War die Show schon vorbei? Na gut, ihr sollte es recht sein. Während sie zum Parkplatz taumelte, kramte sie ihr Handy aus der Handtasche und suchte eine Taxi-Nummer. Die Tasten waren kleiner als sonst.
Das Tippen beanspruchte sie so sehr, dass sie beinahe über ein winziges Mädchen gestolpert wäre, das quer auf dem Kiesweg lag und offensichtlich schlief. Als Kopfkissen diente ihm ein Teller mit den Resten eines Tortenstücks. Vorsichtig stieg Minden über das Mädchen. Sie fragte sich, ob es vergessen worden war, da hörte sie Jubel vom Park-platz aus. Als sie aufsah, entdeckte sie dort die versammelte Hochzeitsgesellschaft. Eine Frau in mintgrünem Kleid tanzte mit dem Brautstrauß im Kreis und ließ sich beklatschen.
Eine übertrieben lange Limousine fuhr vor. Bastian stieg aus und öffnete mit großem Ernst eine der Hintertüren. Hossam hatte seine Braut auf die Arme genommen und trug sie der Limousine entgegen, gesäumt von einem ausgelassen lärmenden Spalier an Gästen.
Eine sanfte Stille breitete sich in Minden aus. Es war gut, dass es endlich vorbei war. Erst jetzt bemerkte sie, wie sehr die letzten Monate an ihr gezehrt hatten. Sie wäre mit ihm nicht glücklich geworden, er mit ihr auch nicht. Es war das Beste, neue Wege zu gehen, wenn die alten nicht weiterführten. Das Beste für alle.
Nachdem das Brautpaar in der Limousine verschwunden war, schlug Bastian die Tür zu.
Die Limousine verwandelte sich in gleißend helles Licht. Eine Feuersäule stieg hoch.
Die Hochzeitsgäste wurden von der Druckwelle umgeworfen.
Donner und Hitze erreichten Minden.
Wie ein plötzlicher Regenschauer prasselte Glas.
Auf dem Parkplatz heulten die Alarmanlagen los.
4
Von Holl hat sich zu Boden geworfen. Eine Sekunde später steht er wieder. In Deckung zu bleiben wäre fahrlässig gegenüber den Zivilisten. Er sondiert die Lage. Hauptmann und Zugoffizier sind ausgefallen. Von den Feldwebeln ist keiner vor Ort. Es liegt an ihm.
Im Handbuch heißt es, nach der Sprengfalle kommen die Mörser. Die Erfahrung sagt, alles ist möglich.
»Ins Haus!«, brüllt er. Seine Jungs wissen, dass er die Zivilisten meint.
Bei der Restarmee sieht es anders aus. Neben ihm starrt eins ihrer Mitglieder ins Feuer. Von Holl packt den Mann am Ärmel und herrscht ihn an, die Leute ins Schloss zu treiben. Er selbst rennt auf den Parkplatz. Er exponiert sich. Er ist unbewaffnet. Aber er muss wissen, wo der Feind steht. Keine Regung zwischen den Fahrzeugen. Ein Blick zum Wrack – der Medic geht bereits bei Basti in die Hocke. Seinen eigenen Leuten muss von Holl keine Befehle geben. Während er sich neben der Kühlerhaube eines Kombis auf ein Knie fallen lässt, erfasst er die Baumlinie. Auch hier keine Regung. Er blickt in den Nachthimmel. Keine Drohnen – zumindest keine, die er auf die Schnelle erkennen kann. Er unterdrückt den Drang, sich nach seinem Fernmeldespezialisten umzusehen. Der Mann ist nicht unter den Gästen, und selbst wenn, hätte er sein Gerät nicht dabei.
Die Taliban hätten bereits das Feuer eröffnet. Aber wie sollten die Taliban in diesen beschaulichen Münchner Vorort gelangt sein? Wer dann? Von Holl blickt erneut zum Wrack. Flammen züngeln aus den geborstenen Fenstern.
Die Gegebenheiten lassen keine Sprengfalle zu, der Sprengsatz muss am Wagen platziert worden sein. Kein Hinter-halt – ein Attentat. Von Holl beobachtet, wie seine Jungs die Zivilisten ins Schloss drängen. Von den Gästen, die von der Druckwelle erfasst wurden, liegen immer noch einige auf dem Asphalt. Unter ihnen ein kleines Mädchen im rosa Kleid. Von Holl wendet sich wieder der Baumlinie zu. Die Triage muss er dem Medic überlassen. Er starrt mit einer Konzentration in die Finsternis jenseits des Parkplatzes, als könnte schiere Willenskraft den Feind ans Licht befördern.
Nichts.
Ein Attentat. Kein Hinterhalt. Trotzdem schickt er drei Halbtrupps los, das Gelände zu sichern. »Wer hat sein Auto hier?«, ruft er seinen Leuten zu. Vier Hände gehen hoch. Er befiehlt ihnen, Verbandskästen zu holen. Den Rest weist er an, dem Medic mit den Verletzten zu helfen. Dann eilt er ins Foyer des Schlosses, sieht nach den übrigen Gästen. Der Schrecken in ihren Augen lodert wie das Feuer, dem sie entronnen sind. Stumm starren sie ihn an. Alle stehen, also sind sie körperlich unversehrt, und das ist von Holl genug. Sie vor der seelischen Wunde zu schützen liegt weder in seiner Verantwortung noch in seiner Macht.
Unter den Zivilisten entdeckt er Minden, ein Mädchen im rosa Kleid auf dem Arm. Hat er das Mädchen nicht drau-ßen liegen sehen? Dann fällt es ihm ein: Zwillingsschwestern. Zu wem sie gehören, hat er vergessen.
Minden hat ihr Mobiltelefon in der freien Hand. »Die Rettung ist unterwegs.«
»Hältst du hier die Stellung?«
Minden nickt.
Von Holl rennt wieder nach draußen. Lässt sich vom Medic die Lage schildern. Mehrere Leichtverletzte, hauptsäch-lich Verbrennungen ersten Grades. Selbst Basti ist stabil. Die Explosion scheint glimpflich verlaufen zu sein. Außer für das Brautpaar natürlich. Von Holl vermeidet den Blick zum Wrack. Der erste seiner Trupps ist zurück und erstattet Bericht. Keine Auffälligkeiten.
Von Holl gibt Anweisungen, holt Meldungen ein, wischt sich Blut aus den Augen. Woher es kommt, weiß er nicht, aber der Medic hat ihn nicht darauf aufmerksam gemacht, also kann es nicht schlimm sein.
Als zwischen den Bäumen das erste Blaulicht flackert, rennen einige Zivilisten aus dem Foyer auf die Terrasse. Von Holl unternimmt nichts dagegen. Ein Attentat, kein Hinterhalt. Er hat bereits dafür gesorgt, dass alle Autos ausreichend umgeparkt wurden, um den Rettungskräften Platz zum Rangieren zu lassen.
Überraschenderweise ist der Löschzug der Feuerwehr vor der Polizei da. Von Holl läuft dem Einsatzleitwagen entgegen und unterrichtet die Zugführerin. Noch während er spricht, gibt sie ihre eigenen Anweisungen.
Es dauert eine Weile, bis er versteht, dass er nicht mehr gebraucht wird. Unschlüssig steht er im blau flackernden Licht, während Einsatzfahrzeug um Einsatzfahrzeug auf den Parkplatz schießt. München scheint alles geschickt zu haben, bei dem der Motor angesprungen ist. Eine mobile Leitstelle wird per Tieflader geliefert, zwei Rettungsbusse kommen nicht durch und müssen aus der Zufahrt zurücksetzen.
Eine Ärztin spricht von Holl an. Er versteht nicht, was sie will, sie muss die Frage wiederholen. Ob er irgendetwas brauche? Er schüttelt den Kopf. Sie reicht ihm trotzdem eine knisternde Rettungsdecke. Mechanisch nimmt er sie an. Die Ärztin will seine Stirn untersuchen, aus der es immer noch blutet. Er unterdrückt den Reflex, sie darauf hinzuweisen, dass es bloß eine Platzwunde ist. Die Ärztin macht nur ihre Arbeit. Sicher ist sie gut ausgebildet, aber sie ist Zivilistin. Sie würde die falschen Schlüsse ziehen, wenn er sich querstellte.
Sie nimmt ihn an der Hand und führt ihn wie ein Kind zum nächsten Rettungswagen. Er lässt es geschehen. Sie gibt ihm einen Kaffee im Pappbecher und klebt seine Wunde. Seine Liege wird gebraucht, er gibt sie frei und setzt sich auf den Tritt am Heck. Ein paar Meter entfernt entdeckt er seinen von der zivilen Rettung zum Nichtstun verdammten Medic, der ebenfalls einen Pappbecher in der Hand hält.
Er winkt ihn zu sich und fragt ihn nach Werker. »Stabil«, wiederholt der Medic seine vorige Beurteilung.
»Immerhin«, murmelt von Holl.
»Ja.«
»Das Mädchen?«
»Rika? Mit dem Schrecken davongekommen.«
»Gut.«
Schweigend sitzen sie da und trinken ihren Kaffee. Irgendwann steht der Medic auf. »Ich geh mal telefonieren.«
Von Holl nickt und trinkt seinen Kaffee alleine weiter. Erst jetzt merkt er, welche entkoffeinierte Plörre man ihm da in den Becher gefüllt hat. Aber er ist den Leuten nicht böse. Sie bemühen sich. Er schüttet den Rest des Kaffees unauffällig unter den Tritt, auf dem er sitzt.
Ein Mann im Anzug kommt auf ihn zu. Er trägt ein Sakko, das schon bessere Tage gesehen hat. Auch der Mann hat schon bessere Tage gesehen.
»Herr von Holl?« Er hat die Augen eines Trinkers.
Von Holl nickt.
»Erich Kleinrädl.« Der Mann streckt ihm die Hand entgegen. »Ich leite die Ermittlungen.«
SONNTAG
5
Minden saß im Wartezimmer des Kriminalfachdezernats 1 in München auf einem grauen Schalensitz aus Plastik und beobachtete die Wanduhr, die ihr gegenüber neben einem Flyerständer hing. Der Minutenzeiger sprang auf die Zwölf. Drei Uhr nachts. Vor einer halben Stunde hatte das Adrenalin nachgelassen, seitdem spürte sie den Alkohol wieder. Die bohrenden Kopfschmerzen kündeten einen phänomenalen Kater an. Ihr Magen rumorte. Sie hielt sich an ihrem Automatenkaffee fest, ohne zu trinken. Ein einziger weiterer Schluck, und sie würde sich übergeben müssen. Sie schielte den Gang hinunter, der zu den Toiletten führte. Prophylaktisches Erbrechen? Der Gedanke war verlockend. Irgendetwas hielt sie zurück. Stolz? Trotz? Ein Klicken, als der Minutenzeiger seine Runde fortsetzte.
Eine Tür öffnete sich, und eine blutjunge Beamtin bat Minden, ihr zu folgen. Die Beamtin führte sie in ein kleines Büro, in dem ein älterer unrasierter Mann in zerknittertem Sakko saß. Sie hatte ihn schon am Tatort gesehen, allerdings nur von Weitem. Von Nahem sah er so müde aus, wie Minden sich fühlte. Der Mann erhob sich und stellte sich als Hauptkommissar Kleinrädl vor, seine Kollegin als Kommissarin Schlanghain. Minden verspürte den plötzli-chen Drang, sich die Zähne zu putzen.
»Ich hoffe«, begann Kleinrädl, »es ist in Ordnung, wenn wir unser Gespräch aufzeichnen?« Als Minden keinen Einspruch erhob, nickte er Schlanghain zu. Diese hatte bereits das Aufnahmegerät aus einem Metallschrank geholt, legte es auf den Tisch und schaltete es ein.
Kleinrädl nahm Mindens Personalausweis zur Hand, den sie schon vorher hatte abgeben müssen. Er drehte den Bildschirm zur Seite, der zwischen ihnen auf dem Tisch stand und den Blick versperrt hatte. »Sie sind Inka Minden?«
Sie nickte.
Kleinrädl deutete entschuldigend auf das Aufnahmegerät.
»Ja, bin ich.«
»Geboren am 12. Oktober 1988?«
»Ja.«
Nachdem Minden außerdem Adresse und Familienstand bestätigt hatte, reichte Kleinrädl ihr den Personalausweis zurück. Schlanghain hatte sich auf seine Seite des Schreibtischs gesetzt und tippte etwas in den Computer.
»Sie waren am gestrigen Abend Teil der Gesellschaft, die sich in Schloss Walfurt versammelt hatte, um die Hochzeit des Ehepaars Said zu feiern. Ist das korrekt?«
Minden nickte erst, dann erinnerte sie sich an das Aufnahmegerät. »Ja.«
»Können Sie uns einen Überblick geben, wie der Abend aus Ihrer Sicht verlaufen ist?«
Sie beschränkte ihre Ausführungen auf das Nötigste. Über zweihundert Menschen hatten die Explosion gesehen, und sie wusste nicht, was genau ihre Aussage zur Lösung des Falls beitragen sollte. Sie wollte sich nicht damit auseinandersetzen, was geschehen war. Und vor allem wollte sie diese wenigen kostbaren Stunden, die sie noch hatte, bis die Erkenntnis und mit ihr der Schmerz kommen würden, nicht auf einer elenden Polizeiwache verbringen.
Als sie geendet hatte, lehnte sich Kleinrädl in seinem verschlissenen Bürostuhl zurück. Die Lehne knackte bedrohlich. Er wartete, bis Schlanghain aufgehört hatte zu tippen, dann fragte er: »Irgendwelche Auffälligkeiten vor der Explosion?«
Minden schüttelte den Kopf. Ihr Schädel glühte. »Wissen Sie vielleicht, ob eines der Opfer in der Vergangenheit in Konflikte verwickelt war?«
»Was denn für Konflikte?«
»Was immer Ihnen einfällt.«
»Nichts, was einen Mord rechtfertigen würde.«
»Haben Sie die Beziehung zwischen Herrn und Frau Said als belastet wahrgenommen?«
»Wieso?«
»Einige Zeugen haben erwähnt, dass das Brautpaar etwas angespannt gewirkt habe.«
»Welches Brautpaar ist nicht angespannt während der eigenen Hochzeit?«
Kleinrädl warf einen Blick auf Schlanghains Bildschirm. »Sie waren bei der Bundeswehr, Frau Minden?«
»Was tut das denn zur Sache?«
»Dort haben Sie Herrn Said kennengelernt, richtig?« »Kann ich vielleicht eine Aspirin haben?«
Kleinrädl nickte Schlanghain zu, woraufhin diese den Raum verließ.
»In welchem Verhältnis standen Sie zu Herrn Said?« Minden seufzte. »Wir waren mal eine Weile zusammen.« »Bis wann?«
»Letzten Dezember.«
»Trotzdem waren Sie zur Hochzeit eingeladen ...«
Da es sich nicht direkt um eine Frage handelte, verzichtete Minden auf eine Antwort.
»Das heißt, Sie haben nach der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt?«
»Ja.«
»Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Clarissa Said, geborene Werker, beschreiben?«
»Ich kannte sie nicht gut, hab sie nur ein paarmal gesehen, über Basti.«
»Bastian Werker, Clarissas Bruder, richtig? Sie haben gegenüber Clarissa nie Eifersucht verspürt?«
Minden wunderte sich, was die persönlichen Fragen sollten. Offenbar zog Hauptkommissar Kleinrädl tatsächlich in Erwägung, dass sie hinter dem Anschlag steckte.
»Alles in Ordnung, Frau Minden?«
Die absurde Situation hatte sie auflachen lassen, doch Kleinrädls besorgter Ton brachte sie rasch in den Ernst der Lage zurück. Sie nickte matt.
Der Kommissar schien mit der Reaktion nicht zufrieden. Glücklicherweise öffnete sich im selben Moment die Tür. Schlanghain trat ein, hatte zusätzlich zur Schmerztablette einen Becher Wasser dabei. Dankbar nahm Minden beides entgegen.
Kleinrädl schien die pikanten Fragen fürs Erste sein lassen zu wollen. »Sie haben Herrn Werker genauso wie Herrn Said bei der Bundeswehr kennengelernt?«
»Ja.«
»Aber Sie selbst waren nie beim KSK?«
»Nein, Sportsoldatin, bei den Gebirgsjägern. Dort war Basti eine Zeit lang Zugführer. Bevor er zum KSK ist.«
»Und Said?«
»Den habe ich erst beim KSK kennengelernt.«
»Aber Sie sagten doch, Sie seien nie beim KSK gewesen.« »Stimmt.«
»Ihre Einheit wurde gemeinsam mit dem KSK ausgebildet?«
»Nein, ich habe ein paar Fortbildungen geleitet.«
»Fürs KSK?« Der Unglaube in Kleinrädls Stimme war nicht zu überhören.
Früher hatte Minden es persönlich genommen, dass man ihr nicht zutraute, der Eliteeinheit der Bundeswehr gewachsen zu sein. Inzwischen sah sie es als Bestätigung für ihre Entscheidung, dem Militär den Rücken zu kehren.
»Was haben Sie denn unterrichtet?«
»Liegestütze.«
Kleinrädl runzelte die Stirn, aber so erschöpft er auch sein mochte, er bemerkte doch die Ironie. »Frau Minden?«
»Ich war Heeresbergführerin. Mit dem KSK habe ich das Überleben im Gebirge geübt.«
»Würden Sie sagen, dass eine derartige Extremsituation Menschen enger aneinanderbindet, als es sonst möglich wäre?«
Hinter Mindens Schläfen pochte es. »Herr Kleinrädl, ich habe Hossam und Clarissa nicht umgebracht. Da Sie mir noch keinen Anwalt angeboten haben, vermute ich, dass Sie mich bisher nur als Zeugin vernehmen. Es ist halb vier vorbei, und ich würde gern in mein Bett. Kann ich Ihnen noch irgendeine Frage beantworten, die tatsächlich mit dem Fall zu tun hat? Sonst würde ich mich jetzt verabschieden, wenn’s genehm ist.«
Kleinrädl rieb sich den Nasenrücken. »Ja, Sie haben natürlich recht, es ist spät.« Er erhob sich. »Wenn Ihnen noch jemand einfällt, der dem Brautpaar missgünstig gestimmt gewesen sein könnte, geben Sie bitte Bescheid.«
Auch Minden war aufgestanden. »Oder Basti.«
»Bitte?«
»Es war klar, dass Basti die Limousine fahren würde. Der Anschlag kann genauso gut ihm gegolten haben.«
»Auch das ist möglich.« Die ausdruckslose Miene des Kommissars gab nicht preis, ob er die Möglichkeit selbstverständlich in Betracht gezogen oder völlig übersehen hatte. »Danke für Ihre Zeit. Meine Kollegin bringt Sie nach draußen.«
6
Prokofjew, Romeo und Julia. Als von Holl 2020 nach Wies-baden gezogen war, hatte er den Steinway nicht mitgenommen. Eine Entscheidung, die ihm nun zugutekam. Er brauchte kein Blatt. Er hatte den Blick auf den Ammersee gerichtet, seine Finger folgten den Befehlen des Meisters. Im Hause Capulet wurde zum Tanz aufgespielt, und tanzen würden die Gäste, der Hausherr wollte es so. Der Hass hatte längst alle Freude zerrieben, die je in des Hausherrn Herzen gewohnt haben mochte. Der Hass war überall. Er hing in den Ecken der stuckbesetzten Decke, dünstete aus den schweren, samtenen Vorhängen, knirschte im Parkett. Legte sich schwer wie ein Henkersknoten um die Hälse der Gäste. Doch so, wie die Gäste nicht gewagt hatten, die Einladung des Grafen abzulehnen, so wagten sie auch jetzt nicht, sich der Farce zu entziehen. Sie tanzten. Tanzten, bis die Masken drückten und die Zehen bluteten. Tanzten und lachten dabei, in dem verzweifelten Bestreben, dem bösen Blick zu entkommen, mit dem der Graf all jene bedachte, die sich seiner Gnade zu sicher wähnten.
Und von Holl war vom Grafen, war vom Teufel persönlich erwählt, mit seinem Spiel die Posse am Laufen zu halten. Von Holl spielte, als ob es kein Morgen gäbe.
Doch es war Mitte Juni, der Morgen kam bald. Auf der anderen Seite des Sees blutete die Sonne bereits zwischen den Bäumen hindurch. Alles war Welt. Man konnte ihr nicht entkommen, selbst im Ballsaal der Capulets spürte sie einen auf. Man konnte nichts anderes tun, als sich ihr zu stellen und das Beste zu hoffen. Von Holl wischte sich das Haar aus der schweißnassen Stirn und ging in die Küche, um ein Glas Wasser zu trinken. Auf Knopfdruck spuckte der Kühlschrank ihm Eiswürfel aus. Die einzige Annehmlichkeit, auf die er nie verzichten würde.
Nachdem er sich entkleidet hatte, ging er nackt nach draußen und zum See. Er schwamm so lange, bis das Wasser sich rosa färbte. Der Kleber, der seine Platzwunde zusammengehalten hatte, hatte sich gelöst. Auf dem Weg zurück ins Haus winkte sein Nachbar ihm zu, ein dicker Mann, der sein Vermögen mit Schrauben gemacht hatte. Von Holl hatte sich nie länger mit ihm befasst.
Als er sich hergerichtet und angekleidet hatte, fuhr er in die Stadt. Man hatte Bastian nach Großhadern in die Uniklinik gebracht. Von Holl war zwei Stunden früher da, als die Besuchszeiten es erlaubten. Er nutzte die Zeit, um seine eigene Wunde ein zweites Mal schließen zu lassen. Danach vertrat er sich die Beine und fand einen Buchladen, der Lustige Taschenbücher führte. Von Holl kaufte vier und machte sich auf den Rückweg zum Krankenhaus. Zwei der Bücher hatte er bereits durchgeblättert, als die Rezeptionistin auf ihre Theke klopfte und verkündete, die Morgenvisite sei abgeschlossen und die Station für Besuche freigegeben. Mit dem Telefonhörer in der Hand fragte sie, wen er denn besuchen wolle.
Als er den Namen sagte, zögerte sie, wies ihn an zu warten. Sie rief einen weiteren Pfleger zu sich, besprach sich leise mit ihm. Dann verschwand er wieder, sie selbst bat von Holl um etwas Geduld.
Nach einer Minute kam der Pfleger zurück und schüttelte den Kopf.
Die Rezeptionistin machte ein mitfühlendes Gesicht. »Sie können ihn leider nicht sehen.«
»Wie bitte? Der Medic meinte, er ist stabil ...«
»Keine Sorge, Ihrem Freund geht es gut. Polizeiliche Anweisung. Irgendeine potenziell erhöhte Gefahr oder so was.«
»Erhöhtes Gefährdungspotenzial?« Von Holl schnaubte spöttisch. »Welcher Raum?«
»Wie gesagt, Sie können jetzt nicht ...« Sie verstummte, als von Holl ihr seinen BKA-Ausweis hinhielt.
»Welcher Raum?«
»2.11. Dritter Stock«, murmelte sie. »Der Fahrstuhl ist links.«
Von Holl nahm die Treppe. Vom Treppenhaus aus gelangte er auf einen Gang, in dem es stärker als nötig nach Desinfektionsmitteln roch, und sah bereits die beiden Männer vom Vollzugsdienst, die vor einer der Türen standen und gelangweilt in ihre Handys starrten. Als er ihnen entgegenkam, blickten sie auf.
»Ich will zu Werker«, sagte von Holl, und weil er keine Lust auf Diskussionen hatte, hielt er ihnen direkt seinen Ausweis entgegen.
Die ältere der beiden Wachen verzog das Gesicht. »BKA? Das ging schnell. Gestern hieß es noch, München ist zuständig.«
»Nicht Ihr Bier, würde ich behaupten.« Ohne die Beamten weiter zu beachten, öffnete von Holl die Tür. Ein Einzelzimmer, natürlicherweise. Instinktiv hatte er einen Maschinenwald erwartet, stattdessen fand er neben dem Bett nur ein einsames, leise piepsendes EKG.